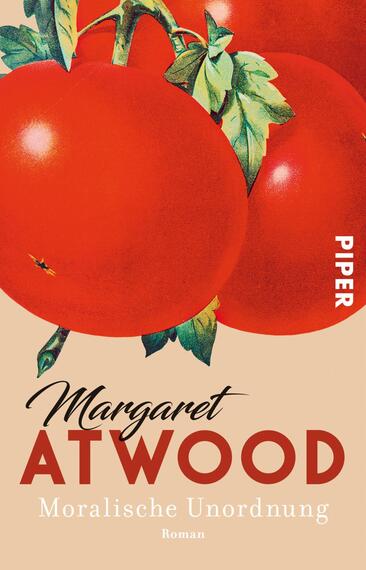
Moralische Unordnung
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
In ihrem Roman führt uns Margaret Atwood mitten hinein in ihr eigenes Leben: Sie erzählt die Geschichte von Nell, schildert deren kluge, lebenstüchtige, aber kühle Mutter, den Vater, einen Insektenforscher, und die viel jüngere, kapriziöse und psychisch labile Schwester. Als Nell das Elternhaus verlässt, verdient sie ihr erstes Geld als freie Lektorin. Sie lernt den Mann ihres Lebens, Tig, kennen, der aber noch mit Oona verheiratet ist und zwei Söhne hat. Von dieser Ehe kann Tig sich nur sehr langsam lösen, bis Oona Tig und Nell schließlich zusammenbringt, dann jedoch nicht aushält, was sie…
In ihrem Roman führt uns Margaret Atwood mitten hinein in ihr eigenes Leben: Sie erzählt die Geschichte von Nell, schildert deren kluge, lebenstüchtige, aber kühle Mutter, den Vater, einen Insektenforscher, und die viel jüngere, kapriziöse und psychisch labile Schwester. Als Nell das Elternhaus verlässt, verdient sie ihr erstes Geld als freie Lektorin. Sie lernt den Mann ihres Lebens, Tig, kennen, der aber noch mit Oona verheiratet ist und zwei Söhne hat. Von dieser Ehe kann Tig sich nur sehr langsam lösen, bis Oona Tig und Nell schließlich zusammenbringt, dann jedoch nicht aushält, was sie angerichtet hat.
Über Margaret Atwood
Aus „Moralische Unordnung“
DIE SCHLECHTEN NACHRICHTEN
Es ist Morgen. Die Nacht erst einmal überstanden. Zeit für die schlechten Nachrichten. Ich stelle mir die schlechten Nachrichten als riesenhaften Vogel vor, mit Krähenflügeln und dem Gesicht meiner Lehrerin in der vierten Klasse samt dünnem Haarknoten, schlechten Zähnen, ewig gerunzelter Stirn, verkniffenem Mund und dem ganzen Rest. Dieser Vogel segelt im Schutz der Dunkelheit um die Welt, freudig überbringt er schlimme Neuigkeiten, er trägt einen Korb mit faulen Eiern, und bei Sonnenaufgang weiß er genau, wo er die fallen lässt. Auf mich [...]






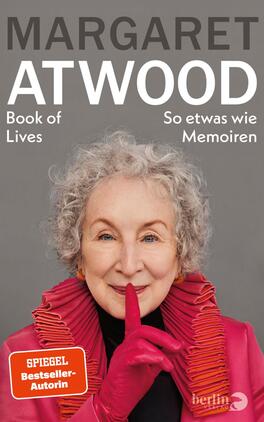
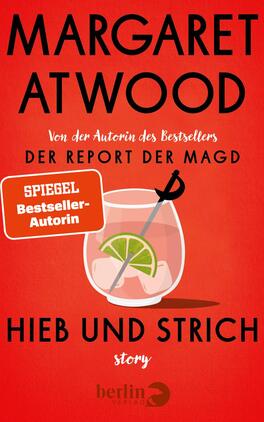


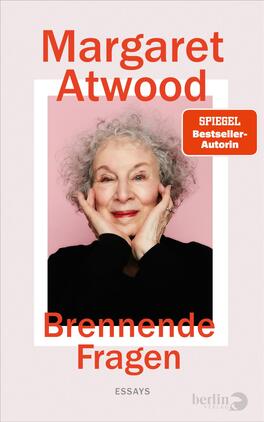
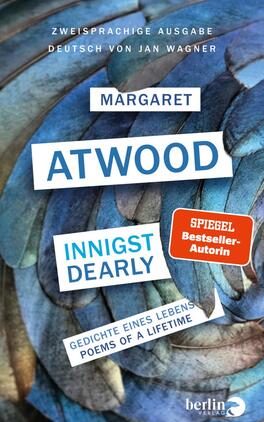
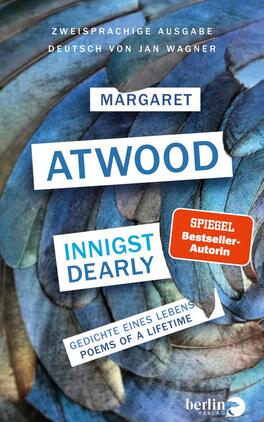

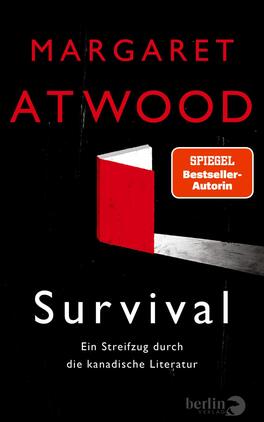
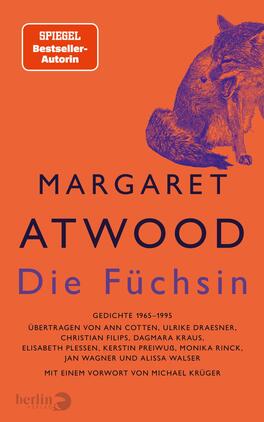
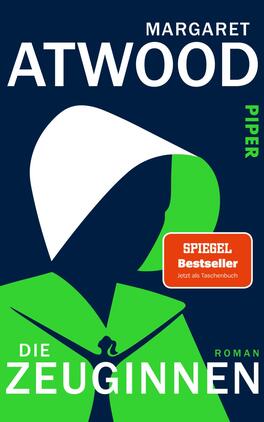



Die erste Bewertung schreiben