Produktbilder zum Buch
Mein Name ist Hope Nicely. Hope wie Hoffnung und Nicely wie nett.
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Hope Nicely ist eigentlich glücklich mit ihrem Leben: Sie ist 25 Jahre alt, hat einen Job und lebt bei ihrer Adoptivmutter Jenny. Aber eine Frage nagt an ihr: Warum hat ihre leibliche Mutter in der Schwangerschaft nicht auf sie aufgepasst? Seitdem lebt Hope mit einer Entwicklungsstörung. Ihr Kopf funktioniert anders, ihre Emotionen sind eigenwillig. Um ihre Mutter zu verstehen, schreibt Hope ein Buch. Der Schreibkurs, die fremden Leute und neuen Erfahrungen sind herausfordernd. Doch die größte Veränderung steht noch bevor: Jenny wird krank, und zum ersten Mal ist Hope auf sich allein gestellt.
…
Hope Nicely ist eigentlich glücklich mit ihrem Leben: Sie ist 25 Jahre alt, hat einen Job und lebt bei ihrer Adoptivmutter Jenny. Aber eine Frage nagt an ihr: Warum hat ihre leibliche Mutter in der Schwangerschaft nicht auf sie aufgepasst? Seitdem lebt Hope mit einer Entwicklungsstörung. Ihr Kopf funktioniert anders, ihre Emotionen sind eigenwillig. Um ihre Mutter zu verstehen, schreibt Hope ein Buch. Der Schreibkurs, die fremden Leute und neuen Erfahrungen sind herausfordernd. Doch die größte Veränderung steht noch bevor: Jenny wird krank, und zum ersten Mal ist Hope auf sich allein gestellt.
In Hopes Welt eintauchen zu dürfen ist wie ein Jahrmarkt – etwas chaotisch, manchmal überfordernd, aber traumhaft schön
Über Caroline Day
Aus „Mein Name ist Hope Nicely. Hope wie Hoffnung und Nicely wie nett.“
Prolog
Mein Name ist Hope Nicely. Hope wie Hoffnung. Nicely wie nett.
Warum ich dieses Buch schreibe? Das ist einfach. Dieses Buch wird mein Leben verändern. Ich war noch nie in einer Gruppe wie dieser. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals versuchen würde, tatsächlich ein Buch zu schreiben. Also kein richtiges. Ich meine, Hand aufs Herz, die meisten meiner Lehrer hätten euch gesagt, ich wäre die Letzte, die das jemals tun könnte. Sie würden sagen, dass ich es wahrscheinlich nicht zu Ende bringen würde. Nicht sehr wahrscheinlich, Hope Nicely. Nicht wenn das Buch [...]



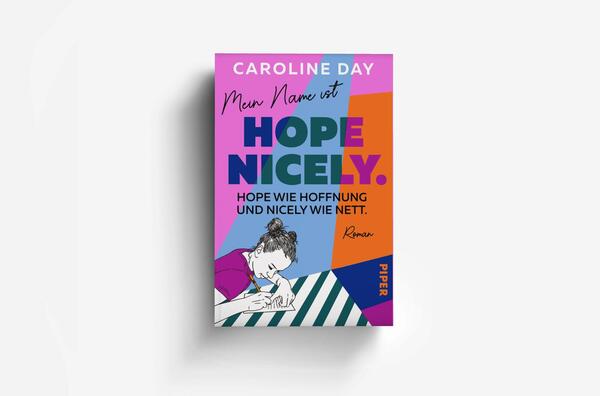
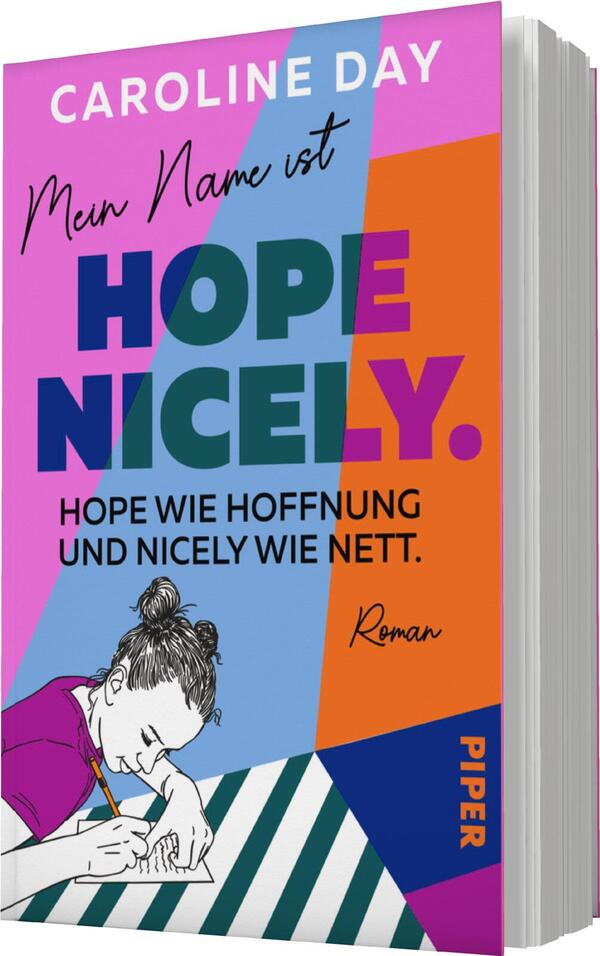
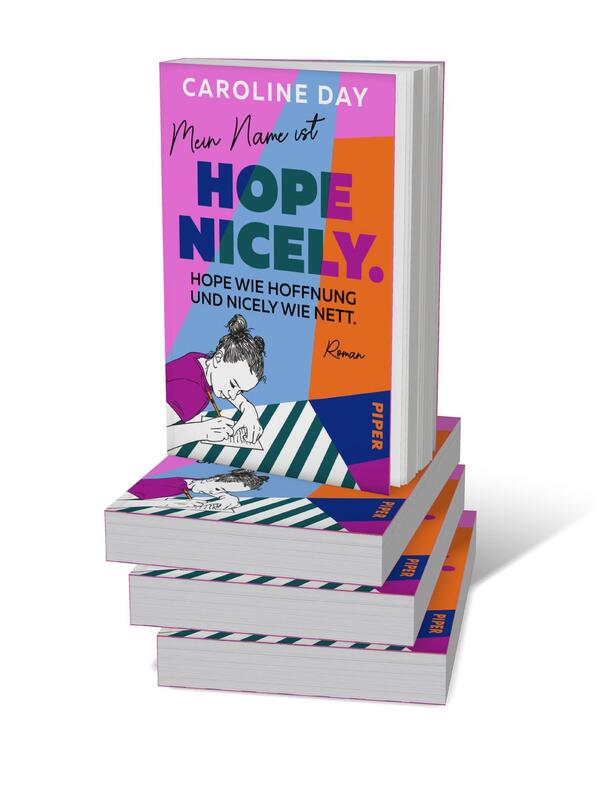
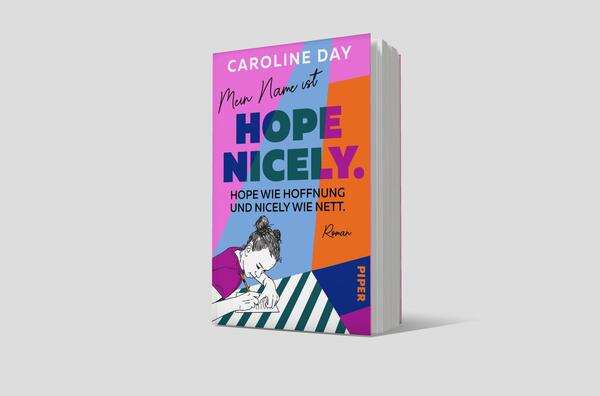





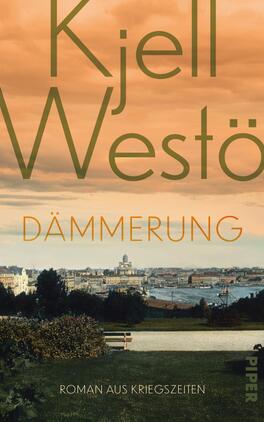

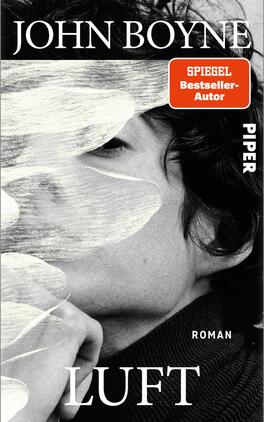

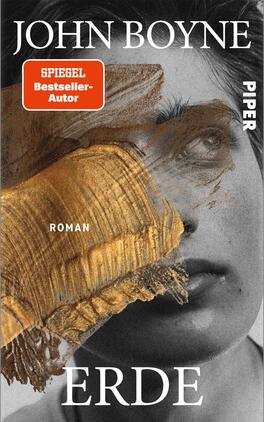
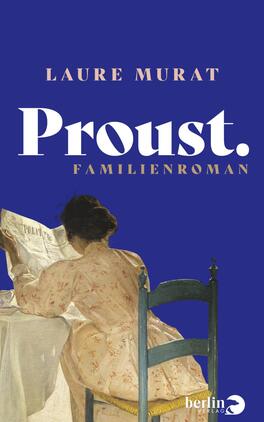

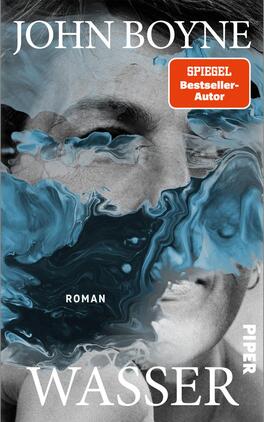

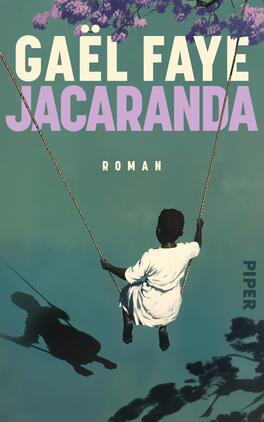





Die erste Bewertung schreiben