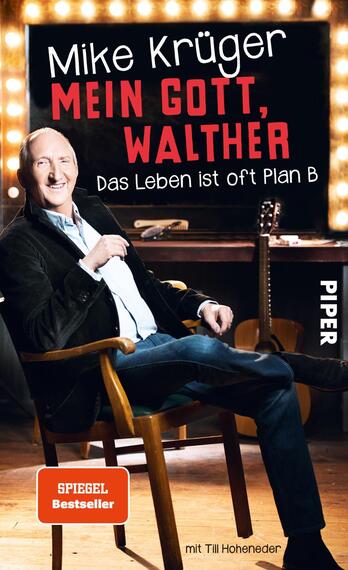
Mein Gott, Walther - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Mike Krüger ist die Kultfigur im deutschen Fernsehen. In den Siebzigern vertonte er mit „Mein Gott, Walther“ das Lebensgefühl der Mittelschicht, in den Achtzigern erfand er mit Thomas Gottschalk die deutsche Kino-Komödie neu und zur Jahrtausendwende zog er zusammen mit Rudi Carrell und „7 Tage, 7 Köpfe“ in jedes deutsche Wohnzimmer ein. Doch mühelos verlief sein Leben vor der Ausnahmekarriere keineswegs. Ähnlich wie im Kultsong „Mein Gott, Walther“ kannte er das Hadern, die Sehnsucht nach Akzeptanz und fühlte sich erst frei, als er begriff, dass es auch in Ordnung ist, „unter den Kleinen einer…
Mike Krüger ist die Kultfigur im deutschen Fernsehen. In den Siebzigern vertonte er mit „Mein Gott, Walther“ das Lebensgefühl der Mittelschicht, in den Achtzigern erfand er mit Thomas Gottschalk die deutsche Kino-Komödie neu und zur Jahrtausendwende zog er zusammen mit Rudi Carrell und „7 Tage, 7 Köpfe“ in jedes deutsche Wohnzimmer ein. Doch mühelos verlief sein Leben vor der Ausnahmekarriere keineswegs. Ähnlich wie im Kultsong „Mein Gott, Walther“ kannte er das Hadern, die Sehnsucht nach Akzeptanz und fühlte sich erst frei, als er begriff, dass es auch in Ordnung ist, „unter den Kleinen einer der Größten zu sein“. Anlässlich seines 40. Bühnenjubiläums wirft er einen Blick zurück und erzählt, warum eine einsame Kindheit auch humorbildend sein kann und wie er aus Versehen zu einem der beliebtesten Entertainer der Republik wurde. Denn das Leben ist oft Plan B!
Medien zu „Mein Gott, Walther“
Über Till Hoheneder
Über Mike Krüger
Aus „Mein Gott, Walther“
Wie ich wurde, was ich blieb
Es war wohl der größte Fehlstart des Jahrhunderts, wenn man mal von Jürgen Hingsens Hattrick bei den Olympischen Spielen in Seoul absieht. Obwohl, als Sprinter bei Olympia dreimal zu früh aus dem Startblock zu eiern ist vielleicht immer noch besser, als zwei Monate zu früh bei seiner eigenen Geburt zu erscheinen. Halbseitig gelähmt in einem Ulmer Brutkasten zu liegen war in meinen babyblauen Augen kein standesgemäßer Start. Jedenfalls nicht für jemanden, der fest damit gerechnet hatte, im lichtdurchfluteten Kinderzimmer eines Penthouses [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wie ich wurde, was ich blieb
Edel sei der Mensch, Milchreis tut gut
Keiner soll hungern, ohne zu frieren
Die weißen Tauben sind Möwen
Bleib bei mir, wenn ich komme
Du bist schön groß, du nagelst unten
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser
Wer im Dunkeln steht, hat für den Spot nicht gesorgt
Die Supernasen
Ist das Kunst, oder kann das weg ?
Ruhe, Licht aus, ich will lesen
Nachwort
Dank
Bildnachweis




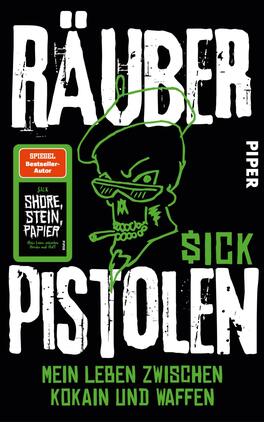
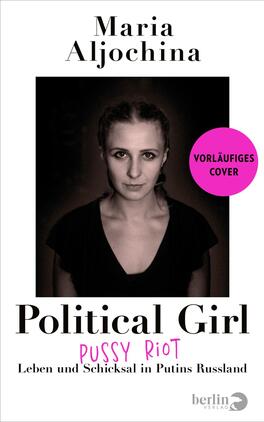
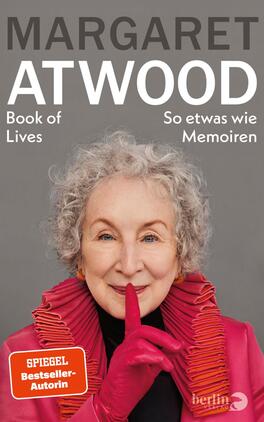


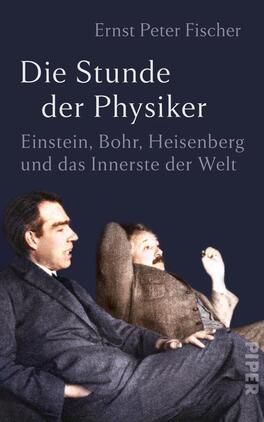




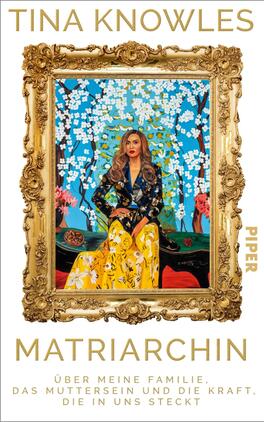

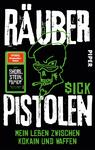


Die erste Bewertung schreiben