„Wir können in den Archiven stöbern und die Lebensgeschichte jedes gefeierten Rennpferdes der Neuzeit rekonstruieren – aber nicht die Shakespeares!“, schreibt Twain - halb klagend, halb belustigt über diese Ironie. Er schlussfolgert: „Es gibt viele Gründe, warum das so ist […]; doch es gibt einen Grund, der alle anderen zusammengenommen aufwiegt, und dieser Grund ist, für sich allein, vollkommen hinreichend – er hatte keine Lebensgeschichte, die festzuhalten wert gewesen wäre.“
Leander Haußmann widerspricht und setzt sich mit Twains Spotttext auseinander. Haußmann, selbst Film- und Theaterregisseur und Schauspieler, war schon in seiner Kindheit begeisterter Shakespeare- und Twain-Leser und sieht sich nun den einen vor dem anderen verteidigen: „War nicht Shakespeare einfach ein genialer Autodidakt“, fragt sich Haußmann in seinem Vorwort und setzt Idealismus gegen Twains rabenschwarzen Zynismus. „Oder steckte hinter dem Namen Shakespeare eine ganze Gruppe erfahrener Literaten und Dramatiker, deren komplexe Zusammenarbeit unter dem Alias die Genialität der Werke ja aber wahrhaftig nicht mindern würde?“, fragt Haußmann weiter.
Aber es ist schwer, Twains satirischem Scharfsinn Paroli zu bieten, wenn er schreibt, er habe nicht die Absicht oder halte es gar für unmöglich, irgendjemanden zu überzeugen. Eine Debatte, bei der es der einen Seite an Fakten und der anderen an Sympathie mangelt, ließe sich niemals beenden. Der Kult um Shakespeare sei ein inzwischen jahrhundertealter Kampf zwischen Faszination und Beweismangel, der in einer Art Glauben gipfele. Und der Glauben muss wahrhaftig stark sein, wenn einer, der ein großer Dichter gewesen sein soll, bei seinem Tod kein einziges Buch sein eigen nannte, kommentiert Mark Twain. Und wer seine unnachsichtige, amüsante Majestätsbeleidigung liest, dessen Glaube mag ins Wanken geraten.

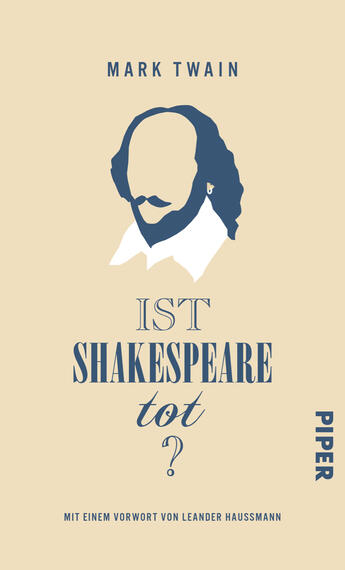


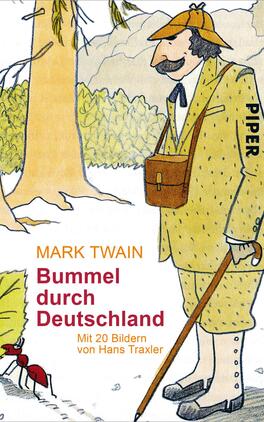
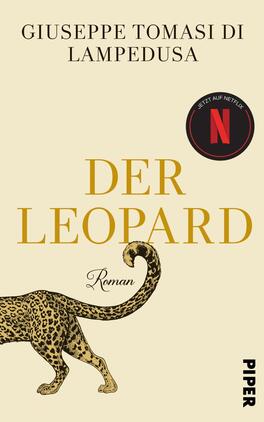
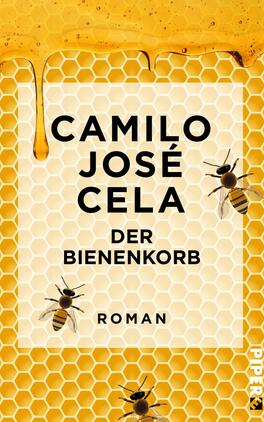

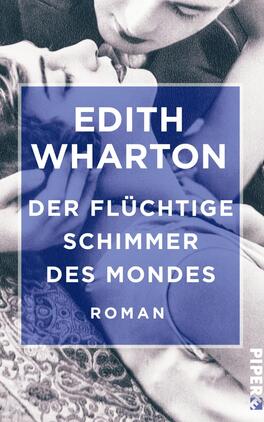
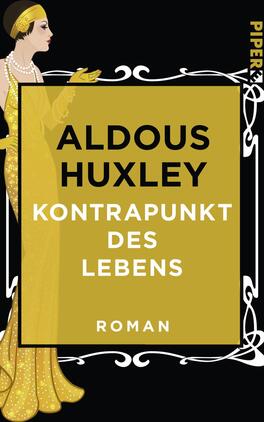
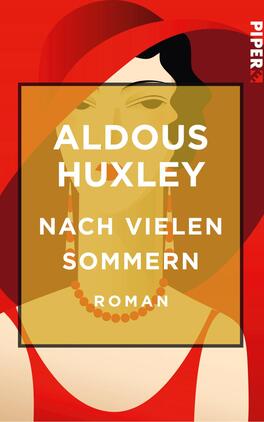
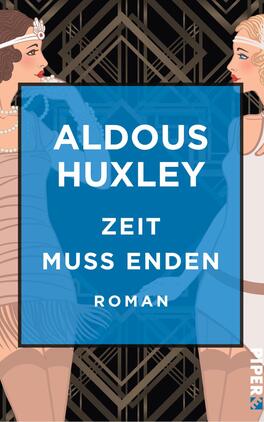
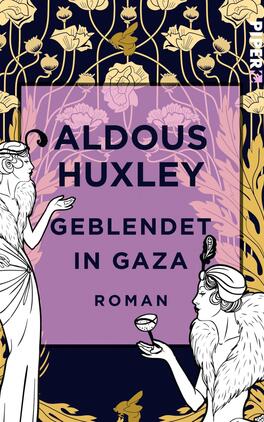
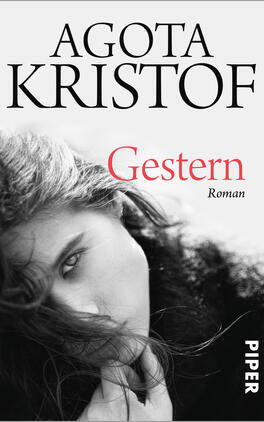
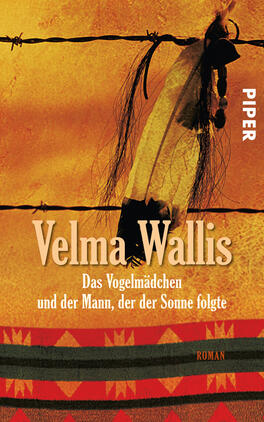
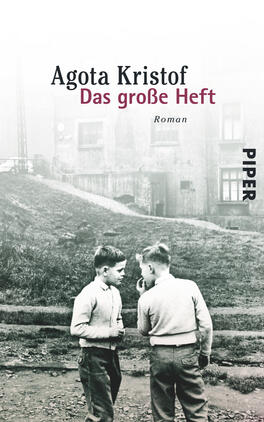
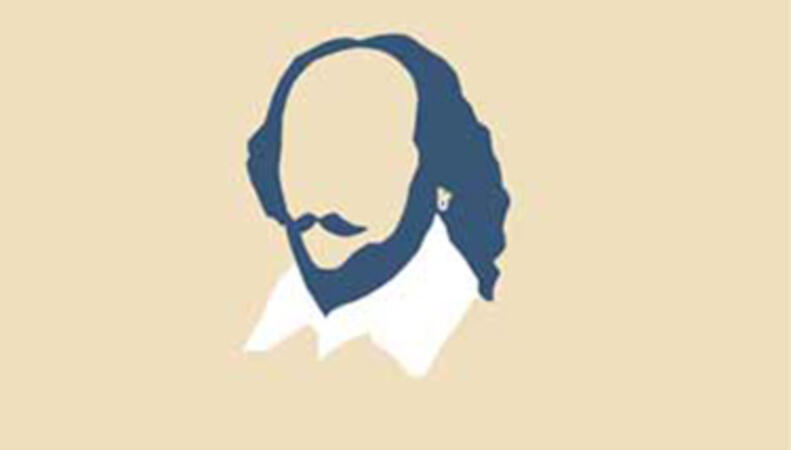
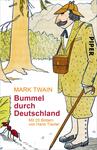
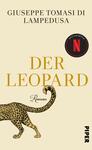
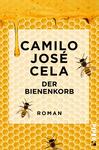
Die erste Bewertung schreiben