Produktbilder zum Buch
Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„...humorvoll und kurzweilig.“
Potsdamer Neueste NachrichtenBeschreibung
Potsdam - ein ideales Ausflugsziel: Nach Jahren in New York und Berlin ist Antje Rávic Strubel in ihre Geburtsstadt Potsdam heimgekehrt. In ihrer heiterkritischen Hommage erzählt sie vom Leben zwischen Lausitz und Stechlin, zwischen Schorfheide, Sanssouci und Spreewald, Havelland und Hohem Fläming.
Von Lüchen und Brüchen, Wölfen und dem „märkischen Amazonas“. Von Brechts, Kleists und Fontanes Spuren sowie dem Einfluss holländischer Architekten. Vom Siegeszug des Sanddorns und dem Mythos des Beelitzer Spargels. Von Luxusvillen am See oder der Frage, wem das Ufer wirklich gehört. Vom Alltag im…
Potsdam - ein ideales Ausflugsziel: Nach Jahren in New York und Berlin ist Antje Rávic Strubel in ihre Geburtsstadt Potsdam heimgekehrt. In ihrer heiterkritischen Hommage erzählt sie vom Leben zwischen Lausitz und Stechlin, zwischen Schorfheide, Sanssouci und Spreewald, Havelland und Hohem Fläming.
Von Lüchen und Brüchen, Wölfen und dem „märkischen Amazonas“. Von Brechts, Kleists und Fontanes Spuren sowie dem Einfluss holländischer Architekten. Vom Siegeszug des Sanddorns und dem Mythos des Beelitzer Spargels. Von Luxusvillen am See oder der Frage, wem das Ufer wirklich gehört. Vom Alltag im Künstlerviertel Babelsberg. Von tropischen Inseln und anderen Spaßbädern. Von landestypischem Humor, der Bedeutung der Kreissäge und den Vorzügen brandenburgischer Wortkargheit.
Über Antje Rávik Strubel
Aus „Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg“
Preußen und Märker
Märkische Heide, märkischer Sand
Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland.
Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,
Hoch über dunkle Kiefernwälder, Heil dir mein Brandenburger Land.
(Lied vom Roten Adler, 1923, Gustav Büchsenschütz)
Machen Sie sich keine Illusionen: Ich bin kein Fan von Brandenburg. – Ich wurde hier geboren. Ich lebe hier. Das ist alles. Von meiner Geburt bis zu meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich vom Land Brandenburg noch nicht einmal gehört, obwohl ich in der Automobilwerkerstadt Ludwigsfelde am Rand des [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Mit wunderbarem Humor lädt Antje Rávic Strubel, die als Romanautorin deutschlandweit bekannt ist, ein, den Landstrich zwischen Elbe und Oder zu erkunden. (…) Es ist eine Art Brandenburg- Kompendium, das selbst eingeborene Brandenburger, die ihr Bundesland bestens zu kennen glauben, an dieser oder jener Stelle verblüfft.“
Märkische Allgemeine„Strubels literarischer Reiseführer über Brandenburg ist eine wunderbare, ironische Liebeserklärung an das 'Hamwanich'-Land zwischen Prenzlau und Finsterwalde, Rathenow und Frankfurt an der Oder.“
Emma„Sie weiß wovon sie spricht. Strubel kann herrlich respektlos sein und sie kann seelenvoll schwelgen.“
Die Welt„...humorvoll und kurzweilig.“
Potsdamer Neueste NachrichtenInhalt
Preußen und Märker
Wege und Wasser
Gärtner und Schweiger
Militär und Natur
Großer Stolz und kleine Städte
Der ewige Vorposten
Ran an die Buletten!
Bebauter Raum
Leeres Land
Künstler und Autodidakten
Harte Gegenwart und weiche Eier
Ohne Sorge !
Schlösser und Frauen
Sauna und Tropen
Lausitzer Karnickelsand
Kartoffel, Hering und Gurke
Glossar Brandenburgisch-Deutsch
Nachlese

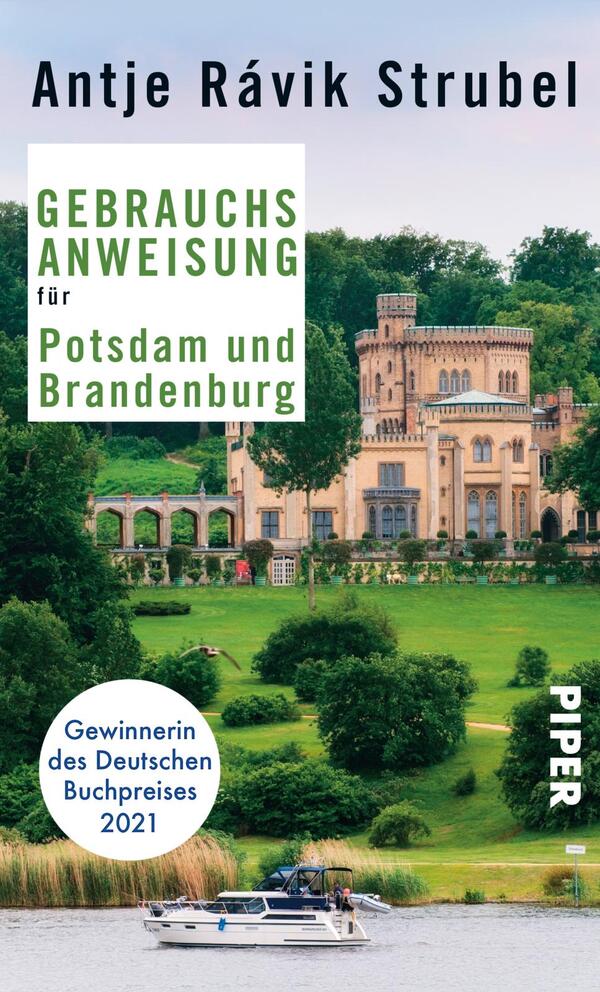
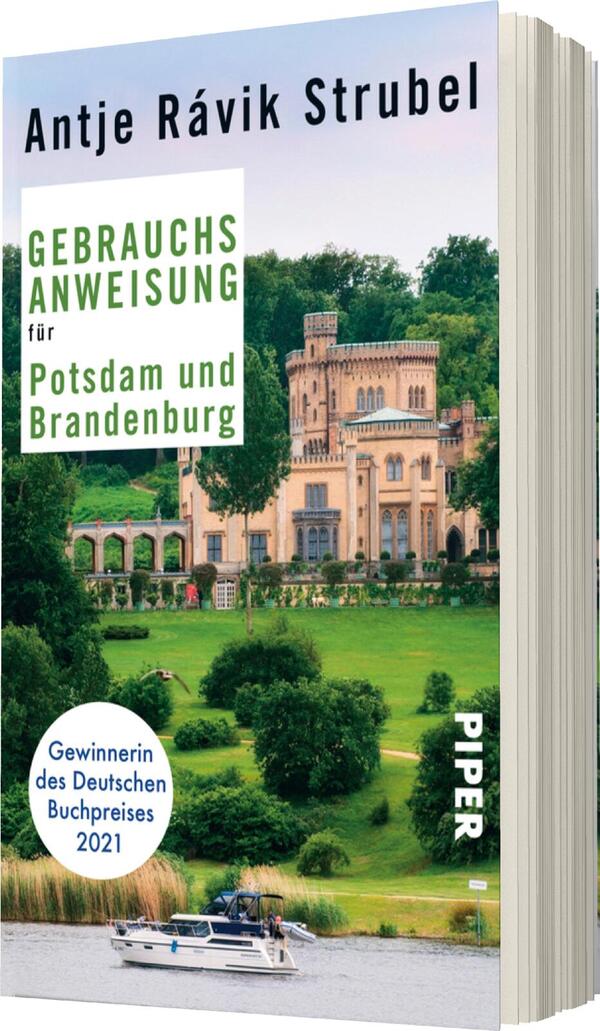
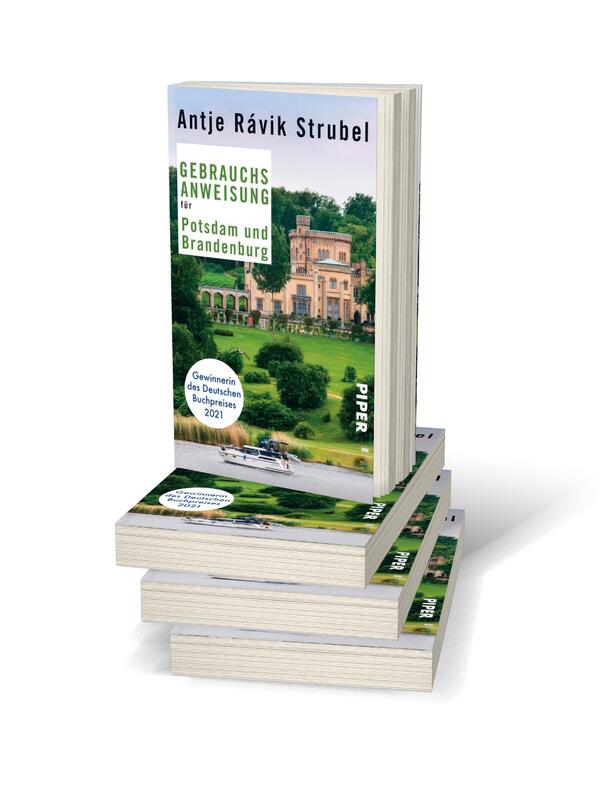
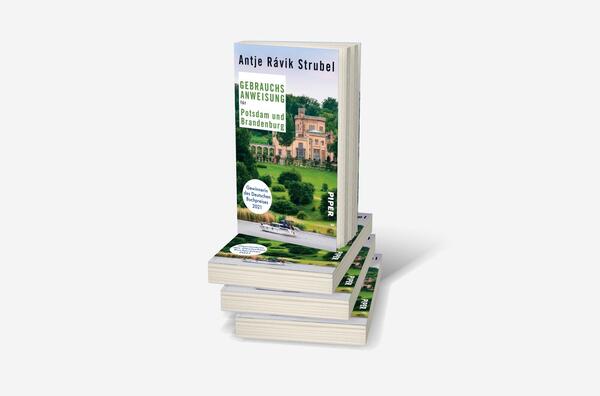




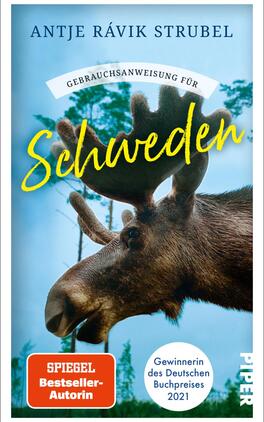

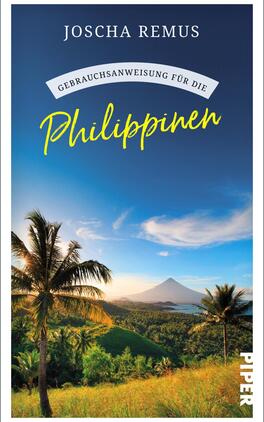

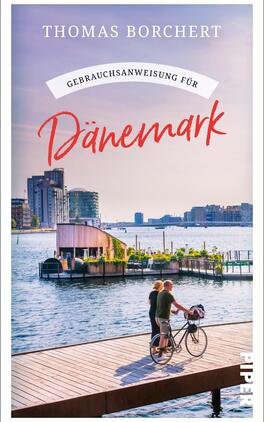
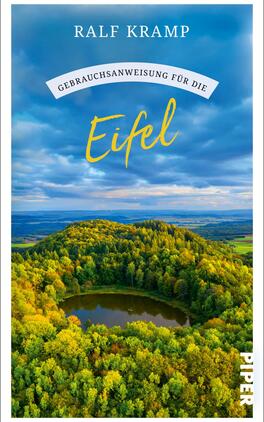
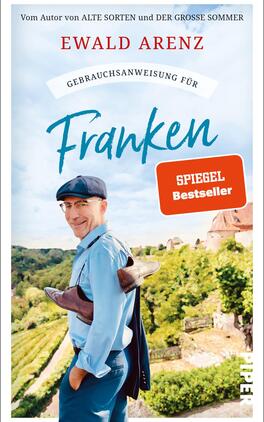
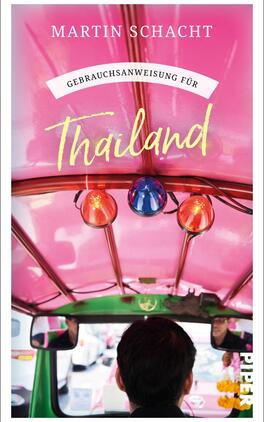
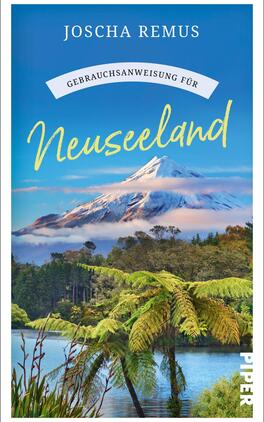
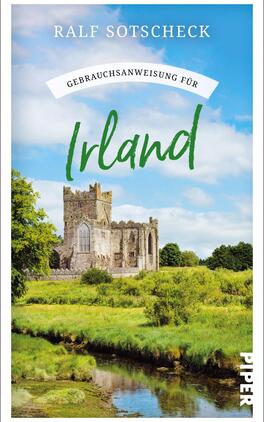
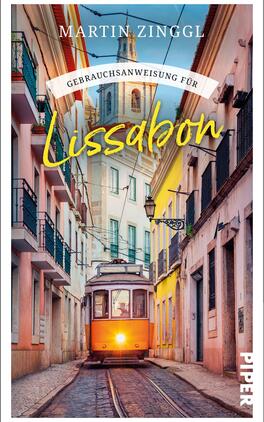
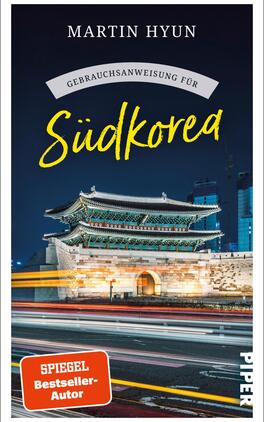



Bewertungen
Vielen Dank für den Beitrag!