
Die Stadt der Symbionten - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„›Die Stadt der Symbionten‹ ist eine hochspannende Sci-Fi-Geschichte, mit ungewöhnlicher Kulisse und bestens gezeichneten Figuren.“
agm-magazin.deBeschreibung
Nach einer Alien-Invasion ist die Erde verseucht. Der letzte Rest der Menschheit lebt in einer ›Oase im Winter‹: in Jaskandris, einer von Künstlichen Intelligenzen gesteuerten Kuppelstadt in der Antarktis. Als Symbiont, ein durch Computerinterfaces erweiterter Mensch, kann Gamil Dellbridge mit den Maschinen der Stadt per Gedanken kommunizieren. Eines Tages fängt er über seine Interfaces ein Flüstern auf, das sich unter die Signale der Stadt mischt. Voller Neugier folgt er dem mysteriösen Ruf und ahnt nicht, dass ihn die Spur geradewegs zu einem Geheimnis führt, das nicht nur sein Leben in…
Nach einer Alien-Invasion ist die Erde verseucht. Der letzte Rest der Menschheit lebt in einer ›Oase im Winter‹: in Jaskandris, einer von Künstlichen Intelligenzen gesteuerten Kuppelstadt in der Antarktis. Als Symbiont, ein durch Computerinterfaces erweiterter Mensch, kann Gamil Dellbridge mit den Maschinen der Stadt per Gedanken kommunizieren. Eines Tages fängt er über seine Interfaces ein Flüstern auf, das sich unter die Signale der Stadt mischt. Voller Neugier folgt er dem mysteriösen Ruf und ahnt nicht, dass ihn die Spur geradewegs zu einem Geheimnis führt, das nicht nur sein Leben in Gefahr bringt, sondern auch alles, woran er glaubt, mit einem Mal infrage stellt.
Über James A. Sullivan
Aus „Die Stadt der Symbionten“
Prolog
PAREIDOLIA
Kaum hatte Yarden die Anweisung in Gedanken formuliert, spürte er, wie der Befehl durch das Interface in seinem Hinterkopf strömte und dabei alle Durchgangssignale auslöste, dann nach außen drang und ins Steuersystem hineinstrahlte. Das Raumschiff schaltete den Antigrav-Antrieb ein, und sanft wie bei den letzten Testläufen hob die Pareidolia mit ihm und der Crew vom Dach seiner Fakultät ab. Noch schwebte das Schiff langsam; noch konnte es von all jenen mit eigenen Augen betrachtet werden, die dort unten die Straßen und Plätze füllten, um diesen [...]












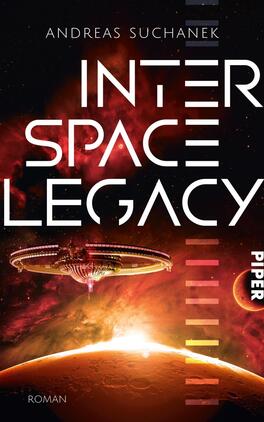


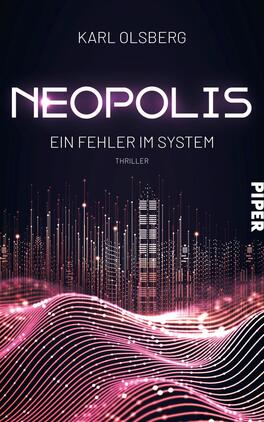



Die erste Bewertung schreiben