
Die Erfindung der Sehnsucht - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein stimmungsvoller und nachdenklich machender Entwicklungs-Roman (…) Ein wunderbares Buch.“
... GESUNDHEIT!Beschreibung
Einfühlsam und inspirierend: eine Hommage an Sehnsucht, Freundschaft und die Aussöhnungmit der Vergangenheit
Einst gefeiert als Stimme einer neuen Generation, lebt die Schriftstellerin Lilli Jansen heute zurückgezogen in ihrer Hamburger Villa – und findet keine Worte für ihren letzten Roman. Bis ein Lied der Kapverdischen Inseln, das von Sehnsucht und Heimat erzählt, sie auf das tropische São Vicente führt.
Lillis Suche nach Inspiration scheint vergeblich, doch dann lässt eine unerwartete Freundschaft sie ihr Leben mit neuen Augen betrachten. Durch seine Neugier und seinen kindlichen…
Einfühlsam und inspirierend: eine Hommage an Sehnsucht, Freundschaft und die Aussöhnungmit der Vergangenheit
Einst gefeiert als Stimme einer neuen Generation, lebt die Schriftstellerin Lilli Jansen heute zurückgezogen in ihrer Hamburger Villa – und findet keine Worte für ihren letzten Roman. Bis ein Lied der Kapverdischen Inseln, das von Sehnsucht und Heimat erzählt, sie auf das tropische São Vicente führt.
Lillis Suche nach Inspiration scheint vergeblich, doch dann lässt eine unerwartete Freundschaft sie ihr Leben mit neuen Augen betrachten. Durch seine Neugier und seinen kindlichen Optimismus gewinnt der junge Luís das Herz der sonst so verschlossenen Lilli. Und während er ihr seine Welt zeigt, findet sie den Mut, ihre eigene Geschichte zu erzählen.
Eine Geschichte verdrängter Kindheitserinnerungen, die sie zurückführt in die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs auf Helgoland, dem roten Felsen in der Nordsee.
Bewegend und wunderschön erzählt, erinnert „Die Erfindung der Sehnsucht“ von Tom Diesbrock mit seiner unerschütterlichen Heldin an die Frauenfiguren von Isabel Allende und Elena Ferrante.
„Sensibel, philosophisch – unwiederstehlich!“ Iserlohner Kreisanzeiger über „Ein Vogel namens Schopenhauer“
„Klug!“ tv Hören und Sehen
Der große neue Roman vom Autor von »Ein Vogel namens Schopenhauer»
Über Tom Diesbrock
Aus „Die Erfindung der Sehnsucht“
Prolog
Mindelo, São Vicente
Hat sie die Nordsee jemals so regungslos erlebt? Lilli steht am Ende der Landungsbrücke und lässt ihren Blick über das spiegelglatte Meer gleiten. Es ist unheimlich. Die Wasserfläche ohne eine einzige Welle bis zum Horizont, der schwer auszumachen ist zwischen der dunkelgrauen See und dem kaum helleren Himmel.
Drei schneeweiße Bäderschiffe liegen vor der Insel auf Reede, eines davon erkennt Lilli sofort als die KAISER. Allerdings scheint niemand an Bord zu sein. Überhaupt ist nirgendwo ein Mensch zu sehen, fällt ihr nun auf, auch nicht auf [...]




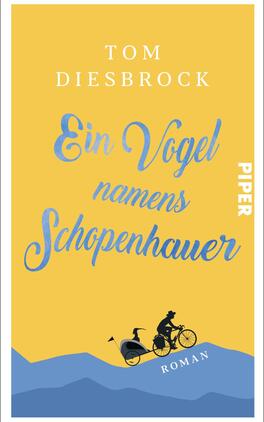
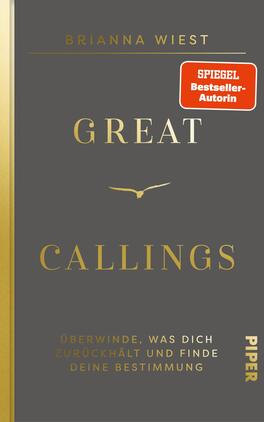
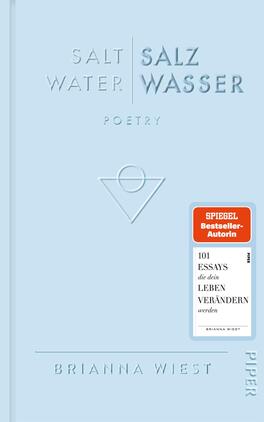

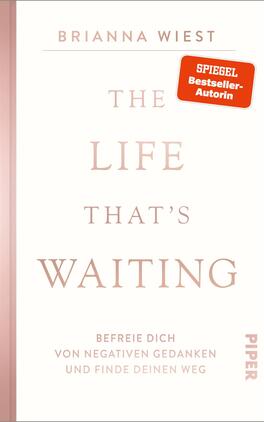
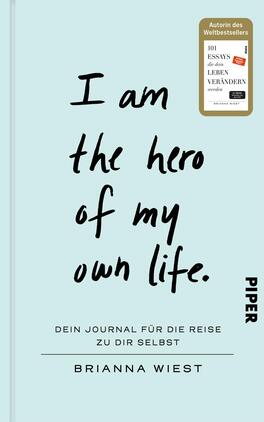
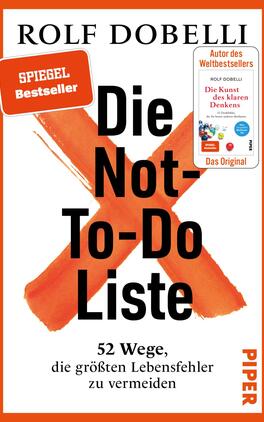

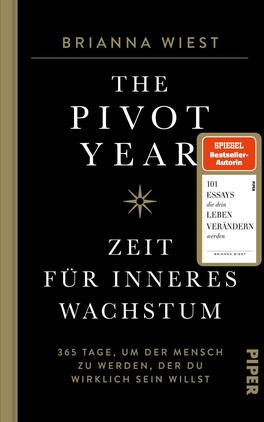
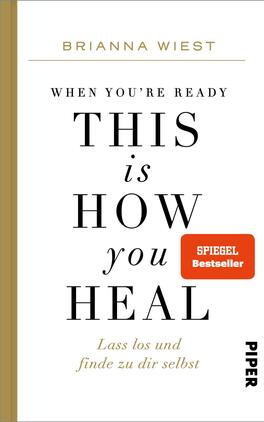
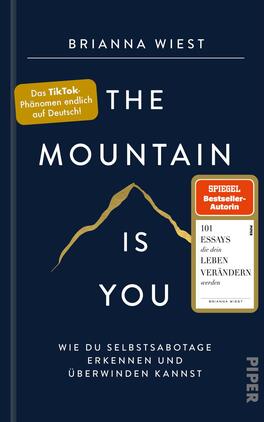


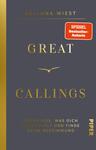

Die erste Bewertung schreiben