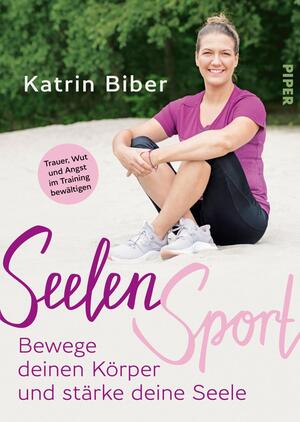Bücher über Tod und Trauer
Sterben, Tod und Trauer sind unumgänglich, für jeden von uns. Und doch wissen wir kaum etwas darüber. Was passiert mit unserem Körper, wenn du stirbst? Was geschieht mit unserem Leichnam, bis man bestattet wird? Wie gehen andere Kulturen mit Verstorbenen um? Wie können wir uns spirituell und emotional auf den Tod und auf Trauer vorbereiten? Unsere Autoren beantworten die wichtigsten Fragen zum Umgang mit dem Tod und zeigen Wege zur Trauerbewältigung auf.
Was passiert, wenn wir sterben?
Über das Leben und über das Leben danach
Über ein menschenwürdiges Ende des Lebens
Wie kann man die Angst vor dem Tod besiegen?
Das Geschäft mit dem Lebensende


23. August 2023
Schicksalromane
Bewegende Romane aber auch Mut-Mach-Geschichten über Menschen, die in ihrem Leben etwas verloren haben. Es sind berührende Bücher über Krankheit und Verlust... und die Kraft von Freundschaft.