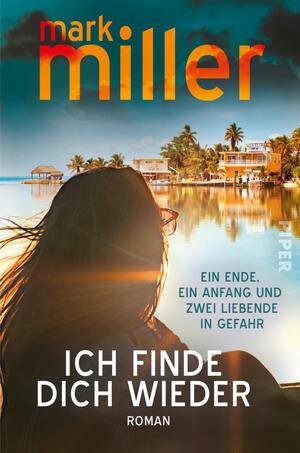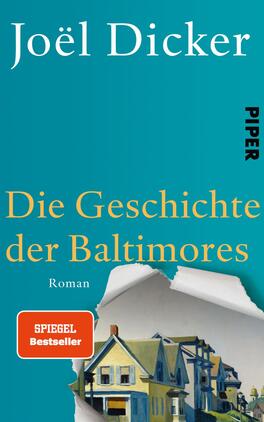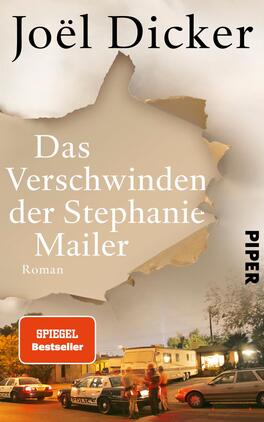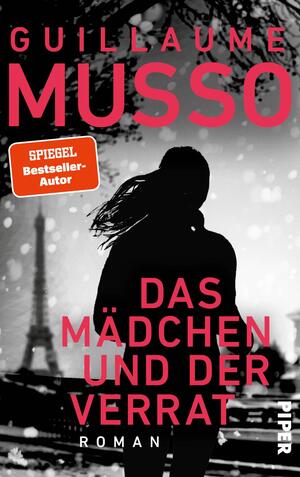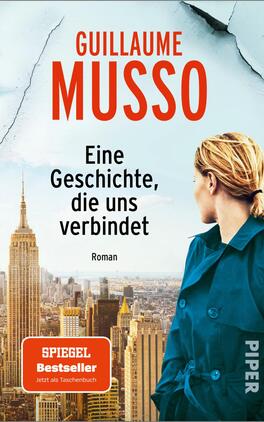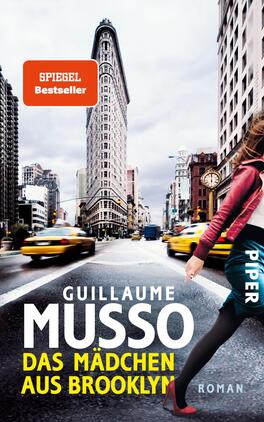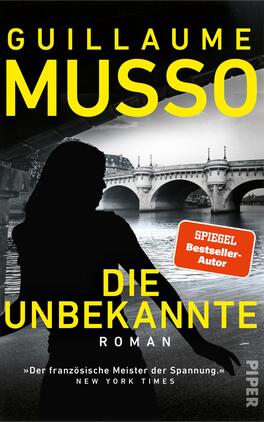Ein schrecklicher Unfall. Eine anonyme Botschaft. Eine neue Hoffnung – oder tödliche Gefahr?
„Atemberaubend und geheimnisvoll.“
„Exzellent gemachte Spannungsliteratur, ein Pageturner à l'américaine.“ Der Freitag
„Ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen mag.“ Hamburger Morgenpost
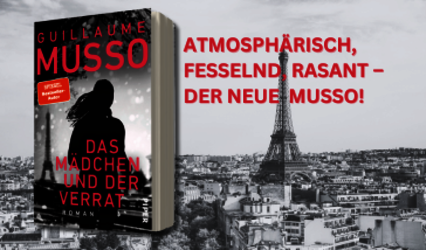
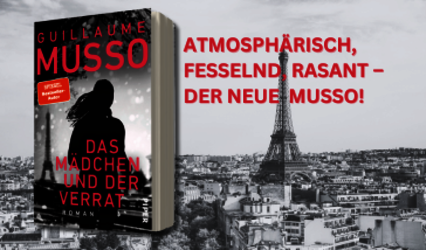
31. Juli 2022
Atmosphärisch, fesselnd, rasant – der neue Musso!
Die Romane des erfolgreichen französischen Autors Guillaume Musso sind internationale Bestseller - Entdecken Sie jetzt den neuen packende Roman vom Bestsellerautor!


18. Oktober 2022
„Seine Romane machen süchtig." Style
Meisterhaft konstruiert, komplexe Charaktere, eine spannende Handlung mit überraschenden Wendungen - auch der neue Roman von Joël Dicker ist ein absoluter Pageturner.