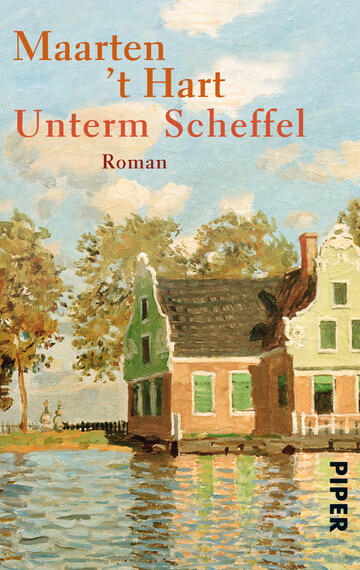
Unterm Scheffel
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Wie immer sprachlich virtuos, hochsensibel, offenbar aus dem Fundus schier unendlicher Lebenserfahrung schöpfend“
business lounge WOMANBeschreibung
Wie ein Blitz schlägt die Liebe bei Alexander Goudeveyl ein. Und als die junge Frau sein Haus betritt, lässt er jeden ehelichen Vorsatz fallen, um sie zu besitzen. Doch bald schon kühlt ihre Leidenschaft ab, und seine Leidenschaft schlägt in Verzweiflung um. Maarten 't Hart erkundet die Untiefen der Liebe, die Ungerechtigkeit unserer Gefühle und den donquichottischen Kampf, den wir um sie zuführen bereit sind.
Medien zu „Unterm Scheffel“
Über Maarten 't Hart
Aus „Unterm Scheffel“
1
September. Hester und ich traten beim Voorhoutfestival auf. Nach unserem letzten Stück sagte sie: „Ich kann dich nicht nach Hause bringen, ich muss noch weiter nach Schiedam.“
„Das macht nichts“, sagte ich, „es fahren Straßenbahnen, Züge und Busse.“
„Doch, das macht was“, sagte sie, „das Mindeste, was ich für dich tun kann, ist, dich wieder nach Hause zu bringen, du trittst mit mir auf, damit ich mir etwas dazuverdienen kann. Du selbst brauchst das Geld überhaupt nicht.“
„Nebenverdienste brauche ich nicht, aber deine Gesellschaft ist unbezahlbar“, sagte ich.
»Ja, [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„… prall gefüllt mit skurrilen Szenen, witzigen Aperçus und heiteren Anspielungen.“
Westfälische Rundschau„Die Klänge und Geräusche, über die der Komponist die Welt vor allem erfährt, tragen den Text atmosphärisch, die Motive entwickeln sich fast unmerklich, der Rhythmus stimmt immer, der Roman scheint aus der Musik herauszuwachsen.“
Süddeutsche Zeitung„Er gehört zu den ganz Großen der europäischen Gegenwartsliteratur.“
Rheinischer Merkur„Es ist die große Leistung Maarten't Harts, die Symptome dieser Liebeskrankheit mit solch emotionaler Vehemenz zu schildern, dass es einen bei der Lektüre in einen Raum der Traurigkeit und Verlorenheit hineinreißt.“
Leipziger Volkszeitung„Ein lesenswerter Roman - besonders für Holland-Liebhaber und Musikfans.“
Kirchenzeitung„Was für ein Geschenk, dieses Buch. Es pack, es unterhält mit brillanten Dialogen und köstlichen Gedanken, es tröstet, es ist komisch und traurig, es ist so, wie Literatur sein sollte, das bisschen mehr eben als das ganze elende Leben.“
Die Welt»Nun ist solches Liebeslied schon so oft beschrieben worden, dass es schon der besonderen Schreibkunst Maarten t´ Harts bedarf, um es noch einmal lesenswert und nachvollziehbar zu machen. Das gelingt ihm dank seiner feinen Ironie und seinem Gespür für komische Situationen.«
Deutschlandradio Kultur„Wie immer sprachlich virtuos, hochsensibel, offenbar aus dem Fundus schier unendlicher Lebenserfahrung schöpfend“
business lounge WOMAN






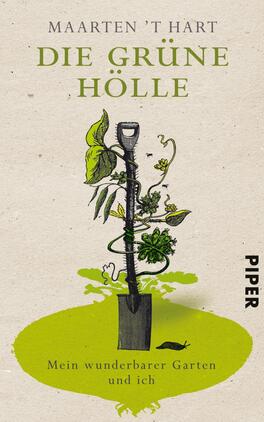






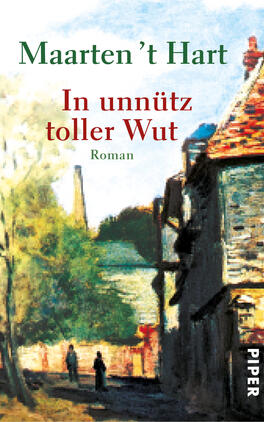





Die erste Bewertung schreiben