
Seefahrt mit Huhn - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Humorvoll und kurzweilig: Abenteuerbericht einer Weltumseglung mit gefiedertem Freund.
Alleine reisen und nie einsam sein: Der junge Guirec besegelt die Weltmeere. Seine einzige Begleitung: das fidele Huhn Monique.
Für Fans von „Ein Mann, ein Boot“ und „EinHundSegeln“.
Reisen mit Tieren sind selten, und noch seltener sind sie so witzig und unterhaltsam erzählt wie „Seefahrt mit Huhn“ von Guirec Soudée. Der junge Franzose ist zwar auf einer Insel geboren und auf dem Surfbrett zu Hause, doch vom Segeln hat er keine Ahnung. Soudée lässt sich davon nicht aufhalten, sondern schnappt sich ein Huhn…
Humorvoll und kurzweilig: Abenteuerbericht einer Weltumseglung mit gefiedertem Freund.
Alleine reisen und nie einsam sein: Der junge Guirec besegelt die Weltmeere. Seine einzige Begleitung: das fidele Huhn Monique.
Für Fans von „Ein Mann, ein Boot“ und „EinHundSegeln“.
Reisen mit Tieren sind selten, und noch seltener sind sie so witzig und unterhaltsam erzählt wie „Seefahrt mit Huhn“ von Guirec Soudée. Der junge Franzose ist zwar auf einer Insel geboren und auf dem Surfbrett zu Hause, doch vom Segeln hat er keine Ahnung. Soudée lässt sich davon nicht aufhalten, sondern schnappt sich ein Huhn und ein dreißig Jahre altes Segelboot und legt ab zu seinem größten Abenteuer: 45.000 Seemeilen in 5 Jahren.
Legt eine Henne noch ein Ei, wenn sie von der Karibik nach Grönland kommt? Wie ernährt sich ein Huhn an Deck? Und wie kann ein Segler sein Leben retten, wenn ihm das Boot auf hoher See voll Wasser läuft? All das lernt der Leser gemeinsam mit Soudée. Der junge Franzose meistert alle Herausforderungen gekonnt.
Informativ und spritzig geschriebener Reisebericht
Soudée ist ein bemerkenswerter Lebenskünstler, von dem man meinen könnte, dass er von Kopf bis Fuß aus Abenteuerlust besteht. Sein Reisebericht ist ein Geschenk für alle, die sich das große Abenteuer selber nicht zutrauen und lieber von zu Hause aus dabei sind. Guirec Soudée beschreibt seine Reise so unterhaltsam, dass der Leser fast selbst zum Bordhuhn wird und beobachtet, was der junge Franzose erlebt.
Reisebeschreibung der besonderen Art
Ein junger Mann und eine Henne: Diese ungewöhnliche Freundschaft macht „Seefahrt mit Huhn“ zu etwas Besonderem. Denn eine Atlantiküberquerung ohne Henne Monique könnte sich wohl auch Soudée nicht vorstellen. Alleine zu reisen, macht weise? Vielleicht wäre Soudée auch ohne Monique eine so reflektierte Reisebeschreibung gelungen. Aber wahrscheinlich wäre sie ein bisschen weniger herzerwärmend.
„Prädikat: tierisch schön!“ Segelreporter
Über Guirec Soudée
Aus „Seefahrt mit Huhn“
Pass auf, Monique. Wir sind hier. Vancouver Island heißt das. Wunderschön, oder? Und ganz oben auf der Karte? Das ist Grönland! Die Diskobucht, was hatten wir zwei dort für einen Spaß … Da haben wir uns zwar … die Federn abgefroren, sind aber ein paarmal trotzdem mächtig ins Schwitzen geraten! Weißt du noch? Und jetzt, Momo, folge meinem Finger. So. Siehst du hier die große blaue Fläche? Das ist der Pazifik. Und die vielen Punkte darin? Das sind Inseln. Jetzt sei doch nicht so hibbelig, Momo, hör mir zu. Also, das ist Polynesien. Wo man diese Blumenketten macht und [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wie alles Begann
Teil 1
Unsere Atlantiküberquerung
Teil 2
Gefangen im Eis. Ein Winter am Polarkreis
Teil 3
Die Nordwestpassage
Teil 4
Von Alaska nach Kanada
Teil 5
Auf nach Süden
Teil 6
Der lange Weg zurück
Partner
Dank









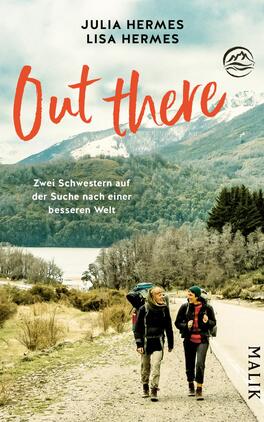

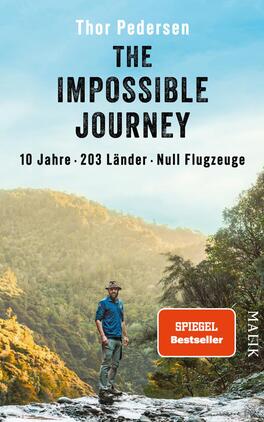

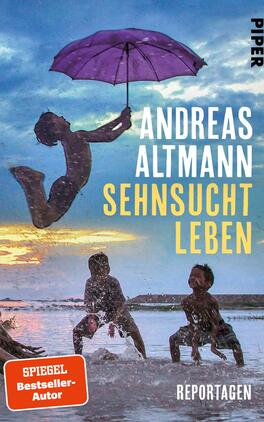
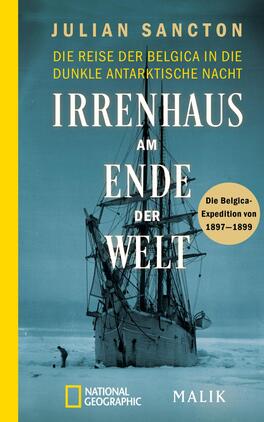




Die erste Bewertung schreiben