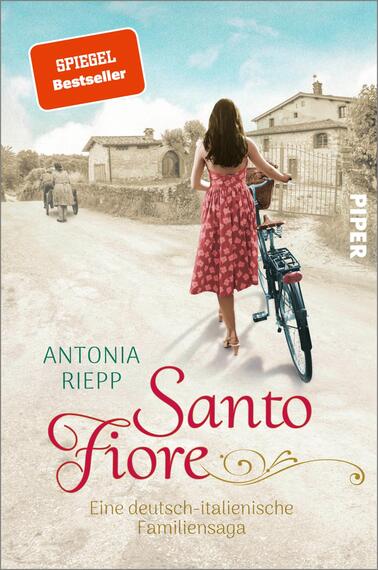
Santo Fiore (Die Belmonte-Reihe 3) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Ein verwilderter Garten, ein alter Gutshof und die Suche nach der eigenen Geschichte ...
Da ihre Gärtnerei im Allgäu kaum Gewinn abwirft, wagt Simona den Neuanfang bei ihrer Familie in den italienischen Marken. In Belmonte will die junge Landschaftsgärtnerin einen verwilderten Klostergarten wiederaufleben lassen und ihr Herzklopfen für Gutshofbesitzer Adriano ergründen. Doch dann erfährt sie von der Mailänderin Carla, die ein Zimmer bei ihm bezogen hat ...
Für Carla gleicht der Besuch des Gutshofs ihrer Kindheit einer Reise in die Vergangenheit: Jeder Winkel des herrschaftlichen Gebäudes ist…
Ein verwilderter Garten, ein alter Gutshof und die Suche nach der eigenen Geschichte ...
Da ihre Gärtnerei im Allgäu kaum Gewinn abwirft, wagt Simona den Neuanfang bei ihrer Familie in den italienischen Marken. In Belmonte will die junge Landschaftsgärtnerin einen verwilderten Klostergarten wiederaufleben lassen und ihr Herzklopfen für Gutshofbesitzer Adriano ergründen. Doch dann erfährt sie von der Mailänderin Carla, die ein Zimmer bei ihm bezogen hat ...
Für Carla gleicht der Besuch des Gutshofs ihrer Kindheit einer Reise in die Vergangenheit: Jeder Winkel des herrschaftlichen Gebäudes ist ihr vertraut, und Erinnerungen an ihre Mutter werden lebendig. Aber in der Vergangenheit lauert Dunkles. Und die Gerüchteküche im Dorf brodelt: Was führt die Tochter eines Mörders zurück nach Belmonte?
„Santo Fiore“ ist wie eine Reise ans Mittelmeer und zu sich selbst. In ihrem neuen Roman erzählt SPIEGEL-Bestsellerautorin Antonia Riepp („Belmonte“, „Villa Fortuna“) eine ebenso dramatische wie bewegende Familiengeschichte zwischen Deutschland und Italien.
Von Liebe und Verlust, Geheimnis und Verrat, Familie und Versöhnung. Der malerische Ort „Belmonte“ wird in „Santio Fiore“ erneut zum Schauplatz einer emotionalen Saga.
„Die Autorin ist eine wunderbare Erzählerin.“ Sempacher Woche
„Die Autorin trifft souverän den Ton ihrer vielschichtigen Figuren.“ Allgäuer Zeitung
Weitere Titel der Serie „Die Belmonte-Reihe“
Über Antonia Riepp
Aus „Santo Fiore (Die Belmonte-Reihe 3)“
Kapitel 1 Verwandtschaften
Belmonte, Gegenwart
Raschelnd fuhr die Sense ins Gestrüpp. Es war das einzige Geräusch, das die Sonntagnachmittagsstarre durchbrach, deshalb kam es Adriano übermäßig laut vor. Die sonst allgegenwärtigen Laute der campagna waren zum Erliegen gekommen. Es jaulte keine Motorsäge, kein Trecker fuhr, kein Huhn gackerte, sogar die Zikaden schwiegen, und noch nicht einmal ein Moped knatterte durch das Tal. Einzig auf den Uhrturm von Belmonte war Verlass. Gerade schlug die Glocke vier Uhr, um danach erneut eine lähmende Stille zu hinterlassen. Es [...]



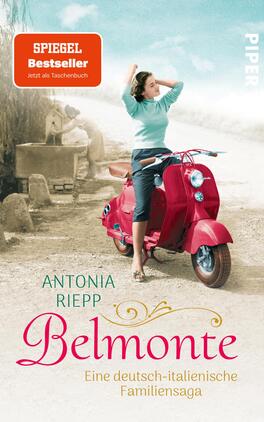
















Die erste Bewertung schreiben