
Run – Sie jagen dich (John-Milton-Reihe)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein unglaubliches Erlebnis mit tollen Charakteren und einer Atmosphäre die unter die Haut geht.“
diebuchblogger.wordpress.comBeschreibung
Im Kampf um Recht und Gerechtigkeit setzt er alles aufs Spiel …
Hurrikan Katrina wütet über New Orleans. Ex-Geheimagent John Milton findet gerade noch Unterschlupf bei einer Familie, bevor die Naturkatastrophe über ihn hinwegrast. Als er erfährt, dass die Familie bedroht wird, zögert er keine Sekunde und bietet seinen Schutz an. Doch die Ermittlungen führen ihn in ein Netz aus Intrigen und Korruption – und zu einem alten Bekannten, der auf Auftragsmorde spezialisiert ist.
Weitere Titel der Serie „John-Milton-Reihe“
Über Mark Dawson
Aus „Run – Sie jagen dich (John-Milton-Reihe)“
John Milton spähte angestrengt durch den Regen, der auf die Windschutzscheibe prasselte, und versuchte, die schlimmsten Schlaglöcher auf der schlammigen Straße zu umfahren. Inzwischen war er seit sechs Stunden unterwegs; anfangs hatte er im dichten Verkehr festgesteckt – endlose Fahrzeugkolonnen mit Leuten, die wie er aus der Stadt flüchteten –, dann war er wegen der schlechten Straßen, der eingeschränkten Sicht und der Tatsache, dass er sich in der Gegend nicht auskannte, nicht vorwärtsgekommen. Er fuhr an einer Weggabelung vorbei, bremste und parkte am [...]














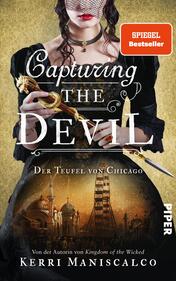
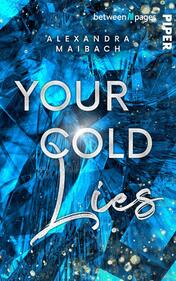

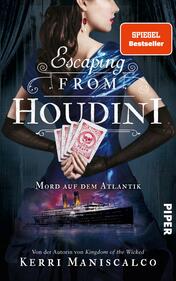



Die erste Bewertung schreiben