Produktbilder zum Buch
Hättest du geschwiegen (Hannover-Krimis 9)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Dein Wort bringt den Tod
Die Leiche des bekannten Journalisten Boris Markstein, mit dem Kommissar Völxens Dezernat schon häufig zusammengearbeitet hat, wird auf einem rostigen Industriegleis in Hannover-Linden entdeckt. Die Liste der Verdächtigen ist lang: Markstein hatte brisante Kontakte und seine Nase in allen möglichen sensiblen Bereichen – vom Drogenhandel über die Rotlichtszene bis zu russischen Banden. Völxens Team tut alles, um schnellstmöglich Licht ins Dunkel zu bringen, doch das ist dieses Mal alles andere als leicht: Völxen erhält Drohungen von der Mafia, und das LKA behindert die…
Dein Wort bringt den Tod
Die Leiche des bekannten Journalisten Boris Markstein, mit dem Kommissar Völxens Dezernat schon häufig zusammengearbeitet hat, wird auf einem rostigen Industriegleis in Hannover-Linden entdeckt. Die Liste der Verdächtigen ist lang: Markstein hatte brisante Kontakte und seine Nase in allen möglichen sensiblen Bereichen – vom Drogenhandel über die Rotlichtszene bis zu russischen Banden. Völxens Team tut alles, um schnellstmöglich Licht ins Dunkel zu bringen, doch das ist dieses Mal alles andere als leicht: Völxen erhält Drohungen von der Mafia, und das LKA behindert die Ermittlungen. Schnell wird klar: In diesem Fall ist nichts, wie es scheint …
Der neue Hannover-Krimi von SPIEGEL-Bestsellerautorin Susanne Mischke. „Hättest du geschwiegen“ ist Kommissar Völxens brisantester Fall.
„Gekonnt setzt Susanne Mischke Schauplätze in und um Hannover in Szene. Auch aktuelle Themen verwebt sie elegant mit ihrem fiktiven Stoff.“ NDR 1 Kulturspiegel
Weitere Titel der Serie „Hannover-Krimis“
Über Susanne Mischke
Aus „Hättest du geschwiegen (Hannover-Krimis 9)“
I.
Hauptkommissar Völxen atmet schwer hinter seinem Mundschutz.
Es ist schon ein Weilchen her, dass er bei einer Obduktion dabei war, so etwas delegiert man für gewöhnlich gern an andere, aber dieses Mal gab es kein Entkommen.
Durchhalten! Bloß keine Schwäche zeigen vor versammelter Mannschaft!
Die Luft im Raum ist aber auch wirklich zum Schneiden. Der Hauptgrund dafür mag sicherlich der Leichnam sein, der mit geöffnetem Brustkorb auf dem Seziertisch liegt. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Sektionssaal von Dr. Bächle, dem Leiter der Rechtsmedizinischen [...]











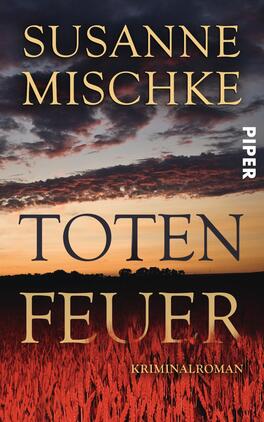
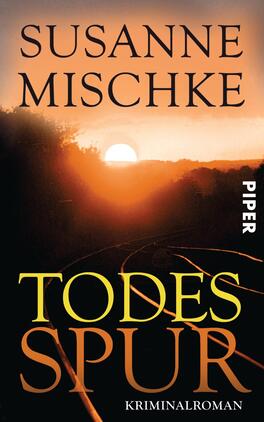



















Die erste Bewertung schreiben