
Gebrauchsanweisung für Zürich
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Milena Moser schreibt eine Liebeserklärung voll Witz und Widersprüche. Mit leichter Hand streut sie die Fakten ein. Andere Metropolen dürfen Zürich um eine solche Stadtführerin beneiden.“
Sächsische ZeitungBeschreibung
Marmorwaschbecken in öffentlichen Toiletten, Designerstühle im Postamt und blitzsaubere Trambahnwagen: Zürich ist eine Klasse für sich. Milena Moser, die in der Nähe des Bahnhofs Tiefenbrunnen aufwuchs und mehr als drei Jahrzehnte in Zürich lebte, stellt sich den typischen Klischees: dem Geld und dem Gold, den absurd hohen Preisen und den Steuerflüchtlingen. Sie spaziert durch die Altstadt und zum Zürichsee. Besucht Außenbezirke, die heute angesagt sind, und Lokale mit karierten Tischdecken, die früher als bünzelig galten, plötzlich aber sehr in sind. Erlebt Romantik und Hipster-WGs im Umkreis…
Marmorwaschbecken in öffentlichen Toiletten, Designerstühle im Postamt und blitzsaubere Trambahnwagen: Zürich ist eine Klasse für sich. Milena Moser, die in der Nähe des Bahnhofs Tiefenbrunnen aufwuchs und mehr als drei Jahrzehnte in Zürich lebte, stellt sich den typischen Klischees: dem Geld und dem Gold, den absurd hohen Preisen und den Steuerflüchtlingen. Sie spaziert durch die Altstadt und zum Zürichsee. Besucht Außenbezirke, die heute angesagt sind, und Lokale mit karierten Tischdecken, die früher als bünzelig galten, plötzlich aber sehr in sind. Erlebt Romantik und Hipster-WGs im Umkreis der Langstraße und bewegt sich auf den Spuren bekannter Krimihelden ebenso wie auf denen großer Psychoanalytiker.
Über Milena Moser
Aus „Gebrauchsanweisung für Zürich“
Nicht cool genug für diese Stadt
Zürich. Die Stadt, in der ich so lange gelebt habe, dass ich sie wie eine alte Verwandte behandle. Sie ist mir nah und fremd zugleich. Sagen wir, sie ist meine Tante – Tante Turica. Eine angeheiratete Tante, eine, die immer eine gewisse Distanz wahrt, die ihre Geheimnisse hütet. Bei ihr weiss ich nie so recht, woran ich bin. Sie zeigt mir nie, wie sehr sie mich mag, und ist doch immer für mich da. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, habe ich den Eindruck, ich müsse erst einmal eine Prüfung bestehen. Ihr Blick wandert von meinen Füssen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Locker, amüsant und ausgesprochen kenntnisreich.“
Nürnberger Zeitung„Milena Moser nimmt uns an der Hand und führt uns in ihrer ›Gebrauchsanweisung für Zürich‹ durch Altstadt und Niederdorf, entlang der Langstraße und durch den Chreis Cheib. Und das auf humorvolle Art.“
Faces (CH)„Liebeserklärung an Zürich“
Blick Reisen„Milena Moser schreibt eine Liebeserklärung voll Witz und Widersprüche. Mit leichter Hand streut sie die Fakten ein. Andere Metropolen dürfen Zürich um eine solche Stadtführerin beneiden.“
Sächsische ZeitungNicht cool genug für diese Stadt ?
Alle Wege führen zum HB
Hinter den achtzehn Geleisen
Warum wir sind, wie wir sind
Also gut, die Bahnhofstrasse
Er will schön
Der See, der See, der See ! ( Und die Flüsse auch … )
Grüezi ? Nein danke !
Die Tüütschen kommen !
Die Schattenseiten des Sommers
Die Bööggin brennt nicht
Tramfahren für Fortgeschrittene
Früh übt sich, wer ein Zürcher werden will
Liebe im Schatten von Zwingli
Sex ? In der Box, bitte !
Wo die wilden Kerle wohnten
Der diskrete Charme des Stadtrands
Zürich ver-rückt
Die Stadt gehört den Bewegten
Mythos Langstrasse
Stadtführung mit Mord und Totschlag
Wo Elefanten baden, lass dich ruhig nieder
In Zürich leben
Literaturverzeichnis





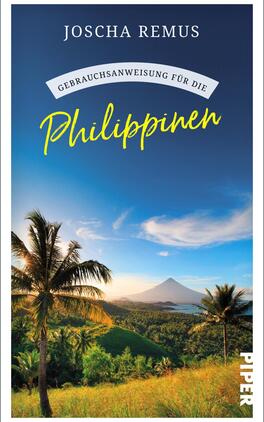

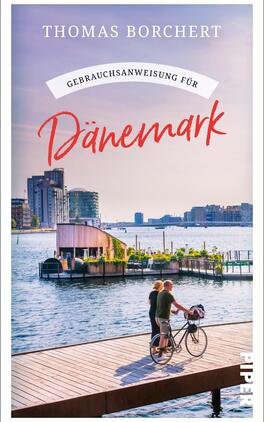
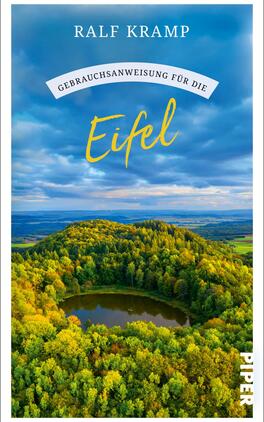
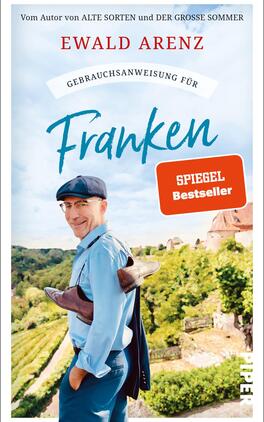
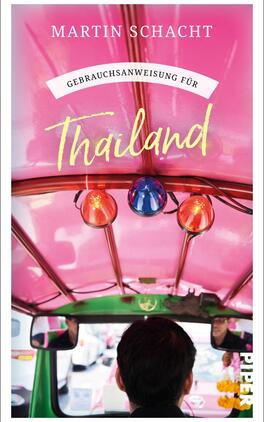
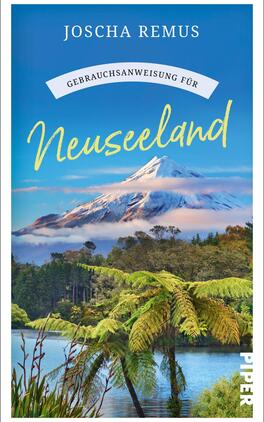
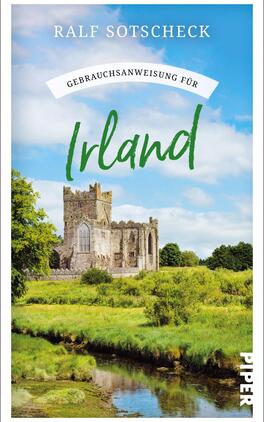
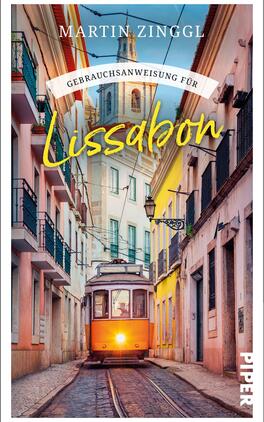
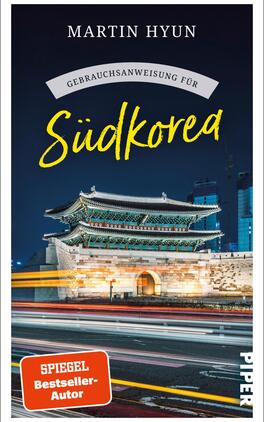
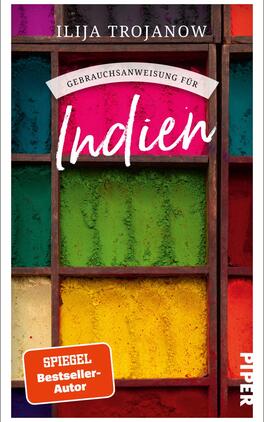
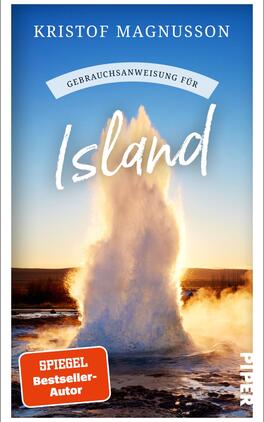



Die erste Bewertung schreiben