Produktbilder zum Buch
Gebrauchsanweisung für Nachbarn
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„eine amüsante Mischung aus Sachbuch und Kurzgeschichten [...]. Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen gelesen“
SternBeschreibung
Jeder hat sie, keiner braucht sie – oder doch?
Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Schrebergarten-Nachbarn. Zimmernachbarn. Nachbarschaftsprojekte. Neue Nachbarn. Laute Nachbarn. Geheimnisvolle Nachbarn. Sitznachbarn. Nachbarschaftsnetzwerke. Friedhofsnachbarn. Weltallnachbarn. Nachbarländer ...
Die beiden befreundeten Autoren Martin Hyun und Wladimir Kaminer erzählen in offener und humorvoller Art und Weise vom Zusammenleben in Nachbarschaftskonstellationen aller Art.
Das Leben verbindet uns auf die seltsamsten Weisen: Ob in einer Wohngemeinschaft oder im Mehrfamilienhaus, auf dem Land oder in…
Jeder hat sie, keiner braucht sie – oder doch?
Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Schrebergarten-Nachbarn. Zimmernachbarn. Nachbarschaftsprojekte. Neue Nachbarn. Laute Nachbarn. Geheimnisvolle Nachbarn. Sitznachbarn. Nachbarschaftsnetzwerke. Friedhofsnachbarn. Weltallnachbarn. Nachbarländer ...
Die beiden befreundeten Autoren Martin Hyun und Wladimir Kaminer erzählen in offener und humorvoller Art und Weise vom Zusammenleben in Nachbarschaftskonstellationen aller Art.
Das Leben verbindet uns auf die seltsamsten Weisen: Ob in einer Wohngemeinschaft oder im Mehrfamilienhaus, auf dem Land oder in der Stadt, am Hotelpool oder im Zug, in der Lounge oder im Theater – die beiden Autoren wissen um die Herausforderung, als Erwachsene mit den Eltern zusammenzuleben. Was man gegen Nachbarn aus der Hölle tun kann. Wem im Flugzeug die Armlehne gehört und wie man am Strand sein Revier gegenüber anderen Sonnenbadenden verteidigt. Weshalb man sich auf dem Dorf gegen ein Heer aus „Unbefugten“ schützt. Und warum man in Metropolen tierische Nachbarn wie freche Füchse oder vermeintliche Löwen im Auge behalten sollte. Aber auch, wofür Nachbarn unentbehrlich sind: für das Gießen der Zimmerpflanzen und fürs Gemeinschaftsgefühl, als Einbruchsicherung oder einfach nur zur nächtlichen Unterhaltung. Denn mal ehrlich, ein Leben ohne Nachbarn kann sehr langweilig und einsam sein.
Ein Thema, das uns mit Sicherheit alle bewegt.
Über Martin Hyun
Über Wladimir Kaminer
Aus „Gebrauchsanweisung für Nachbarn“
Unsere Arche Noah
Wladimir Kaminer
Eines Tages mitten im Sommer wurde ich von Kirchenglocken geweckt. Ich hörte sie nah und deutlich, als würde bei uns im Haus jemand um zehn vor neun laut die Glockenzunge schwingen. Woher kamen die Glocken? Wir haben weit und breit keine Kirche in unserer Straße, die nächste ist die Gethsemanekirche, die Wiege der deutsch-deutschen Revolution, sie hat ein kaputtes Dach, soweit ich weiß, keine Glocken mehr und ist gute zwei Kilometer entfernt. Hatten etwa meine Nachbarn bei sich zu Hause Glocken aufgehängt und schwangen ihren Strang, [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Kurzweilige, charmante Geschichten, die sich erst beim zweiten Lesen als tiefgründig und ziemlich politisch offenbaren.“
ORF "Ö1 Kontext"„Es ist ein wunderbares Buch geworden, sehr lesenswert.“
rbb "Der Tag"„Sehr heiter aufgeschriebenes Buch“
ZDF - Mittagsmagazin„Überall machen sie feinsinnige und unterhaltsame Beobachtungen. Ihre Texte sind immer auch ein wenig hintergründig und regen zum Nachdenken an, denn irgendwo haben wir ja immer einen Nachbarn.“
Westfälische Nachrichten„In ›Gebrauchsanweisung für Nachbarn‹ nehmen Hyun und Kaminer die Leserinnen und Leser mit auf eine humorvolle und zugleich tiefgründige Reise durch die Welt der Nachbarschaften.“
Westdeutsche Zeitung„Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen gelesen. Scham war auch dabei, weil man seine eigenen Macken ganz gut wiedererkennt.“
WDR 2„Heitere Anekdoten über unser Miteinander.“
TV Hören und Sehen„Die beiden Autoren wissen wie man unterhält und beweisen das auch wieder in ihrem neuesten Werk.“
StadtRadio Göttingen „Book's n' Rock's“„Sein analytischer, dabei doch meist liebevoller Blick auf Deutschland und deutsche Marotten ist Kaminers Erfolgsrezept, und mit diesem bringt sich (…) auch Martin Hyun in das Buch (…) ein.“
Rhein-Zeitung„Fesselndes Buch“
Natur & Heilen„eine amüsante Mischung aus Sachbuch und Kurzgeschichten [...]. Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen gelesen“
SternInhalt
Unsere Arche Noah
Fluch der Karibik im Wedding
Nachbarschaft – eine Typologie
Unbefugten Zutritt verboten!
Gute Zimmernachbarn, schlechte Zimmernachbarn
Frauen-WG
Hotel Mama und Papa
Auf gute Sitzplatznachbarschaft
Loungen in der Großstadt
Das Leben der anderen
Vietnamesische Post
Nachbarn aus der Hölle
Under the Bridge
Weltallnachbarn
Unsere Brüder und Schwestern
Eins mit der Natur
Macheten-Oleg
Der Doppelgänger
Herr Schröder, Herr Fuchs und ein Waschbär
Die Beach Towel Brigade und Herr Wahl
Ruhe in Frieden
Am Ende wartet der Tod
Unzertrennliche Nachbarn: Tag und Nacht

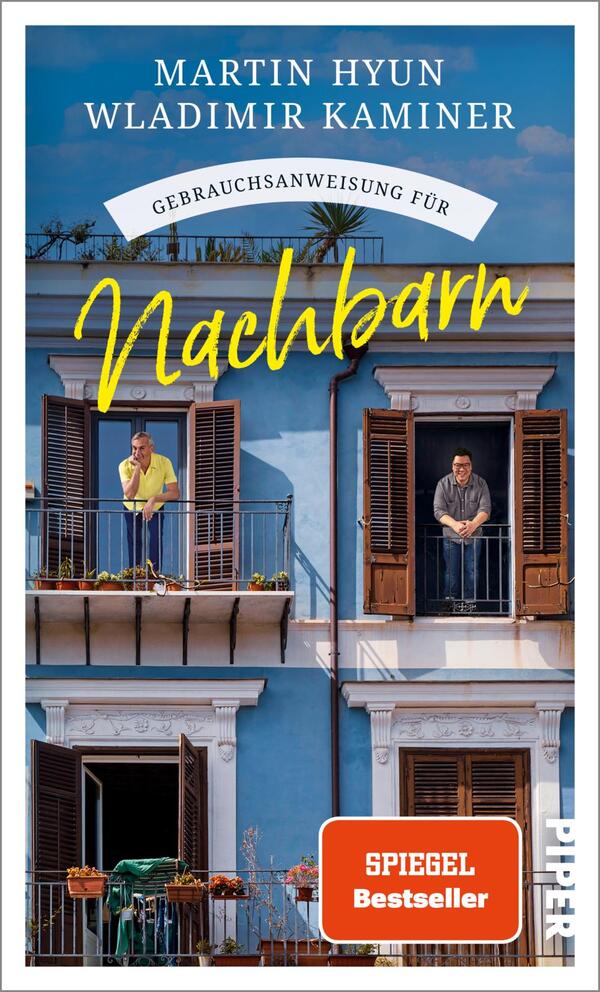
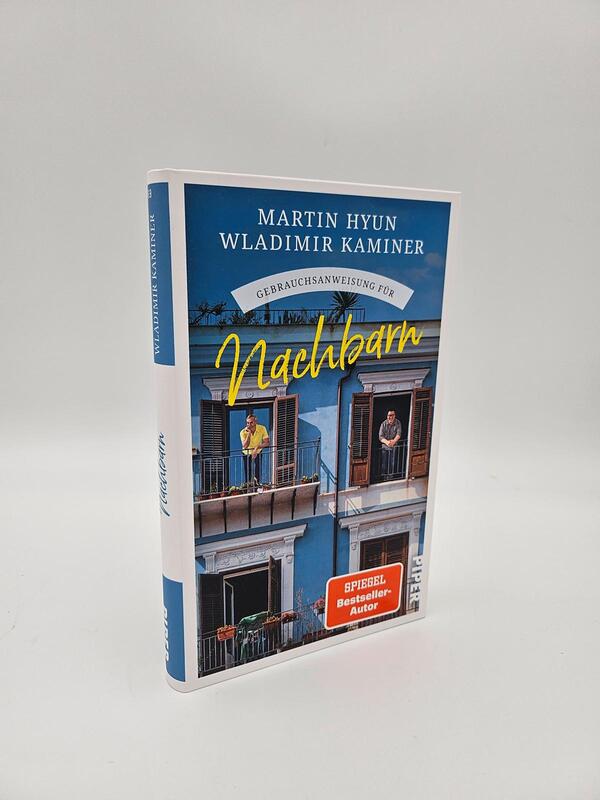




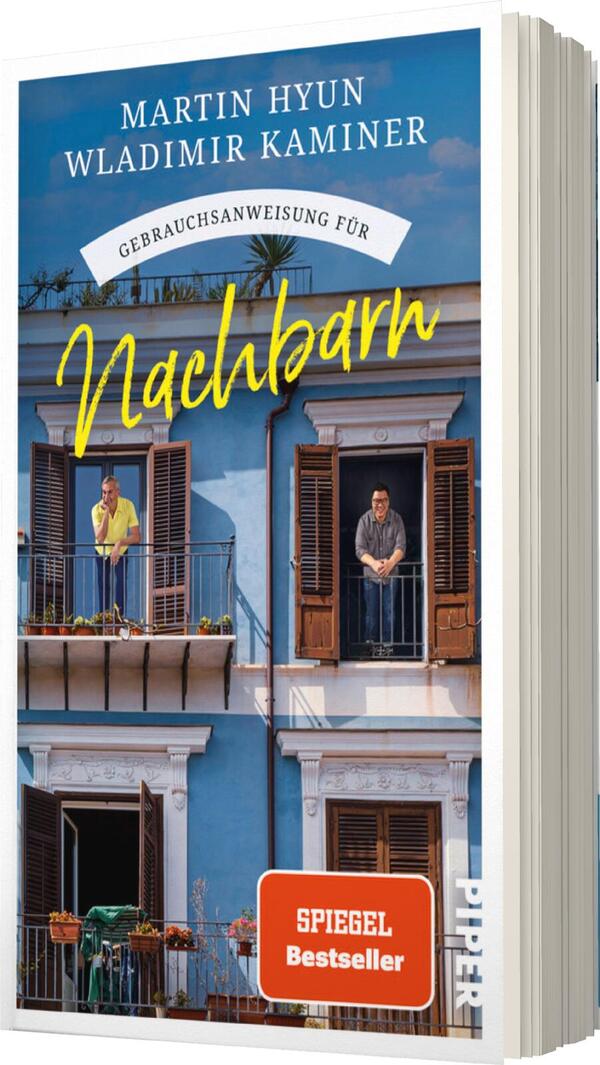
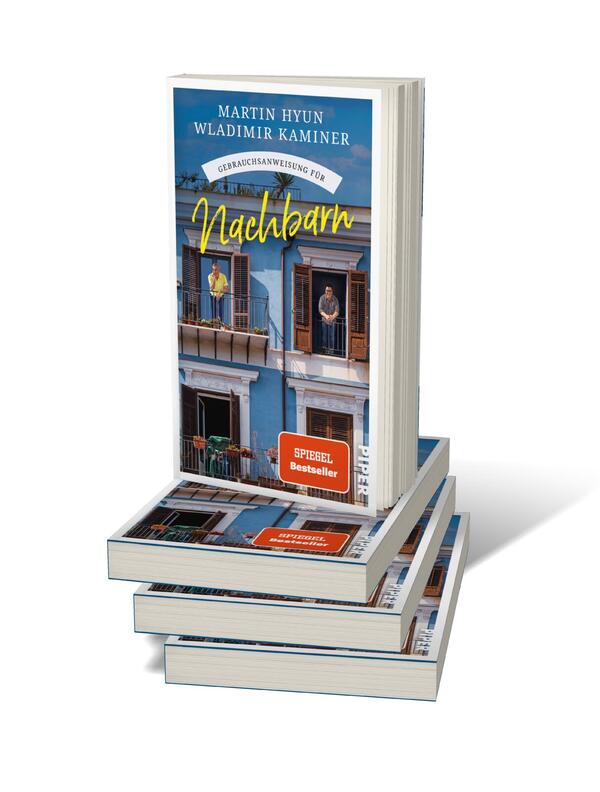







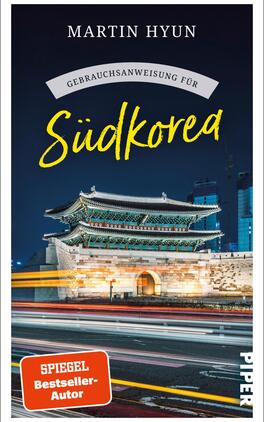
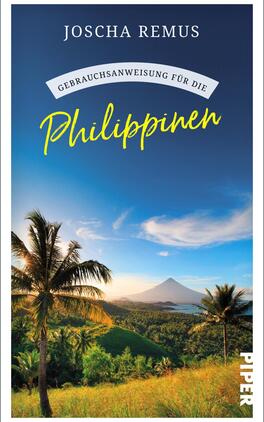

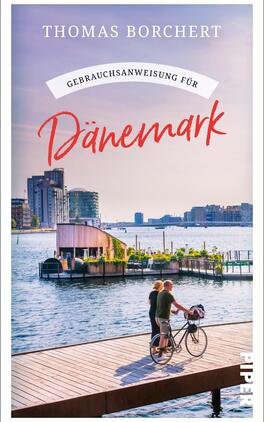
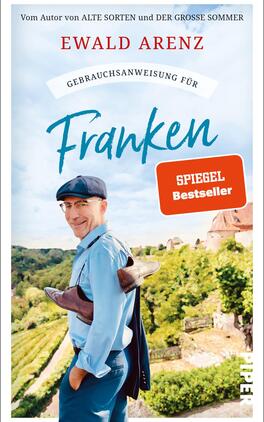
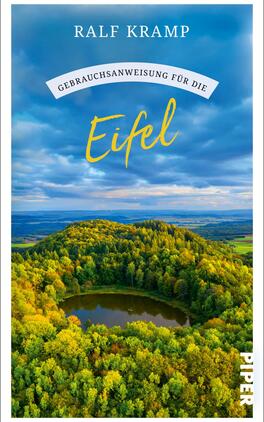
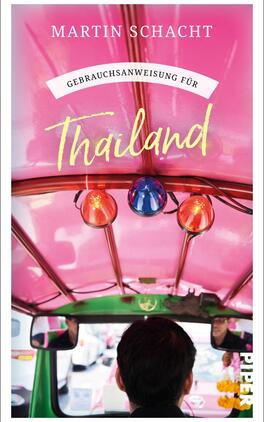
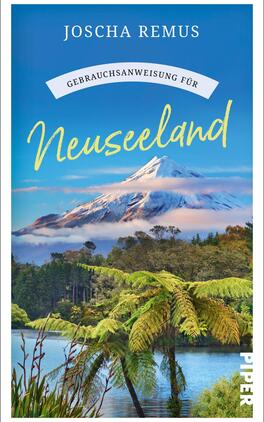
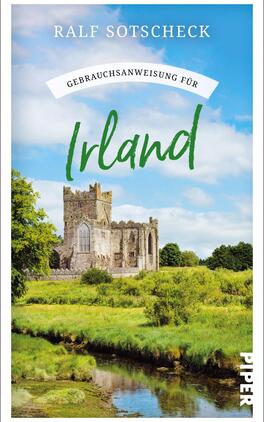
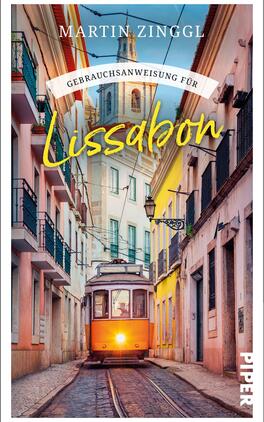
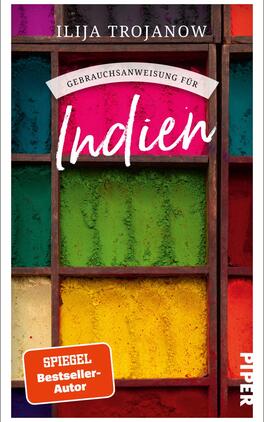
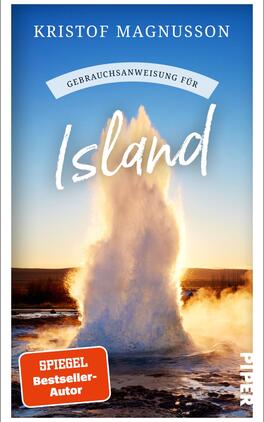





Die erste Bewertung schreiben