
Das falsche Spiel (Thea Paris 2) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Thea Paris, Sonderermittlerin für Entführungsfälle, wird selbst zur Geisel: Als sie zwei Waisenjungen nach London zu einer Pflegefamilie bringen will, wird das Flugzeug, in dem sie reisen, entführt. Was zunächst nach einem Zufall aussieht, entpuppt sich bald als abgekarteter Plan: Thea ist keineswegs ein willkürliches Opfer, die Kidnapper haben es auf sie abgesehen. Hinter der Entführung steckt jemand, der schon lange plant, sich an Thea zu rächen. Er spielt ein Spiel mit ihr, das auf jeden Fall tödlich enden wird – und Thea ist gezwungen zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss …
Weitere Titel der Serie „Thea Paris“
Über K.J. Howe
Aus „Das falsche Spiel (Thea Paris 2)“
Prolog
10. März 1956
11 275 Meter über dem Mittelmeer
Bomberpilot Earl Johnson hatte sich noch nie so hellwach gefühlt.
Die B-47 war schnell wie der Blitz und verfügte über eine unvergleichliche Manövrierfähigkeit. All seine Sinne waren bis aufs Äußerste geschärft. Doch nicht einmal die sechs Triebwerke des strategischen Bombers konnten seine Besatzung an diesem Tag warm halten. Die niedrige Außentemperatur umhüllte das Flugzeug wie ein Eispanzer. Earl war voll konzentriert, seine eisigen Finger hielten den Schubhebel umklammert in dem Versuch, das Flugzeug mit den [...]








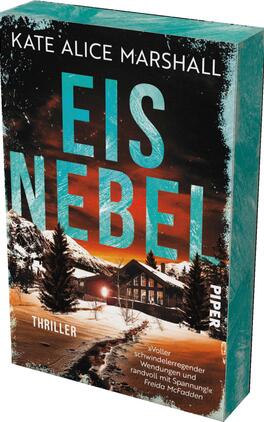



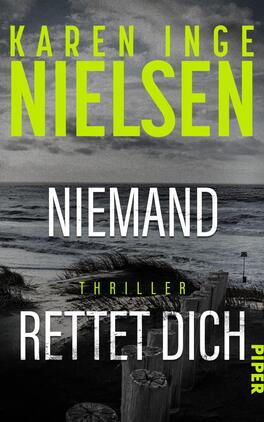
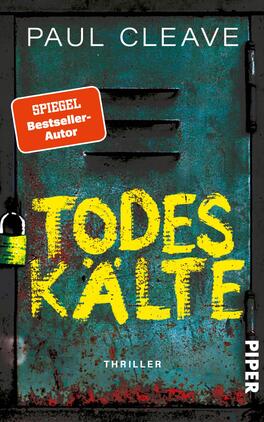
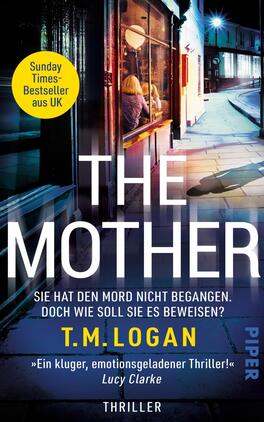





Die erste Bewertung schreiben