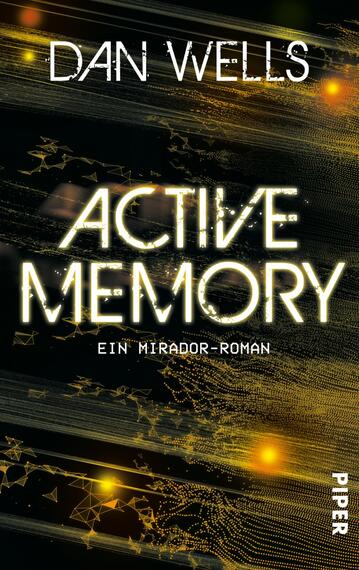
Active Memory (Mirador 3) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Realistisch, spannend und actionreich beschreibt Dan Wells in ›Active Memory‹ die Geschehnisse und Lebensverhältnisse der Menschen von Los Angeles im Jahr 2050. Das Buch ist ein würdiger Abschluß dieser Reihe.“
uwes-leselounge.blogBeschreibung
Los Angeles im Jahr 2050: Die junge Hackerin Marisa Carneseca umgibt ein Geheimnis. Als sie zwei Jahre alt war, verlor sie bei einem Autounfall ihren Arm, während Zenaida de Maldonado, die Frau eines Mafiabosses, starb. Niemand kann Marisa sagen, warum sie in diesem Auto saß oder wie es nach dem Unfall zu der Fehde zwischen den Carnesecas und den Maldonados kam. Die Vergangenheit holt Marisa viele Jahre später ein, als Zenaidas frisch abgetrennte Hand aufgefunden wird. Ist Zenaida doch noch am Leben? Als Marisa erfährt, dass nicht nur die Gangs von Los Angeles, sondern auch die größten…
Los Angeles im Jahr 2050: Die junge Hackerin Marisa Carneseca umgibt ein Geheimnis. Als sie zwei Jahre alt war, verlor sie bei einem Autounfall ihren Arm, während Zenaida de Maldonado, die Frau eines Mafiabosses, starb. Niemand kann Marisa sagen, warum sie in diesem Auto saß oder wie es nach dem Unfall zu der Fehde zwischen den Carnesecas und den Maldonados kam. Die Vergangenheit holt Marisa viele Jahre später ein, als Zenaidas frisch abgetrennte Hand aufgefunden wird. Ist Zenaida doch noch am Leben? Als Marisa erfährt, dass nicht nur die Gangs von Los Angeles, sondern auch die größten Konzerne der Welt in den Fall verwickelt sind, wird klar, dass mehr dahinter steckt, als Marisa je hätte ahnen können ...
Weitere Titel der Serie „Mirador“
Über Dan Wells
Aus „Active Memory (Mirador 3)“
Kapitel 1
Die Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Highschool war mit einem ganzen Schwarm wunderschöner schwebender Laternen geschmückt. Die solarbetriebenen LED-Lampen hingen an großen Ballons aus Mylarfolie, deren Auftrieb genau bemessen war, sodass sie regungslos in der Luft verharrten. Die Steuerung war intelligent genug, um die Ballons an die vorgesehenen Positionen zurückzubringen, wenn eine unberechenbare Bö sie mitriss. Oder, dachte Marisa, wenn ein ebenso unberechenbarer Schüler sie absichtlich wegstieß. Letzteres war sogar die wahrscheinlichere Variante. [...]






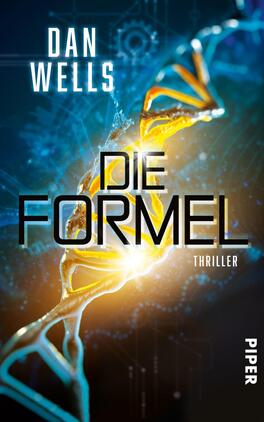
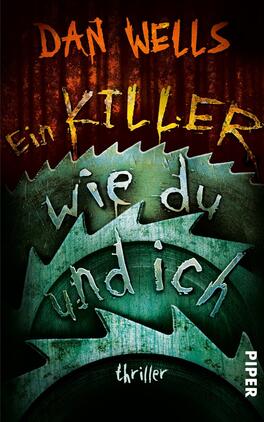


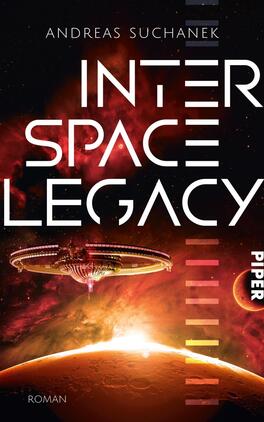


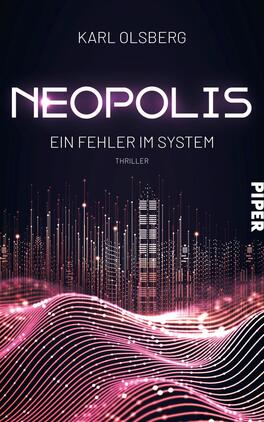
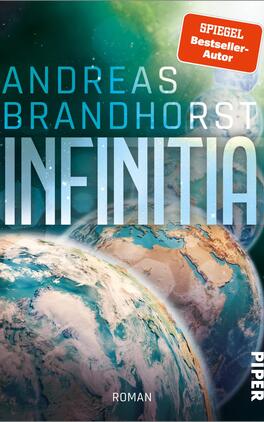





Die erste Bewertung schreiben