Christentum Sachbücher
Christliche Bücher: Entdecken Sie neue Aspekte des Glaubens und der Theologie. Unsere Autoren wie Hans Küng beschäftigen sich mit vielen Fragen, die im christlichen Glauben eine Rolle spielen:
- Was bedeutet es heute, Christ zu sein?
- Wohin führt der Weg der katholischen Kirche?
- Hat das Zölibat und das Priestertum in der heutige Form eine Zukunft?
- Wie kann zeitgemäßes Papstum aussehen?
Ein blinder Fleck in der christlichen Kulturgeschichte
Der wahre Gott der Bibel war eine levantinische Gottheit des Altertums, dessen Schritte die Erde erbeben ließen, dessen Stimme durch den Himmel donnerte und dessen Schönheit und Strahlkraft seine Anhänger blendete.


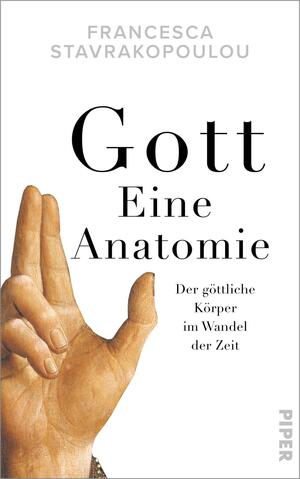







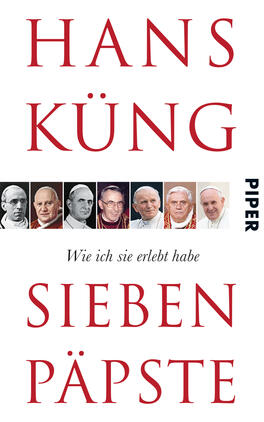




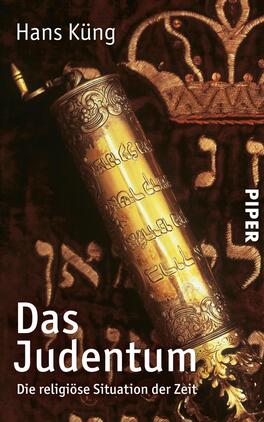




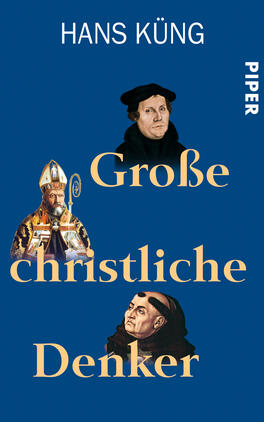
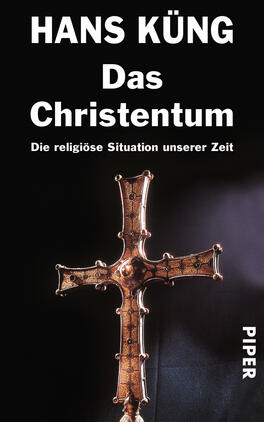






Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.