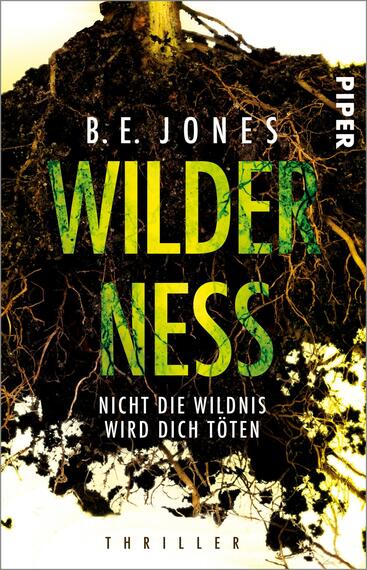
Wilderness – Nicht die Wildnis wird dich töten - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Erschüttert von der Entdeckung, dass ihr Mann Will eine Affäre hat, beschließt Olivia, dass sie ihre Ehe um jeden Preis retten muss. Vielleicht bietet ihr lang geplanter gemeinsamer Roadtrip durch die Nationalparks der USA eine Chance, die Wunden zu heilen? Doch was Olivia ihrem Mann nicht verrät: Er hat auf dieser Reise drei Gelegenheiten, ihr zu beweisen, dass er ihre Vergebung verdient. Wenn er versagt? Nun, in der Wildnis, meilenweit entfernt von jeder Hilfe, lauern viele tödliche Gefahren. Wenn ihre Ehe nicht überleben kann, kann er es auch nicht ...
Über B. E. Jones
Aus „Wilderness – Nicht die Wildnis wird dich töten“
Prolog
Erst sechs Monate nachdem ich das Video gesehen hatte, kam es zum ersten Todesfall. Das Timing war schwierig, und vorab musste ich wichtige Entscheidungen treffen, zum Beispiel: Sollte ich weggehen oder bleiben? Nachgeben oder kämpfen? Heilen oder zerstören? Mich zum Sterben hinlegen oder …
So oder so ließ sich das nicht aus einer Laune heraus entscheiden, mit einem Fingerschnippen oder durch das Werfen einer Münze. Denn wenn ich die falsche Entscheidung traf, war ein Leben in Einsamkeit meine Zukunft. Ich sah mich durch den Schutt kriechen, vorbei an Haufen [...]










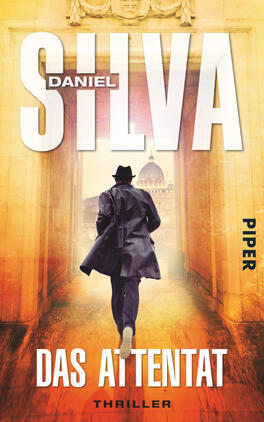


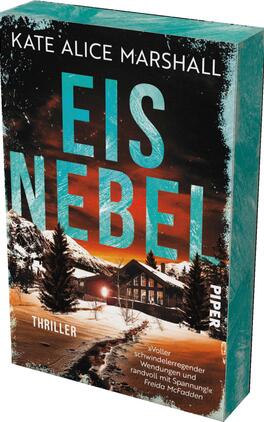





Die erste Bewertung schreiben