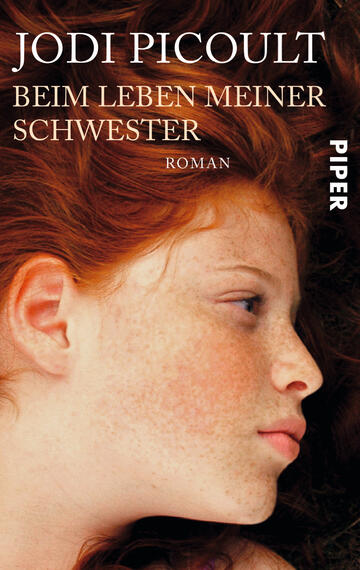
Beim Leben meiner Schwester
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Tief bewegend und spannend wie ein Krimi.
Für SieBeschreibung
Ohne ihre Schwester Anna kann Kate Fitzgerald nicht leben: Sie hat Leukämie. Doch eines Tages weigert sich die 13-jährige Anna, weiterhin Knochenmark für ihre todkranke Schwester zu spenden … Jodi Picoults so brisanter wie aufrüttelnder Roman über den Wert des Menschen wird niemanden kaltlassen.
Medien zu „Beim Leben meiner Schwester“
Über Jodi Picoult
Aus „Beim Leben meiner Schwester“
Für die Currans:
die besten Familienmitglieder,
mit denen wir gar nicht verwandt sind.
Danke, daß ihr in unserem Leben
eine so wichtige Rolle spielt.
Man fängt keinen Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will, das erste ist der Zweck, das andere das Ziel.
CARL VON CLAUSEWITZ,
›Vom Kriege‹, 8. Buch, 2. Kapitel
PROLOG
In meiner frühesten Erinnerung bin ich drei Jahre alt und versuche, meine Schwester umzubringen. Manchmal ist die Erinnerung so deutlich, daß ich wieder genau weiß, [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
Das bewegende Porträt einer zerrissenen Familie. Jede Figur ist lebendig, jede Situation wahr. Jodi Picoult gelingt es, ihre Leser bis zur letzten Seite zu fesseln... mich inbegriffen.
Elizabeth GeorgeTief bewegend und spannend wie ein Krimi.
Für Sie






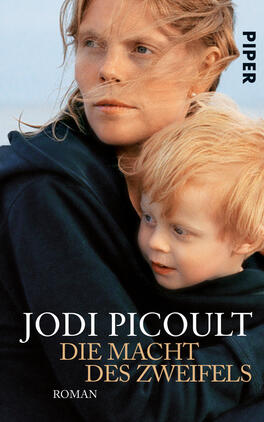

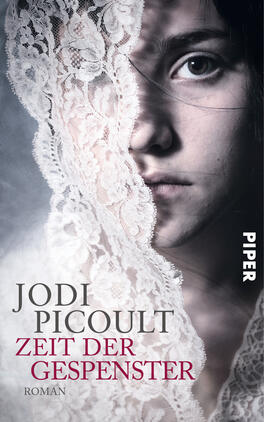


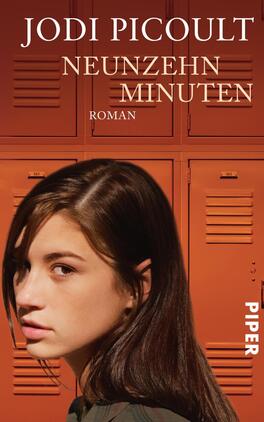


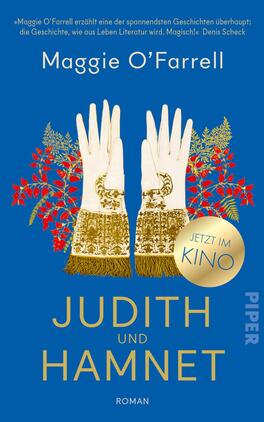




Die erste Bewertung schreiben