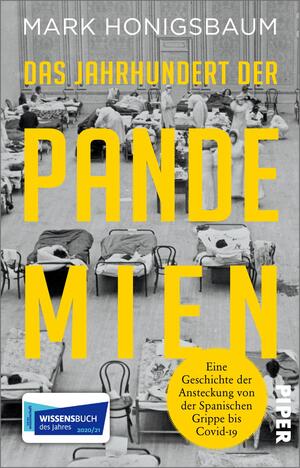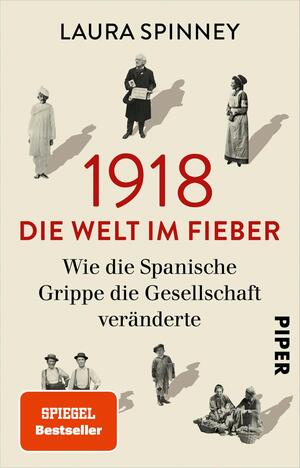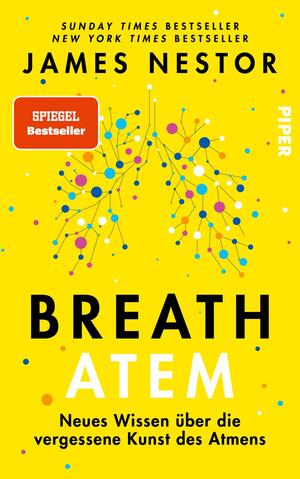Corona: Daten, Fakten, Hintergründe
Die wichtigsten Antworten zur globalen Pandemie. Unsere Autor:innen beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Aspekten von Sars-CoV-2 und beantworten die wichtigsten Fragen zu Gesundheit, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Zeiten von Corona.
„Diese Pandemie war weltweit, aber auch für uns in Deutschland ein Jahrhundertereignis. Rückblickend ist es unerlässlich zu hinterfragen, ob wir angemessen reagiert haben. Was waren gute Strategien und welche Fehler haben wir gemacht? Es ist wichtig, aus dieser Analyse Lehren zu ziehen, um in zukünftigen Pandemien oder andersartigen Krisen besser agieren zu können." Hendrik Streeck
Eine unverzichtbare, ehrliche Bilanz ...
Corona Aufarbeitung: Hendrik Streeck legt dar, warum wir vermeintlich unversöhnliche Positionen nur auf dem Pfad eines offenen, diskussionsfreudigen und gar versöhnlichen Diskurses zusammenführen können. Damit wir bei der nächsten Pandemie nicht nur die medizinischen, sondern auch die politischen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen meistern.