Produktbilder zum Buch
Denkanstöße 2026 (Denkanstöße)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
„Eine wertvolle Orientierungshilfe.“ FAZ Online
„Sie haben wenig Zeit, wollen aber trotzdem viel wissen? Die ›Denkanstöße‹ fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.“ SPIEGEL ONLINE
Die „Denkanstöße 2026“ – das sind ausgereifte Argumente, kompaktes Wissen und spannende Positionen eines ganzen Jahres. So schreibt der Publizist Michel Friedmann über Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit und darüber, wie verhindert werden kann, dass Hass und Gewalt gegen Juden weiter zunehmen. Die Reporterin Julia Friedrichs fragt, wie viel Ungleichheit eine Gemeinschaft verträgt und ob Reichtum Grenzen…
„Eine wertvolle Orientierungshilfe.“ FAZ Online
„Sie haben wenig Zeit, wollen aber trotzdem viel wissen? Die ›Denkanstöße‹ fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.“ SPIEGEL ONLINE
Die „Denkanstöße 2026“ – das sind ausgereifte Argumente, kompaktes Wissen und spannende Positionen eines ganzen Jahres. So schreibt der Publizist Michel Friedmann über Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit und darüber, wie verhindert werden kann, dass Hass und Gewalt gegen Juden weiter zunehmen. Die Reporterin Julia Friedrichs fragt, wie viel Ungleichheit eine Gemeinschaft verträgt und ob Reichtum Grenzen braucht, und der Journalist Ulrich Wickert beleuchtet die Geschichte der Europäischen Union und wirbt für ein friedliches, starkes Europa.
Ein Lesebuch zum Mit- und Weiterdenken!
Weitere Titel der Serie „Denkanstöße“
Aus „Denkanstöße 2026 (Denkanstöße)“
Vorwort
Wir leben in einem Zeitalter der Krisen und Chancen, der Neuerungen und des Umbruchs. Gewiss, auch in früheren Zeiten haben vermutlich schon viele so gedacht. Und dennoch bleibt der Eindruck, dass die Geschwindigkeit, in der sich die aktuellen Veränderungen vollziehen, höher ist als je zuvor. Mehrere wichtige Bereiche unseres Lebens verändern sich gleichzeitig immer schneller. Die Künstliche Intelligenz – die gerade erst in unser Arbeits- und Alltagsleben getreten ist – wird immer leistungsfähiger, und es wird immer einfacher, auf Informationen zuzugreifen.
D [...]
Vorwort
Erkenntnisse aus Philosophie und Wissenschaft
Michael Schmidt-Salomon Die Evolution des Denkens – Das moderne Weltbild – und wem wir es verdanken
Ein Kopf denkt nie allein
Die größten Genies aller Zeiten?
Der Zukunft entgegen
Die Menschheit im Anthropozän
Planetare Verantwortung
Die neue Achsenzeit
Karsten Brensing Die Magie der Gemeinschaft – Was uns mit Tieren und künstlichen Intelligenzen verbindet
Das Sozialleben, die Triebfeder des Geistes
Die Magie der Gemeinschaft
Gemeinsam sind wir stark
Die Erfindung der Lüge, und warum wir trotzdem vertrauen
Freundschaft und Allianzen
Christina Pingel DIAGNOSE: FRAU – Wie mich die männerbasierte Medizin fast das Leben kostete
Mutter und Tochter
Die Untersuchung
Die Diagnose
Erfahrungen aus Politik und Wirtschaft
Julia Friedrichs CRAZY RICH – DIE GEHEIME WELT DER SUPERREICHEN
Wenn aus Reichtum Macht wird
Mohamed Amjahid Alles nur Einzelfälle? – Das System hinter der Polizeigewalt
Eine kleine Geschichte der Polizei
Deutsche Police Academy
Jeannette zu Fürstenberg, Inge Kloepfer Wie gut wir sind, zeigt sich in Krisenzeiten – Ein Weckruf
Mindset
Der menschliche Faktor
Einsichten aus Gesellschaft und Zeitgeschehen
Michel Friedman Judenhass – 7. Oktober 2023
Wieder
Versprochen. Gebrochen
Wo seid ihr?
Brief an die Gleichgültigen
Scherben
Daniel Goffart, Angelika Melcher Boomer gegen Zoomer – Der neue Generationenkonflikt und wie wir uns besser verstehen können
Prägung – Wie wir wurden, was wir sind
„Cancel Culture“ – der neue Kulturkampf um das „Unsagbare“
Ulrich Wickert Salut les amis – Meine Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen
Die Schatten der Vergangenheit
Beziehungskrise – Trennung von Problemen, nicht vom Partner
Autorinnen und Autoren
Quellen und Anmerkungen

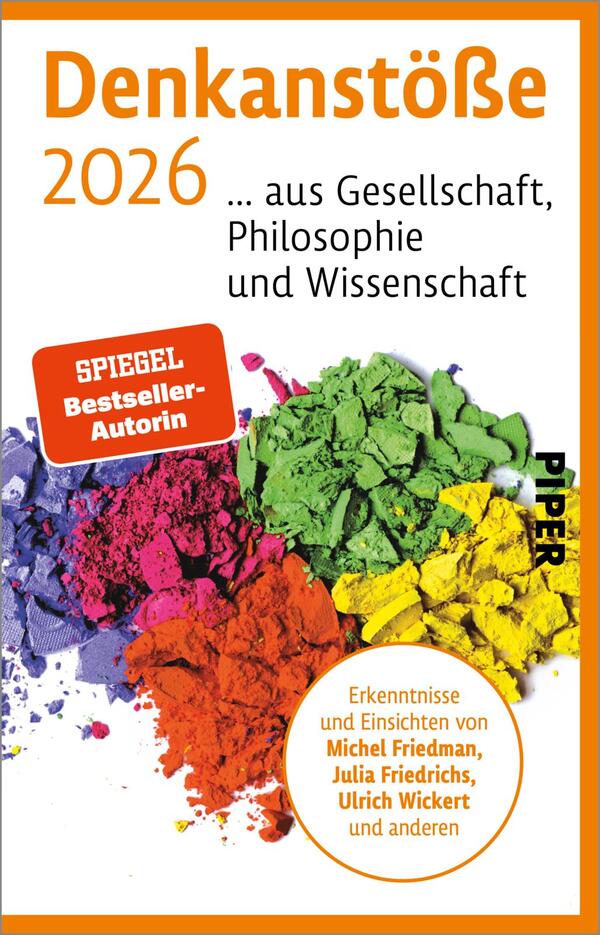
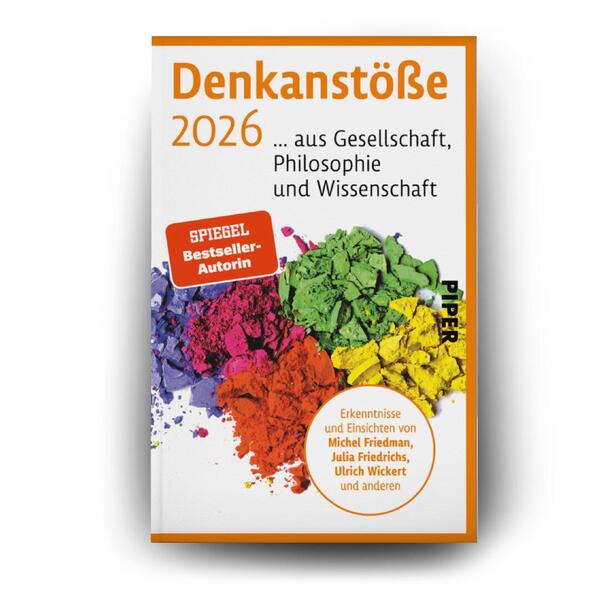
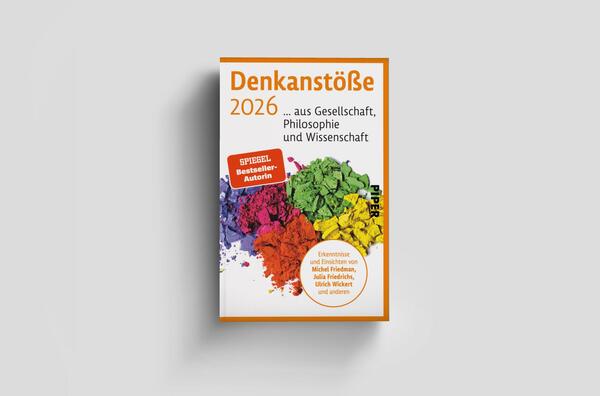
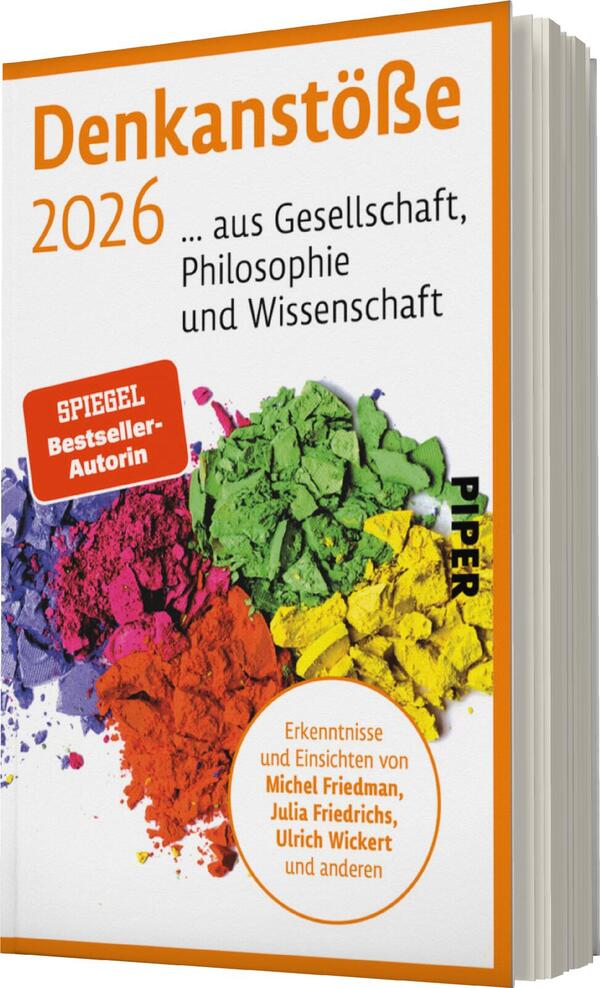
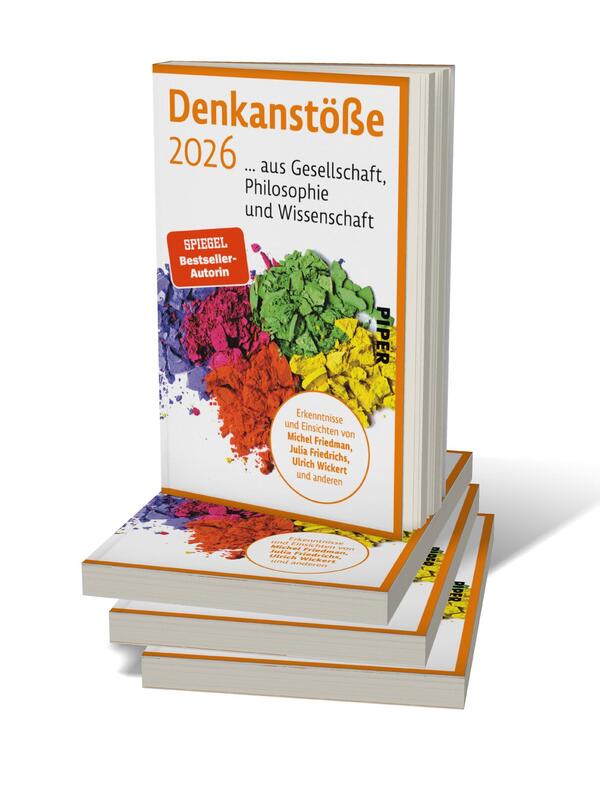
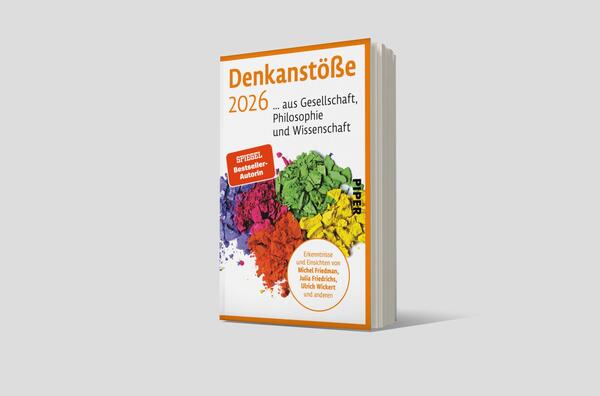
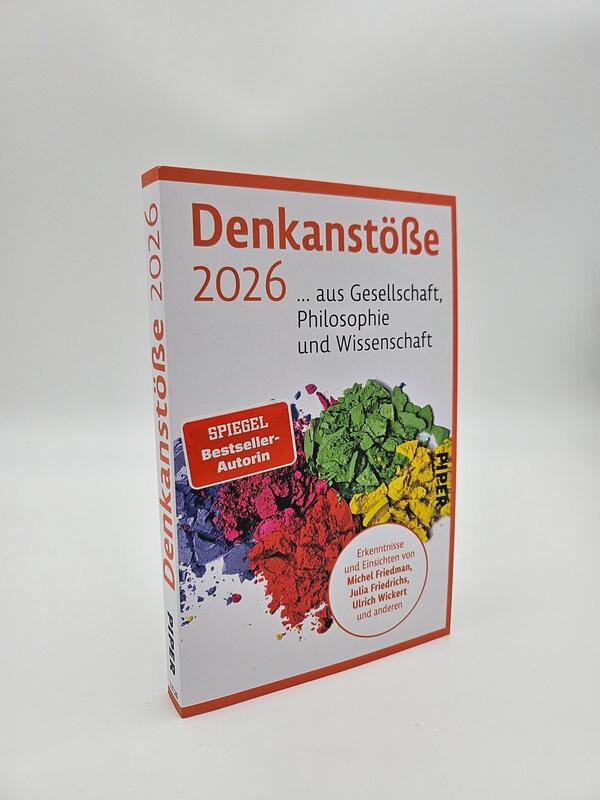
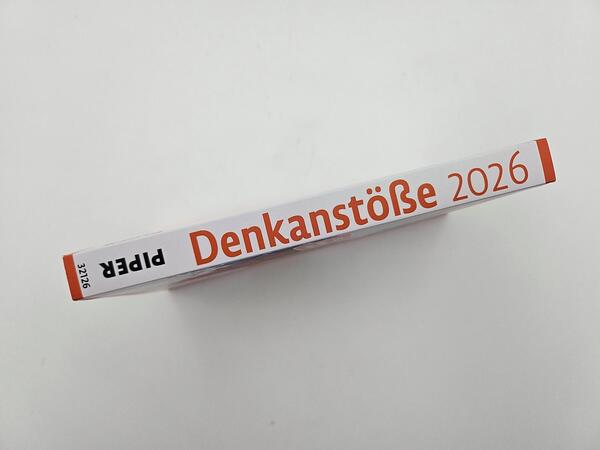
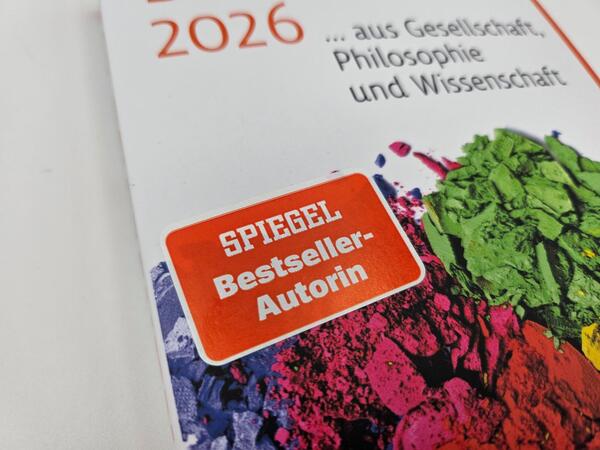
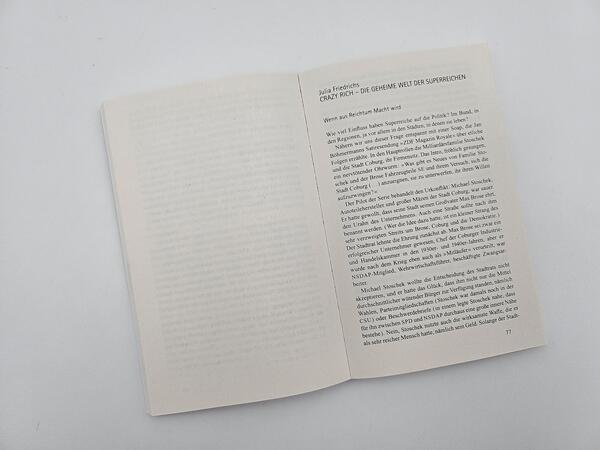
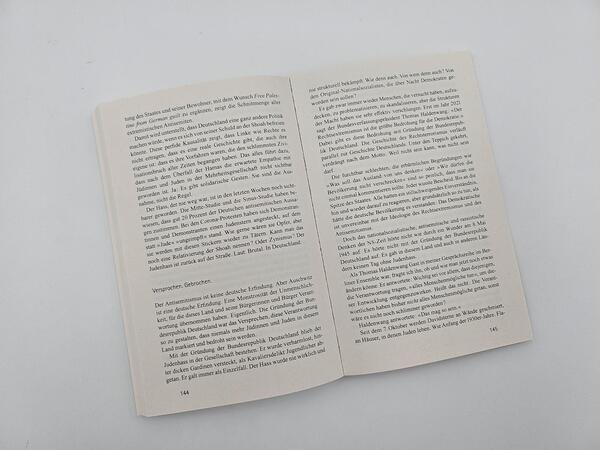
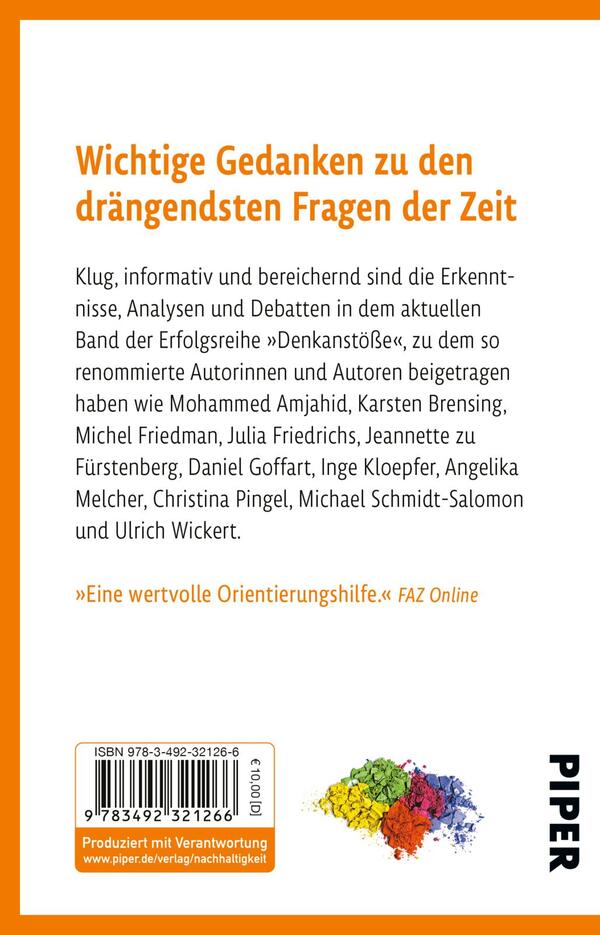



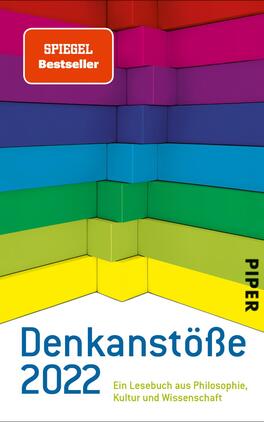
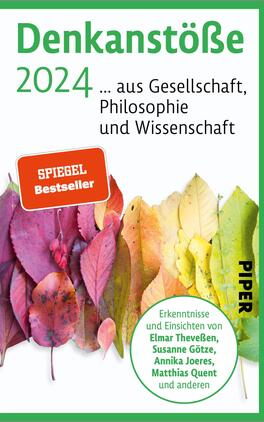
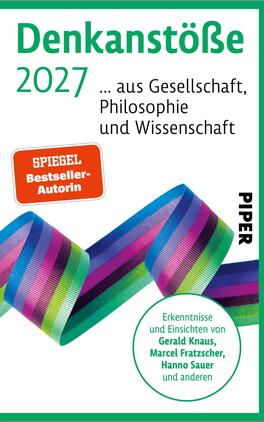
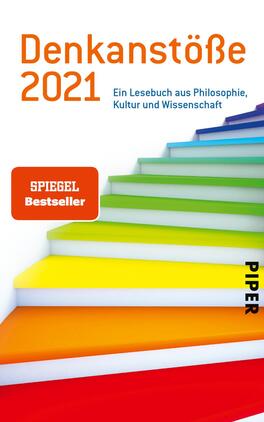
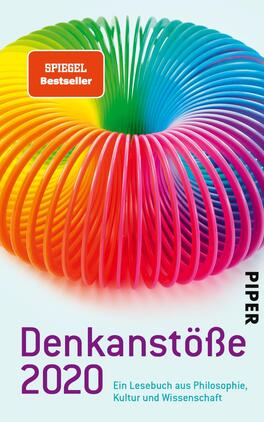
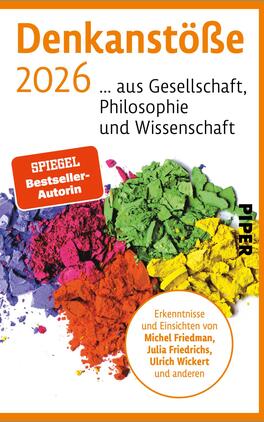
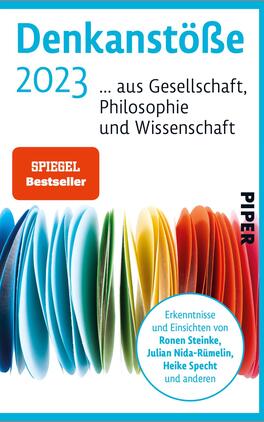
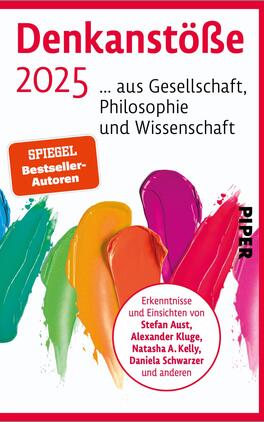
Die erste Bewertung schreiben