Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann, sind das Wichtigste an einem Buch, meint die britische Autorin Judith Lennox. Mehr zur Entstehung ihres Romans „An einem Tag im Winter“ und zu den autobiografischen Aspekten der Geschichte im Interview.
Worum geht es in Ihrem Buch?
Das Buch beginnt in den 1950-ern, genauer 1952. Es handelt von Ellen Kingsley, die ihren ersten Arbeitstag an einem Wissenschaftlichen Institut, Gildersleve Hall, in der Nähe von Cambridge in England auf dem Land antritt. Sie ist eine junge Wissenschaftlerin, deren Karriere gerade beginnt. In einer Zeit, in der die meisten Wissenschaftler männlich sind, beginnt sie in einem von Männern dominierten Arbeitsbereich zu arbeiten.
Sie geht zur Arbeit in Gildersleve Hall, es ist ihr Traum, dort zu arbeiten, als sie dort anfängt, passieren verschiedene Dinge: Sie verliebt sich, außerdem wird sie in eine Tragödie verwickelt. Sie gerät in einen Konflikt mit Dr. Marcus Pharoah, dem Institutsleiter, und das verändert ihr ganzes Leben. Das katapultiert sie in eine Richtung, von der sie nicht erwartet hätte, diese einzuschlagen.
Ellen ist eine sehr ehrliche Person, Ehrlichkeit ist ihr sehr wichtig. Sie wird mit Menschen konfrontiert, die nicht so ehrlich sind, was ihr Leben ebenfalls verändert. Sie muss lernen, ihren eigenen Weg zu finden, an dem festzuhalten, woran sie glaubt, und ihren Weg zu machen.
Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
Ich schreibe nun seit über 25 Jahren, und ich würde sagen, dass ich in erster Linie für meine Leser schreibe. Aber außerdem schreibe ich auch für mich selbst. Ich hoffe, meinen Lesern gefällt die Art Bücher, die ich gerne lese, die eine starke Handlung haben, die einen motiviert, weiterzulesen.
Romane, die über Charaktere verfügen, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man mitfühlt. Für mich ist das das Wichtigste an einem Buch. Die Handlung spielt für mich an sich nicht so eine große Rolle, aber ich möchte, dass man eine Beziehung zu den Figuren aufbaut. Sie müssen nicht alle nur gut oder nur schlecht sein. Ich glaube, meine Charaktere sind meistens eher eine Mischung. Ich denke, ich schreibe also für Menschen, die meine Bücher über all die Jahre gelesen haben, und natürlich auch für mich selbst.
Was bedeutet Ihnen dieses Buch?
Meine Eltern waren beide Wissenschaftler, sie haben sich an einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut in England auf dem Land in den späten 1940-ern kennengelernt. Hier trafen sie sich, verliebten sich ineinander und verlobten sich. Meine Mutter war Wissenschaftlerin, genau wie Ellen, in einer Zeit, in der nur wenige Frauen als Wissenschaftlerinnen tätig waren. Ich glaube, es war ein ganz schöner Kampf für sie, Karriere zu machen. Besonders als sie heiratete und Kinder bekam.
Der Großteil meiner Familie besteht aus Wissenschaftlern oder arbeitet mit ihnen zusammen. Und ich bin eine der wenigen Ausnahmen. Ich weiß also, glaube ich, ein bisschen was über Wissenschaftler. Außerdem dachte ich, es wäre mal etwas anderes, eine Romanheldin aus diesem Bereich zu haben. Man neigt immer dazu, zu denken, es gäbe viele wissenschaftliche Heldinnen in Krimis, allerdings sind es in der Art von Romanen, die ich schreibe, nicht so viele.
Ein weiterer, persönlicher Aspekt ist, dass ein Teil des Buches in Schottland spielt, auf einer kleinen Insel vor der schottischen Küste, die Seil heißt. Ich bin schon lange mit einem Schotten verheiratet und bin daher eine Menge in Schottland umhergereist. Ich liebe die schottischen Inseln, ganz besonders Seil, das ich extra für die Recherchearbeit zu diesem Buch besucht habe. Es ist ein sehr einzigartiger Ort. Ich mag Inseln.
Wir waren schon auf verschiedenen Inseln in der ganzen Welt. Ich mag die Tatsache, dass sie sich so sehr voneinander unterscheiden. Seil ist eine sehr kleine Insel, aber es gibt eine noch kleinere: Easdale, die man in einer Stunde umrunden kann. Beide Inseln verströmen ein ganz unterschiedliches Gefühl, jede eine ganz eigene Atmosphäre. Ich war sehr angetan davon, deshalb wollte ich diesen Aspekt auch in das Buch einbauen.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich habe angefangen, an einem neuen Buch zu schreiben, es spielt größtenteils im Südwesten Englands in Devon, an der Küste. Es geht um ein Haus. Darum, was dieses Haus der Familie, die dort lebt, bedeutet. Manche Familienmitglieder lieben es, andere hassen es, manche würden alles tun, um es zu behalten. Außerdem geht es darum, welchen Effekt das Haus auf die Menschen hat.
Ich glaube, Umgebung und Umwelt beeinflussen einen Menschen, beeinflussen die Art Mensch, die er ist, und darüber wollte ich schreiben. Es handelt von drei Generationen, beginnt im Ersten Weltkrieg und endet in den 1970-ern. Dieser Roman umfasst also eine weite Zeitspanne. Ich bin wirklich gespannt und freue mich darauf, weiterzuschreiben.
Was möchten Sie Ihren Lesern mit auf den Weg geben?
Ich möchte mich bei meinen deutschen Lesern bedanken für all die Jahre, in denen sie mich schon unterstützen, danke dafür, dass Sie meine Bücher lesen! Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin schon sehr gespannt auf die deutsche Veröffentlichung von „An einem Tag im Winter“ und hoffe, dass es Ihnen gefällt!













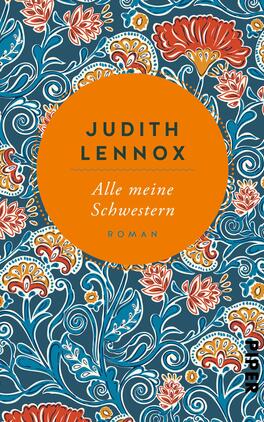
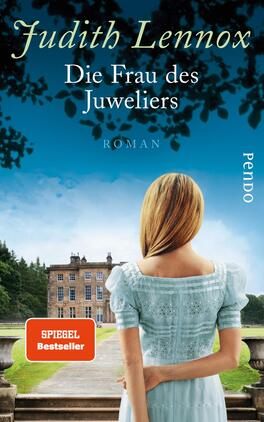







Bewertungen
Spannung Pur
Tolles Lesevergnügen, nicht nur im Winter