
INTERVIEW mit Hanni Münzer
Was hat Sie dazu inspiriert, Ihren Roman „Honigot“ zu schreiben?
Die Idee zu einer Geschichte hat viele Wurzeln, sie wächst durch die eigenen Gedanken, Erlebnisse und Begegnungen, Gefühle und Emotionen. Durch die Erzählungen meiner Stiefoma habe ich mich sehr früh für die deutsche Vergangenheit interessiert. Darum stand für mich von Beginn an fest, dass meine Geschichte vor dem Hintergrund dieses unsäglichen 2. Weltkriegs spielen sollte. Denkt man an diesen Krieg, hat man sofort die Bilder von Tod und Zerstörung im Kopf: Bombenhagel, rollende Panzer, verwüstete Landstriche und Städte, vor allem aber auch Auschwitz mit seinen entsetzlichen Leichenbergen.
Diese Bilder wollte ich nicht heraufbeschwören. Ich wollte zeigen, was der Krieg mit den Seelen der Menschen macht, die das braune Regime damals zu unerwünschten Kreaturen erklärt hat. Wie diese Familien die Zeit erlebten, wie sie fühlten und litten und ums Überleben kämpften.
Welche Figur hat Sie in Ihrer Geschichte am meisten und welche am wenigstens bewegt?
„Honigtot“ lebt für mich von seinen starken Frauengestalten. Elisabeth, die wie eine Löwin um ihre Liebe und später um ihre Kinder kämpft, ihre leidenschaftliche Tochter Deborah, die, um ihren Bruder zu schützen, zu allem bereit ist, und ihre toughe Freundin Marlene, die Widerstandskämpferin. Sie alle bewegen mich und im Grunde befinde ich mich noch immer in der Zwiesprache mit meinen Protagonisten. Ich kann sie nicht loslassen. Denn sie stehen stellvertretend für all jene Frauen, die in der heutigen Zeit ebenso für ihre Liebe, ihre Familie und ihre Kinder kämpfen müssen. Es gibt zu viel Krieg auf dieser Welt. Noch immer.
Wie es Gustav, Elisabeths jüdischer Mann im Buch ausdrückt: „Die Erde könnte ein Paradies sein, wenn die Menschen es nur lernen würden, Frieden zu halten.“
Könnten Sie sich vorstellen, einen Roman nur aus der Sicht von Männern zu schreiben?
Nein, niemals. Aber ich könnte mir vorstellen, einen aus der Sicht von Gott zu schreiben. Der erste Satz würde lauten: „Seit ich die Menschen erschaffen habe, wundere ich mich, welcher Teufel mich damals geritten hat.“
Was lieben Sie und was hassen Sie am Schreiben?
Ich liebe alles am Schreiben. Und „hassen“ ist mir in dem Zusammenhang ein zu starkes Wort. Davon abgesehen bin ich sowieso chronisch harmoniesüchtig und Hass ist mir fremd. Tatsächlich fällt mir nichts ein, was ich nur ansatzweise nicht am Schreiben mag. Oh, halt! Da gibt es doch was: der Herr Duden. Der könnte mir manchmal schon den Buckel runterrutschen. Der mag mein Bayrisch nicht.
Gibt es zu Ihrem Schreiballtag einen Ausgleich?
1000 Dinge. Mein Mann, meine Familie, meine Freunde, der Hund, der Garten, der Sport. Die anderen 994 bleiben mein Geheimnis.
Von welchem Autor (welchen Autoren) dürfen Sie kein neues Buch verpassen?
Ach, da gibt es unzählige. Am liebsten würde ich Tag und Nacht lesen. Ich liebe einige Autoren, die leider schon verstorben sind, wie J. R. R. Tolkien. Er hat im 1. Weltkrieg als Soldat das Gemetzel an der Somme mitgemacht und seine Erlebnisse in der Ring-Trilogie verarbeitet. Ich bewundere auch Richard Adams. Sein „Watership down“ ist magisch. Adams engagiert sich stark für den Tierschutz. Tiere sind ebenso Gottesgeschöpfe und ich finde, eine Gesellschaft sollte sich auch daran messen lassen, wie sie mit seinen Tieren und der Natur umgeht. Ansonsten lese ich sehr bunt. Viele Biographien von Zeitzeugen wie die von Egon Hanfstängl oder Hannah Arendt. Bestens unterhalten fühle ich mich durch Diana Gabaldon, Yo Yo Moyes, Guillaume Musso. Hape Kerkeling lese ich immer, er ist so herrlich lebensnah und ehrlich. Gisa Klönnes„Das Lied der Stare nach dem Frost“ ist ebenfalls wunderschön. Gerade habe ich Bettina Tietjens„Unter Tränen gelacht“ beendet. Ein sehr bewegendes Buch.
Wer ist Ihr größtes Vorbild?
Ich habe kein bestimmtes Vorbild. Es gibt viele besondere Menschen, die sich für Mensch, Tier und Umwelt einsetzen. Wer mich in letzter Zeit jedoch sehr beeindruckt hat, das sind die vielen freiwilligen Helfer, die u.a. nach Liberia gegangen sind, um gegen Ebola zu kämpfen. Das geschah nicht nur unter Einsatz ihres Lebens, sondern auch mit dem Risiko, an einer unsagbaren schmerzhaften Seuche zugrundezugehen. Meine Bewunderung gilt auch den vielen Kranken- und Altenpflegern. Sie leisten Großartiges. Es ist eine schwere, psychisch belastende Arbeit, und sie werden dafür grauenhaft unterbezahlt.
Wer ist Ihr größter Kritiker?
Mein Mann natürlich.
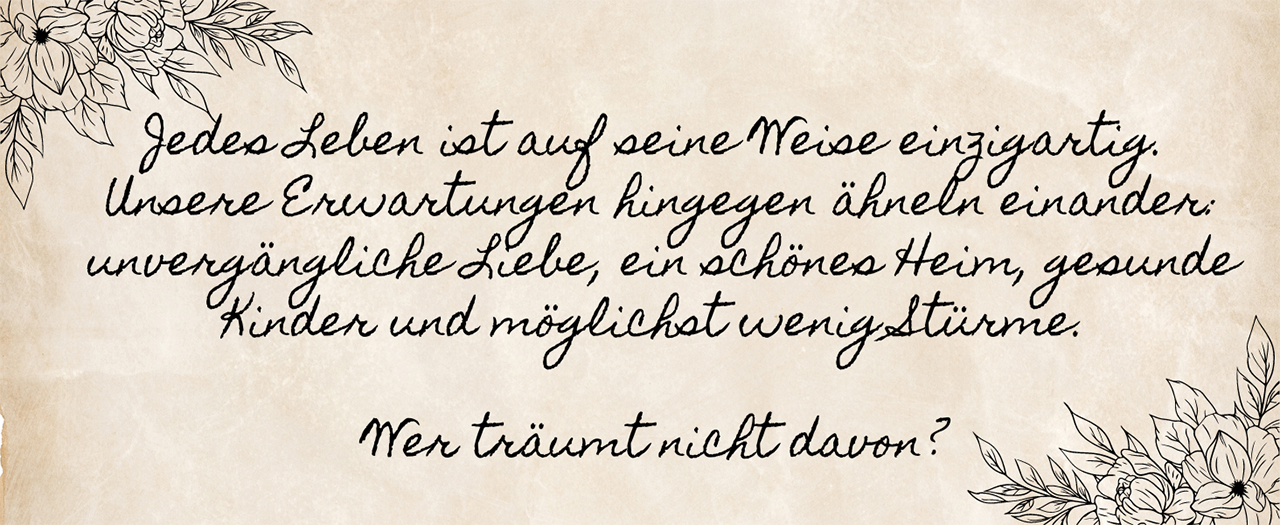

„Sehnsucht hat für meine Heldin Kathi einen Namen: Petersdorf. Der Ort, an dem sie einst glücklich war. Doch ihre Heimat gibt es nicht mehr ..."
Ich sehe sie noch immer vor mir, meine Großmutter Kathi, wie sie in der Küche, die kleine Mühle unter den Arm geklemmt, Kaffeebohnen mahlt. Zeitlebens haben Großvater und sie keinen fertigen Pulverkaffee getrunken. In Zeiten des Krieges, als es keinen Kaffee zu kaufen gab, oder später, in den ersten Jahren nach dem Krieg, als sie sich keinen leisten konnten, tranken sie aus Zichorien gewonnenen Blümchenkaffee, Muckefuck.
Kathi war meine Stiefgroßmutter. Sie war sehr klein und sehr lebhaft. Wie mein Großvater Josef stammte sie aus einem Dorf an der böhmisch-mährischen Grenze. Großvaters erste Frau starb früh, sie konnte die körperlichen und seelischen Strapazen der Vertreibung aus ihrem Heim im Jahr 1946 nie richtig verwinden.
Auch Kathi hatte durch den Krieg alles verloren. Ihre Familie, ihre Heimat. Dennoch war sie der fröhlichste Mensch, den ich kannte. Und sie lehrte mich: Tränen, die man gelacht hat, kann man nicht mehr weinen. Kathi hat für ihr Leben gern auf dem gemütlichen alten Holzherd gekocht, Obst und Gemüse eingemacht und die leckersten Kuchen gebacken. Zeitlebens besaß sie kein Mixgerät, sie rührte jeden Teig per Hand an. Und stets hat sie dabei alte Kinderlieder gesungen wie „Backe backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“. Noch heute, viele Jahre nach ihrem Tod, kann ich ihre Stimme hören. Kathi liebte Geschichten. Sie liebte es, zu erzählen. Und ich, die die großen Schulferien jedes Jahr auf dem kleinen Bauernhof meiner Großeltern verbringen durfte, lauschte ihr verzückt. Kathi war etwas Besonderes. Kathi träumte vom Reisen, wollte die Welt sehen oder wenigstens einmal das Meer. Doch der Krieg bürdete ihr bereits in jungen Jahren eine hohe Verantwortung auf, so dass sie ihre eigenen Träume nicht verwirklichen konnte. Sie hat das Meer nie gesehen.
Meine zweiteilige Saga „Heimat ist ein Sehnsuchtsort“ ist durch meine eigene Familiengeschichte inspiriert. Dass der Name der Heldin Katharina, genannt Kathi, lauten würde, stand von Beginn an fest. In meinem Roman wachsen Kathi Flügel, und sie darf die ganze Welt bereisen. Ja, sogar noch ein Stückchen weiter.
Kathi Sadler, ihre Schwester Franzi, deren Eltern Laurenz und Annemarie, auch Dorota, die warmherzige Köchin der Familie, sowie Oleg, Dorotas Ziehsohn und Knecht auf dem Sadlerhof, sind eine Hommage an all jene, die barbarischen Zeiten trotzten und sich dabei ihre Mitmenschlichkeit bewahrten. Dies ist ihre Geschichte.
AUGUST RUDOLF SADLER (geb. 1865), Mann von Charlotte und Kathis Großvater, ein Kriegsversehrter.
CHARLOTTE SADLER (geb. 1873), Laurenz´ Mutter und Kathis Großmutter, eine Pferdenärrin und Zigarrenrauchende Exzentrikerin.
LAURENZ SADLER (geb. 1901), Kathis Vater – ein Landwirt, der im Herzen Musiker ist.
PAULINA SADLER geb. Köhler, Witwe von Kurt Sadler, Laurenz Sadlers älterem Bruder.
ANNEMARIE SADLER (geb. 1899), Kathis Mutter, eine Frau mit bewegter Vergangenheit und einem Geheimnis.
KATHARINA SADLER (geb. 1928), genannt Kathi, eine mathematische Ausnahmebegabung.
FRANZISKA SADLER (geb. 1935), Kathis Schwester, genannt Franzi. Manchmal ist sie auch Ida; leidet an Sklerodermie und lebt in ihrer eigenen kleinen Welt.
DOROTA RAJEWSKI Olegs Ziehmutter, Wirtschafterin auf dem Sadlerhof mit Vorliebe für italienische Küche. Lebensklug und stets gut gelaunt. Besitzt die Gabe des zweiten Gesichts.
OLEG RAJEWSKI Dorotas Ziehsohn, Knecht, begnadeter Handwerker und Kathis guter Freund.
OSKAR Kathis Hund. Ein Schatzsucher.
PETER PAN ein zahmer Rehbock.
„Münzers Bücher haben eine Botschaft.“
Der erste Band der „Schmetterlinge“-Reihe, „Solange es Schmetterlinge gibt“, erschien im Juli 2017 im Programm des Eisele Verlags. Ab Oktober 2018 wird die Reihe bei Piper mit dem zweiten Band, „Unter Wasser kann man nicht weinen“, weitergeführt.
Es ist leicht, in der Sonne zu tanzen. Es im Regen zu tun – das ist die Kunst.
Nach einem Schicksalsschlag hat sich Penelope weitgehend von der Außenwelt zurückgezogen. Dass Glück und Liebe noch einmal in ihr Leben zurückkehren, wagt sie nicht mehr für möglich zu halten. Doch dann lernt sie die über achtzigjährige Trudi Siebenbürgen kennen – eine faszinierende Frau mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Auch ihr neuer Nachbar Jason spielt seine ganz eigene Rolle auf Penelopes neuem Weg. Und langsam lernt Penelope, dass die Welt voller Wunder ist, für den, der sie sieht.
„Herzschmerz pur!“ GONG
„Ein wortwörtlich „liebevoller“ Roman, der uns Gänsehaut beschert und Herzen heilt, eine starke Geschichte samt zauberhafter Charaktere, die wir auch nach dem Ende kaum gehen lassen wollen!“ Karla Paul, ARD Büffet
„Ein Buch wie eine beste Freundin. Wunderbar geschrieben, kraftvoll und mit viel Seele und Herz.“ Für Sie
Weitere Informationen finden Sie hier!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.


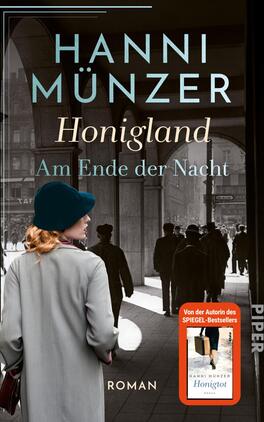


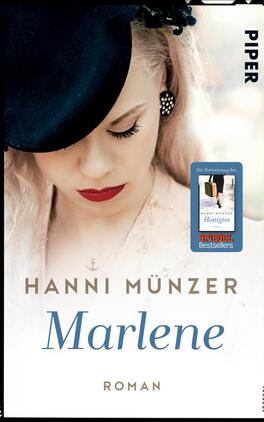





Die Bücher von Hanni Münzer sind großartig! Sie zählt zu meinen Lieblingsautorinnen. Man kann so richtig eintauchen in die Geschichten und Personen. Ich hoffe, es folgen noch viele Bücher von ihr . Honigland lese ich gerade und warte schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung im November!
Meine Meinung zur Autorin und Buch
Wieder ist Hanni Münzer ein großartiges Werk gelungen, ich kann es kaum erwarten den 2.Teil zu lesen. Sie ist eine große Meisterin des Genre, Dramatik , Liebe und das 3. Reich. Man spürt wieviel Herzblut in diese Geschichte geflossen ist. Einige der historischen Persönlichkeiten sind real, wie Antoine de Saint-Exupéry , Hindenburg, Hitler, Göring, und einige Andere. Auch wenn die Geschichte um ihre Protagonisten fiktiv sind, könnten sie sehr real sein, und wirklich so statt gefunden haben. Ein Teil von den Figuren habe ich geliebt und ein anderen Teil regelrecht verabscheut. Ihre Recherche zu, Buch ist wieder hervorragend. Schon Daisy Mutter Yvette sagt :
„ Krieg ist Irrsinn , nur Irre können ihn befehlen. Krieg ist Mord, nur Mörder können Menschen in den Tod schicken „
Danke für das Nachwort, man sollte es unbedingt lesen.
Daisy ist ein regelrechter Wirbelsturm und eine Rebellin , für 1928 ziemlich mutig und oft sehr waghalsig. Standesunterschiede gelten für sie und ihren Bruder Louis nicht, für sie sind alle Menschen gleich. Daisy beste Freundin ist und bleibt das Küchenmädchen Mitzi, die genauso selbstbewusst ist. Nur steht Mitzi mit beiden Füßen fest auf dem Boden, sie kennt die Wahre Welt. Louis ist ein regelrechter Träumer, der mit Stallburschen Willi befreundet ist. Beide Mädchen träumen von einer Zukunft zusammen in Berlin, in einer Welt wo das Leben pulsiert. Mitzi hat ganz genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft, sie möchte heraus aus dem Milieu, und Schauspielerin werden. Aber das ist noch der Drache und das Oberhaupt der Familie, Sybille die die heruntergekommene Werft damals von ihrem Mann übernommen hat, und mit Strenger Hand führt. Ihre Söhne sind keine Stützen, ihre französische Schwiegertochter Yvette liebt ihre Kinder Daisy und Louis und das Nesthäkchen Violette, und versteht ihre Schwiegermutter Sybille in etwa. Am Himmel braut sich einiges zusammen, diese Überrumpelung mit der Verlobung von Daisy und Hugo Brandis , die Daisy wieder löst sie mag diesen abscheulichen Menschen nicht. Das dies einmal böse Folgen für sie und ihre Familie haben könnten ahnt keiner. Daisy und Mitzi , erleben in Berlin so manches schönes und übles Abenteuer, das sie in Unkalkulierbaren Gefahren bringen wird. Besonders die politischen Zeiten werden immer düsterer , ich hoffe die jungen Leute überleben das ganze, es konnte einem manchmal der Atem gefrieren, besonders bei der Begegnung mit diesem widerlichen Nazi Greiff . Amüsant wenn auch mit Ernsten Hintergrund fand ich die Taubstumme Oma Kulke, die es faustdick hinter den Ohren hat, ich konnte mir hin und wieder das Lachen über ihre Taten nicht verkneifen.
Der Roman ist ergreifend, spannend wie ein hervorragender Krimi. Es war wunderschön mit die jungen Leuten, auf ihren Streifzügen durch Berlin zu begleiten und zu hoffen das ihre Träume verwirklichen.
Wenigstens werden wir am Schluss mit einer Leseprobe für Band 2 Entschädigt.
https://www.lovelybooks.de/autor/Hanni-Münzer/Honigland-8989296183-w/rezension/10213447907/
http://www.lesejury.de/rezensionen/deeplink/760907/Product
https://www.buecher.de/go/my_my/my_ratings/
https://www.weltbild.de/konto/kommentare
https://www.thalia.de/bewerterprofil
https://www.buechereule.de/wbb/thread-add/406/
https://www.facebook.com/groups/1672928882728858/permalink/6675606435794386/
https://www.amazon.de/review/RRO0IPHHJE0CP/ref=cm_cr_srp_d_rdp_perm?ie=UTF8&ASIN=3492063969
Unter Mark zu finden