Produktbilder zum Buch
Weit über der smaragdgrünen See
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Brandon Sanderson ist es gelungen, kreativ fesselndes Worldbuilding [...] mit nahbaren und erfrischend inklusiven Charakteren zu vermischen.“
rezensöhnchen.deBeschreibung
Schon immer lebt Tress auf ihrer kargen Insel mitten in der smaragdgrünen See. Ein Ort, an dem die aufregendsten Dinge die Tassen sind, die Tress sammelt, und die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, den Geschichten ihres Freundes Charlie zu lauschen, der langsam mehr als ein Freund für sie wird. Als Charlie während einer gefährlichen Reise verschwindet, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihren Liebsten zu retten. Zahlreiche Gefahren warten auf sie – darunter Piraten, fremde, tödliche Meere und eine böse Hexe.…
Schon immer lebt Tress auf ihrer kargen Insel mitten in der smaragdgrünen See. Ein Ort, an dem die aufregendsten Dinge die Tassen sind, die Tress sammelt, und die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, den Geschichten ihres Freundes Charlie zu lauschen, der langsam mehr als ein Freund für sie wird. Als Charlie während einer gefährlichen Reise verschwindet, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihren Liebsten zu retten. Zahlreiche Gefahren warten auf sie – darunter Piraten, fremde, tödliche Meere und eine böse Hexe. Wird Tress über sich hinauswachsen und ihre große Liebe retten können?
Mit dem Crowdfunding für seine „Secret Projects“ erreichte Brandon Sanderson Anfang 2022 180.000 Leser:innen weltweit und nahm eine Rekordsumme von über 40 Mio. US-Dollar ein. „Weit über der smaragdgrünen See“ ist das erste dieser besonderen Bücher, das nun in deutscher Übersetzung erscheint.
Über Brandon Sanderson
Aus „Weit über der smaragdgrünen See“
1
Das Mädchen
Auf einem Felsen mitten im Ozean lebte ein Mädchen.
Der Ozean war nicht so, wie ihr euch das vorstellt.
Und auch der Felsen war nicht so, wie ihr ihn euch vorstellt.
Das Mädchen jedoch könnte durchaus so sein, wie ihr es euch vorstellt – falls ihr es euch nachdenklich, mit leiser Stimme und einer übergroßen Freude am Sammeln von Tassen vorgestellt habt.
Wenn Männer das Mädchen beschrieben, sagten sie häufig, seine Haare hätten die Farbe von Weizen. Andere meinten, sie hätten eher die Farbe von Karamell oder manchmal auch die Farbe von Honig. Das Mädchen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Sanderson hat ein durchaus modernes Märchen vorgelegt, das viele Themen streift, das sich abseits ausgetretener Pfade bewegt.“
phantastiknews.de„Wer vom Mainstream genug hat und eine ganz hinreißende, eigenwillige, humorige Geschichte lesen möchte, ist hier goldrichtig.“
phantastik-couch.de„Im Grunde eine Art modernes Märchen, gespickt mit allerlei Weisheit und Philosophie.“
monstersandcritics.de„Egal ob ihr bereits Brandon Sanderson Fans seid oder nur nach einem guten Fantasy-Roman voll wendungsreicher, teilweise verrückter Einfälle sucht, ›Weit über der smaragdgrünen See‹ kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen.“
leser-welt.de„Der Roman ist ein sehr gemütliches Buch, das man perfekt bei einer Tasse Tee lesen kann.“
idowa.de„Eine schöne Geschichte mit einer überraschenden Heldin.“
fantasyblogger.com„Der Roman [begeistert] mit skurrilen und liebenswerten Figuren, wichtigen Botschaften, kreativen Einfällen und einer spannenden und innovativen Welt.“
buecherbriefe.de„Ein völlig skurriles, dabei aber herrlich unterhaltsames, einfallsreiches und charmantes Piratenabenteuer in einer Science-Fiction-Welt mit Fantasy-Elementen wie Seemonstern, gefährlichen Sporen-Ozeanen, Geheimexperimenten, einem Drachen und einer bösen Zauberin. "Weit über der smaragdgrünen See" überzeugt mit liebenswerten Figuren, einer ungewöhnlichen Erzählperspektive, einem originellen Worldbuilding und einer fesselnden Handlung! “
WordWorld„Nach einigen überaus erfolgreichen Fantasy-Reihen hat Brandon Sanderson nun ein modernes Märchen verfasst, welches mit wunderschöner Sprache und einer liebenswerten Hauptfigur begeistert.“
Nordwest-Zeitung„Eine total schöne Geschichte.“
Niederbayern TV „Bücherecke“„Ein fantasievoller Fantasy- Roman, der in neue Welten trägt.“
Ludwigsburger Kreiszeitung„Brandon Sanderson [gelingt] das Kunststück, einen perfekten Standalone- und Einstiegs-Roman vorzulegen, den jeder lesen kann und alle genießen können.“
Doppelpunkt - Magazin für Kultur in Nürnberg - Fürth - Erlangen„Brandon Sanderson ist es gelungen, kreativ fesselndes Worldbuilding [...] mit nahbaren und erfrischend inklusiven Charakteren zu vermischen.“
rezensöhnchen.de
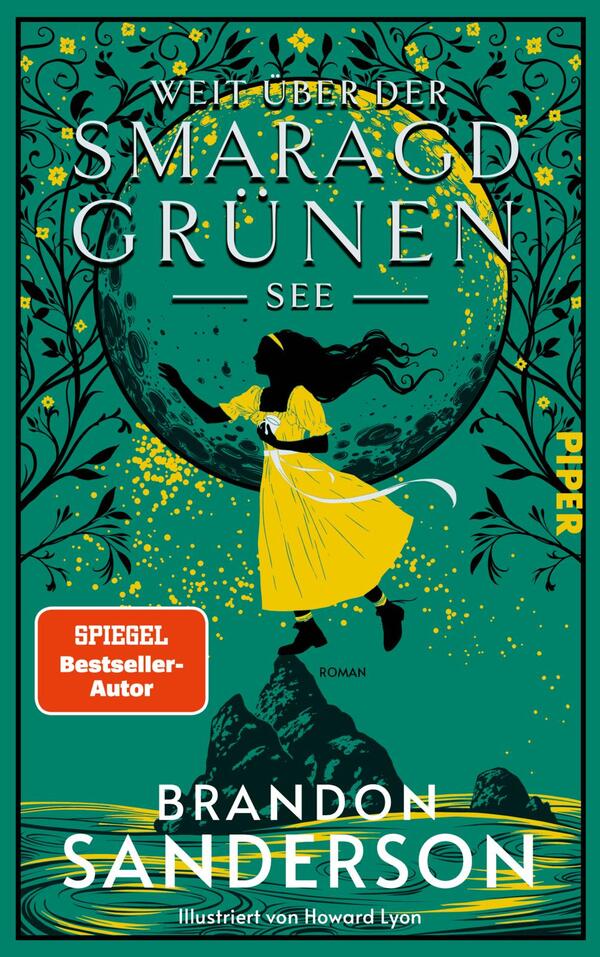
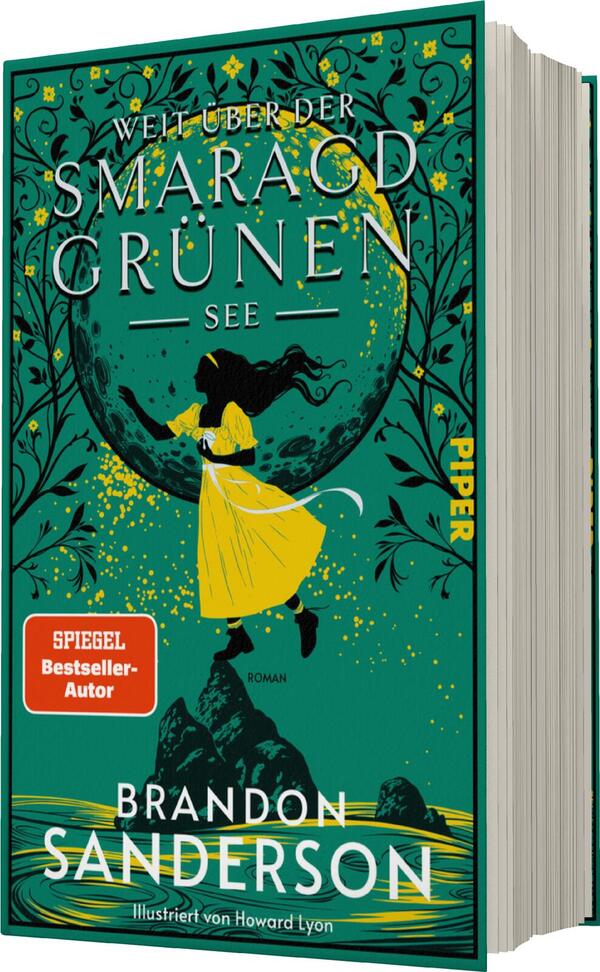
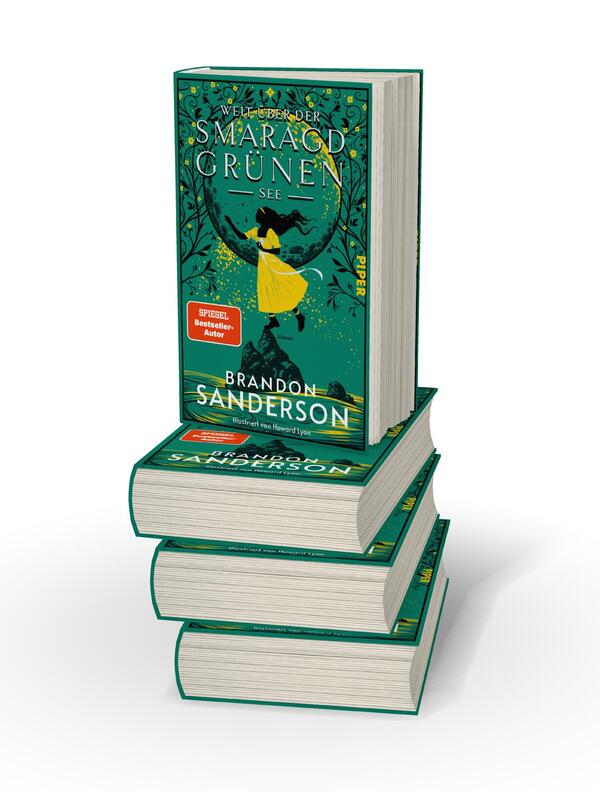

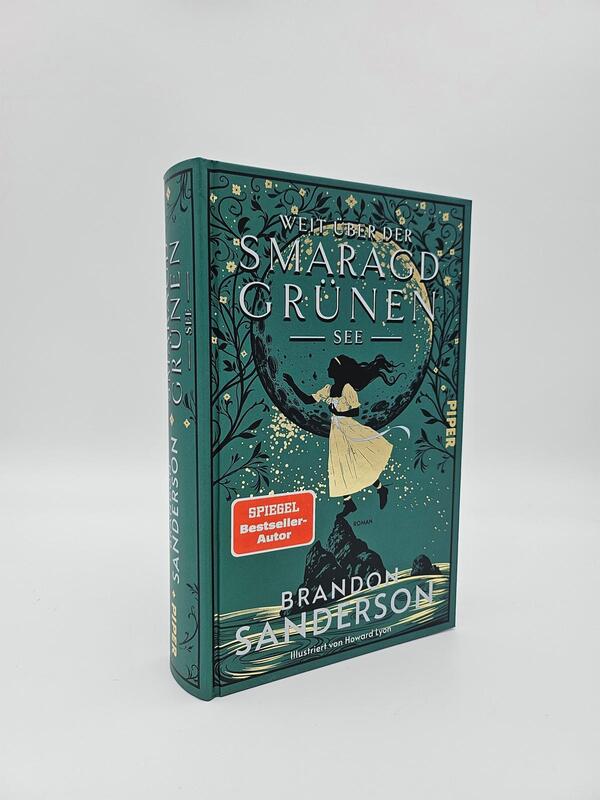














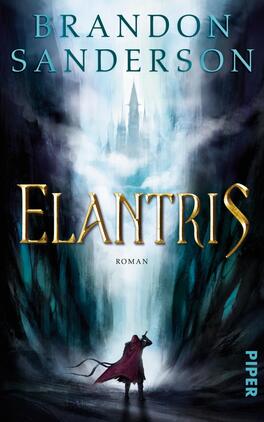

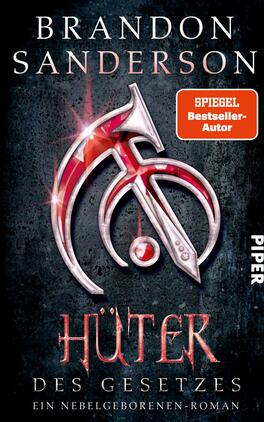
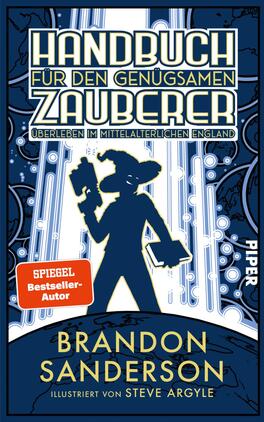

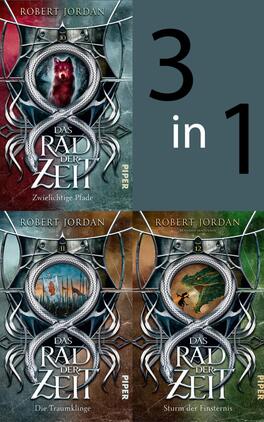








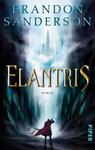


Die erste Bewertung schreiben