
Im Schatten des Syndikats (Lucy-Clayburn-Reihe 2) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Atemberaubende detailliert erzählte Verfolgungsjagden/Szenerien und eine gelungene spannende Reihe machen diesen Thriller aus“
wir-besprechens.deBeschreibung
Zunächst sieht es nach ganz gewöhnlichen Raubüberfällen und Morden aus, die Manchester in Atem halten. Doch schon bald findet die junge Polizistin Lucy Clayburn heraus, dass die Mordopfer allesamt Dreck am Stecken haben. Jemand hat es auf die Drahtzieher von Manchesters Unterwelt abgesehen – und auf Lucys Vater, den Chef des gefährlichsten Syndikats der Stadt. Schon bald sieht sich Lucy nicht nur mit dem schwierigsten Fall ihrer Karriere konfrontiert, sondern auch mit der Entscheidung, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen gehören will.
Weitere Titel der Serie „Lucy-Clayburn-Reihe“
Über Paul Finch
Aus „Im Schatten des Syndikats (Lucy-Clayburn-Reihe 2)“
Kapitel 1
Wenn man eine Kneipentour mit den Kumpels erfolgreich beenden will – wenn man es also schaffen will, sich wirklich in jedem Pub auf der geplanten Route einen Drink zu genehmigen –, gibt es vor allem ein Problem: Die Gruppe, mit der man losgezogen ist, löst sich unvermeidlich auf, bevor man im letzten Pub angekommen ist.
Klar, die Zechtour startet in der gewohnten Hochstimmung mit lautem Gejohle und gegenseitigem Schulterklopfen, während die aufgedrehte Horde krakeelend in die ersten Pubs einfällt. Doch im Laufe des Abends, wenn der Geräuschpegel steigt und [...]



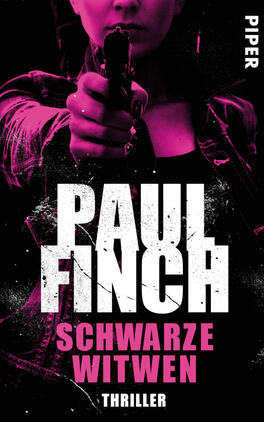



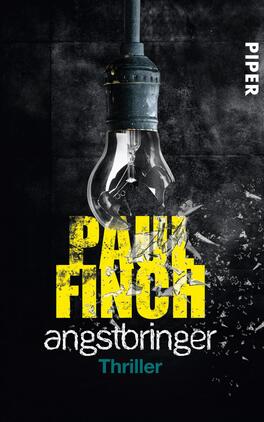

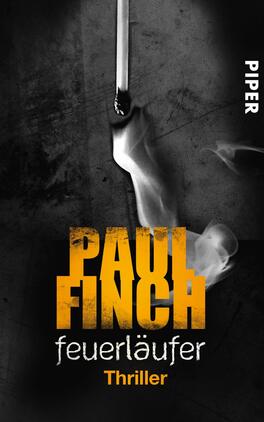


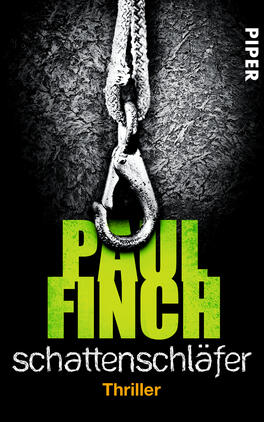





Die erste Bewertung schreiben