
Der Kuss des Jägers (Engel 2) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Für ihre Liebe haben Rafael und Sophie alles riskiert. Sie waren in der Hölle – und haben überlebt. Nun steht ihrer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg. Oder doch? Kann Sophie einen Engel lieben? Und Rafael einen Menschen? Was ist mit Jean, dem jungen Mann, der seine Freiheit aufs Spiel gesetzt hatte, um dem Paar bei seinem Kampf gegen den Dämon zu helfen? Er sitzt im Gefängnis, und einzig Rafael könnte ihn daraus befreien. Doch dann müsste Jean ein Leben auf der Flucht führen und Paris – und Sophie – verlassen. Denn Jean hat sich bereits bei der ersten Begegnung in die junge Frau verliebt.…
Für ihre Liebe haben Rafael und Sophie alles riskiert. Sie waren in der Hölle – und haben überlebt. Nun steht ihrer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg. Oder doch? Kann Sophie einen Engel lieben? Und Rafael einen Menschen? Was ist mit Jean, dem jungen Mann, der seine Freiheit aufs Spiel gesetzt hatte, um dem Paar bei seinem Kampf gegen den Dämon zu helfen? Er sitzt im Gefängnis, und einzig Rafael könnte ihn daraus befreien. Doch dann müsste Jean ein Leben auf der Flucht führen und Paris – und Sophie – verlassen. Denn Jean hat sich bereits bei der ersten Begegnung in die junge Frau verliebt. Bald muss Sophie eine folgenschwere Entscheidung treffen …
Weitere Titel der Serie „Engel“
Medien zu „Der Kuss des Jägers (Engel 2)“
Über Sarah Lukas
Aus „Der Kuss des Jägers (Engel 2)“
Prolog
Da ist jemand! Wie ein Blitz durchzuckte der Gedanke Sophies schlaftrunkenes Schweben. Ihr Herz pochte. Alarmiert schlug sie die Augen auf. Das Krankenhauszimmer lag in nächtlicher Dunkelheit. Im fahlen Licht der Mondsichel vor dem Fenster schimmerte ihr weißes Laken wie Schnee. Neben ihr ragte der Infusionsständer auf, ein dünner, metallisch glänzender Galgen, an dem noch der Strick baumelte. Nur das leise, gleichmäßige Atmen ihrer Bettnachbarin war zu hören. Das Mädchen hatte ein Schlafmittel bekommen und würde nicht erwachen – ganz gleich, was geschah.
Die [...]







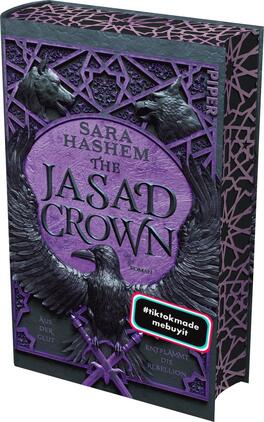

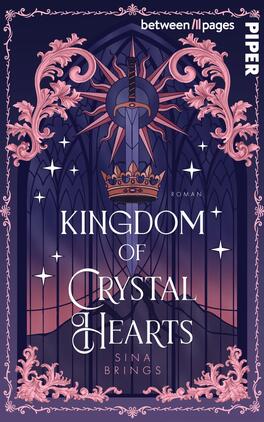

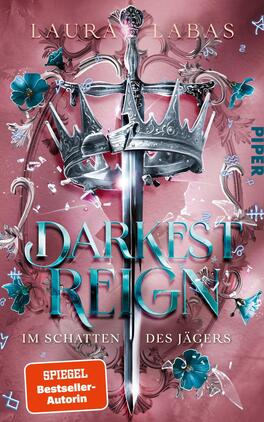
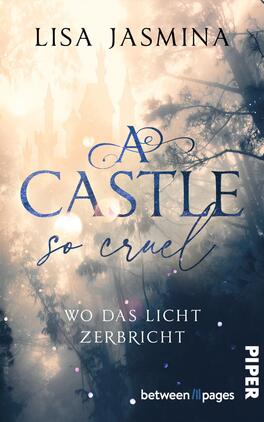

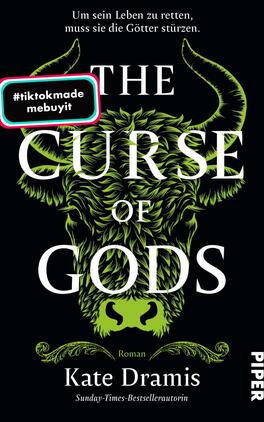




Die erste Bewertung schreiben