
Das Haus der leeren Zimmer - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Als Amy von ihrer Freundin Julia und deren kleiner Tochter um Hilfe gebeten wird, packt sie umgehend ihre Koffer und reist nach Somerset. Doch in dem düsteren Haus am See ist nichts so, wie es sein soll. Julia ist schwermütig, und die kleine Viviane hat kaum Spielgefährten. Bald beginnt das kleine Mädchen von einer unsichtbaren Freundin zu erzählen, Caroline. Doch Caroline ist auch der Name von Julias älterer Schwester, die im Haus der Familie unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Keiner der Dorfbewohner scheint über sie sprechen zu wollen – selbst der hilfsbereite Nachbar Daniel schottet…
Als Amy von ihrer Freundin Julia und deren kleiner Tochter um Hilfe gebeten wird, packt sie umgehend ihre Koffer und reist nach Somerset. Doch in dem düsteren Haus am See ist nichts so, wie es sein soll. Julia ist schwermütig, und die kleine Viviane hat kaum Spielgefährten. Bald beginnt das kleine Mädchen von einer unsichtbaren Freundin zu erzählen, Caroline. Doch Caroline ist auch der Name von Julias älterer Schwester, die im Haus der Familie unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Keiner der Dorfbewohner scheint über sie sprechen zu wollen – selbst der hilfsbereite Nachbar Daniel schottet sich ab …
Über Lesley Turney
Aus „Das Haus der leeren Zimmer “
Prolog
Blackwater, Somerset, Juli 1931
Es war ein wunderschönes Schmuckstück, eine zierliche Goldkette mit einem Anhänger in Gestalt zweier Hände, die zu einem Herzen geformt waren, und darin eingefasst ein von winzigen Diamanten umgebener Rubin.
„Er ist über hundert Jahre alt“, hatte Madam ein paar Wochen zuvor erklärt, „und äußerst wertvoll. Das Schmuckstück befindet sich schon seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie.“ Madams Schmuck, normalerweise sicher in einem Safe verschlossen, hatte ausgebreitet auf einem Samttuch auf dem Esszimmertisch gelegen, [...]




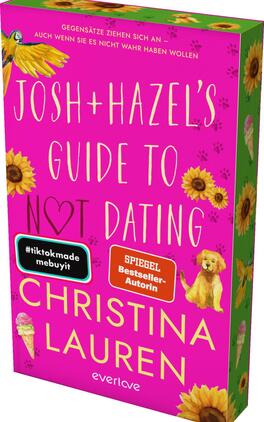




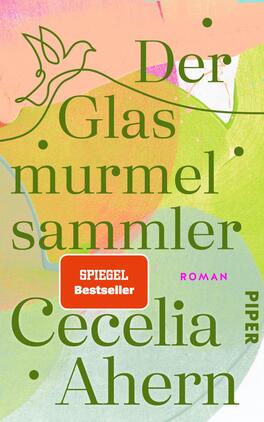









Die erste Bewertung schreiben