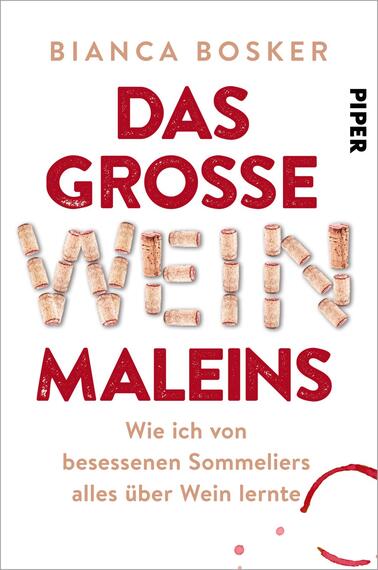
Das große Weinmaleins - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein exzellentes Expertenbuch für alle Weinliebhaber“
sanitaetshaus-aktuell.infoBeschreibung
Weintrinken will gelernt sein
Es gibt Menschen, die innerhalb von Sekunden aus einem Schluck Wein die Rebsorte, die Anbauregion, das Weingut und den exakten Jahrgang herausschmecken. Als Bianca Bosker eher zufällig von der Olympiade für Sommeliers hört, ist sie sofort fasziniert von deren geschmacklichem Können. Sie kündigt ihren Job und heftet sich ein Jahr an die Fersen der renommiertesten Weinkenner, um ihre Kunst zu erlernen. Als Leser erfahren wir im Zuge ihres Abenteuers, wie wir unseren Geschmackssinn mit Weinverkostung schulen können, was Orangensorten damit zu tun haben, wann Wein nach…
Weintrinken will gelernt sein
Es gibt Menschen, die innerhalb von Sekunden aus einem Schluck Wein die Rebsorte, die Anbauregion, das Weingut und den exakten Jahrgang herausschmecken. Als Bianca Bosker eher zufällig von der Olympiade für Sommeliers hört, ist sie sofort fasziniert von deren geschmacklichem Können. Sie kündigt ihren Job und heftet sich ein Jahr an die Fersen der renommiertesten Weinkenner, um ihre Kunst zu erlernen. Als Leser erfahren wir im Zuge ihres Abenteuers, wie wir unseren Geschmackssinn mit Weinverkostung schulen können, was Orangensorten damit zu tun haben, wann Wein nach Sattelleder schmeckt und dass Flaschenpreise von über 50 Euro kein Indikator für Qualität sind. Ein großes Lesevergnügen für alle Weinkenner und solche, die es werden wollen!
Über Bianca Bosker
Aus „Das große Weinmaleins“
Einleitung
Die Blindverkostung
Von Parfüm musste ich mich als Erstes verabschieden, aber das hatte ich nicht anders erwartet. Dann folgten parfümierte Waschmittel und schließlich Trocknertücher. Die Finger von rohen Zwiebeln oder scharfen Soßen zu lassen machte mir nichts aus. Kein Salz ins Essen zu tun war zunächst hart, dann eine Zeit lang erträglich und danach zum Heulen. Wenn ich auswärts aß, schmeckte alles so, als ob es in Salzlauge getaucht worden war. Den Mund nicht mehr mit Listerine zu spülen war nicht so tragisch; stattdessen Zitronensäurelösung und mit [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Viele Fragen, die sich jeder Weintrinker schon gestellt hat, werden beantwortet. Weinliebhaber und auch solche, die es werden möchten, finden in diesem Buch vinophile Informationen in einer tollen Mischung, die einen das Buch nicht aus der Hand legen lassen. Höchstens – um sich ein Gläschen Wein zu holen.“
gourmetreisen.twoday.net„Ein exzellentes Expertenbuch für alle Weinliebhaber“
sanitaetshaus-aktuell.infoDie Blindverkostung
1 Die Ratte
2 Der Geheimbund
3 Der Showdown
4 Der Grips
5 Das Zauberreich
6 Die Orgie
7 Die Qualitätskontrolle
8 Die zehn Gebote
9 Der Auftritt
10 Die Prüfung
11 Das Kellnern
Die blindeste Verkostung von allen
Danksagung
Bibliografie (Auswahl)
Register




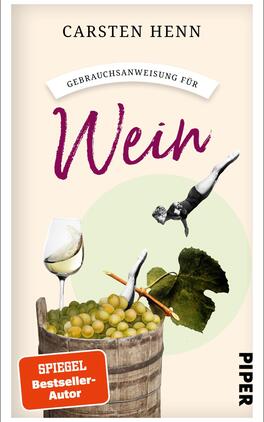

Die erste Bewertung schreiben