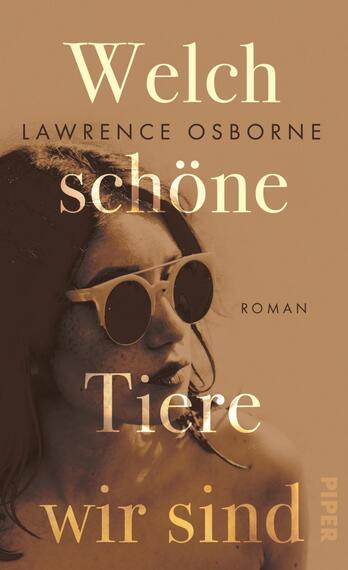
Welch schöne Tiere wir sind - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein Roman unserer Zeit.“
Münchner MerkurBeschreibung
Eine brillante Studie über Schuld und Gier
Fesselnd, dicht und abgründig – ein literarisches Meisterwerk
Die Luft scheint stillzustehen an diesem heißen Sommertag auf der griechischen Insel Hydra. Dort verbringt Naomi die Ferien in der Residenz ihres Vaters, einem englischen Kunstsammler. Gemeinsam mit der jüngeren Sam entdeckt sie bei einem Küstenspaziergang etwas Ungeheuerliches: Ein bärtiger, ungepflegter Mann liegt auf den Steinen, ein Geflüchteter aus Syrien, Faoud. Für Naomi die perfekte Gelegenheit, es ihrem Vater heimzuzahlen – für seinen obszönen Reichtum, seine hohlen Allüren, seine…
Eine brillante Studie über Schuld und Gier
Fesselnd, dicht und abgründig – ein literarisches Meisterwerk
Die Luft scheint stillzustehen an diesem heißen Sommertag auf der griechischen Insel Hydra. Dort verbringt Naomi die Ferien in der Residenz ihres Vaters, einem englischen Kunstsammler. Gemeinsam mit der jüngeren Sam entdeckt sie bei einem Küstenspaziergang etwas Ungeheuerliches: Ein bärtiger, ungepflegter Mann liegt auf den Steinen, ein Geflüchteter aus Syrien, Faoud. Für Naomi die perfekte Gelegenheit, es ihrem Vater heimzuzahlen – für seinen obszönen Reichtum, seine hohlen Allüren, seine unerträgliche neue Frau. Doch als sie Faoud dazu anstiftet, bei ihrem Vater einzubrechen, hat das fatale Folgen.
Über Lawrence Osborne
Aus „Welch schöne Tiere wir sind“
EINS
Hoch oben am Berghang über dem Hafen verschliefen die Codringtons die trockenen Junimorgen in ihrer von Zypressen und über den Türen hängenden Markisen verdunkelten Villa. In pyjamagewandeter Pracht lagen sie inmitten ihrer byzantinischen Ikonen, umgeben von Gemälden hydriotischer Kapitäne, und wussten nicht, dass ihre Tochter begonnen hatte, frühmorgens schwimmen zu gehen, dass sie sich eine Stunde vor Sonnenaufgang in der Kühle ihres Zimmers ankleidete, halb gespiegelt in einem antiken Kippspiegel. Sie zog ein Batisthemd mit Umschlagmanschetten an, legte eine [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Osbornes ›Welch schöne Tiere wir sind‹ trifft ins Herz der aktuellen Debatte.“
Madame„Abgründig.“
Hörzu„Der gewiefte Stilist Osborne - man vergleicht ihn mit Paul Bowles und Graham Greene - ... beschreibt die Rituale und Riten der Reichen, die sich (in Hydra) neben den Einheimischen tummeln. So intensiv und kenntnisreich, dass man beim Lesen nicht einmal Leonard Cohens Songs zur Untermalung abspielen muss.“
Die Welt„ ›Welch schöne Tiere wir sind‹ ist ausgesprochen gut konturiert, spannend, abgründig und auch boshaft … Viel mehr als an politischen Gegebenheiten ist Osborne an den psychologischen Abgründen seiner Figuren gelegen. Diese beleuchtet er mit kühlem Blick und meisterhaft.“
literaturreich.blog„Osborne liest sich wie eine faszinierende Mischung aus Edward St. Aubyn und Patricia Highsmith – wer für diesen Sommer noch keine spannende, mediterrane Urlaubslektüre hat, sollte zugreifen, auch wenn er diesen nicht auf Hydra verbringt.“
in-muenchen.de„Das Buch hat eine raffinierte psychologische Note.“
arttv.de„Lawrence Osborne holt die Geschichte von Odysseus und Nausikaa in die Gegenwart.“
Süddeutsche Zeitung„Empfehlenswert.“
Madonna„Wie in den Alltagstragödien von Patricia Highsmith oder Georges Simeon genügen hier kleine Fehltritte oder ein unter günstigeren Umständen sogar folgenloses Laster, um Menschen in die Bredouille zu bringen. Zugleich unterläuft Osborne die Regeln der Eskalationsdramatik. Selbst angesichts härtester Schicksalsschläge bleibt das Handeln aller Beteiligten unvorhersehbar. Einladungen zur Empathie bekommt man hier kaum, wohl aber Einblicke in die abgründige Natur des Menschen.“
Kölner Stadt-Anzeiger„Das brisante Thema Migration greift Osborne aus einem völlig anderen Blickwinkel auf und rückt es, anscheinend locker und leicht, in ein düsteres Licht. Entlarvend, fintenreich.“
Kleine Zeitung„Lawrence Osborne komponiert auch in diesem Roman mit einer sehr differenzierten Sprache … einen furiosen Krimi, der einen nicht mehr loslässt. … ›Welch schöne Tiere wir sind‹ braucht den Vergleich mit der Meisterin der Spannungsliteratur, Patricia Highsmith, nicht zu scheuen.“
Freie Presse„eine perfekte, anspruchsvolle Sommerlektüre.“
Bolero„Ein Roman unserer Zeit.“
Münchner Merkur



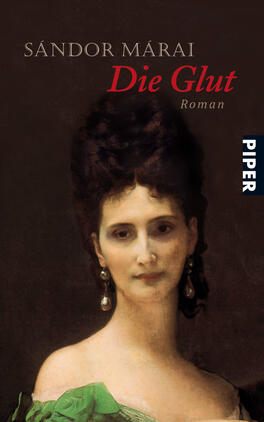
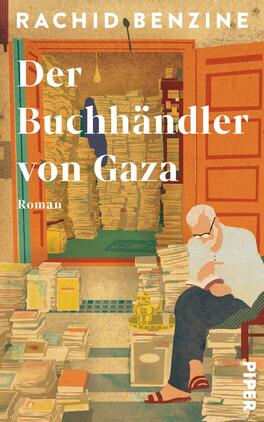
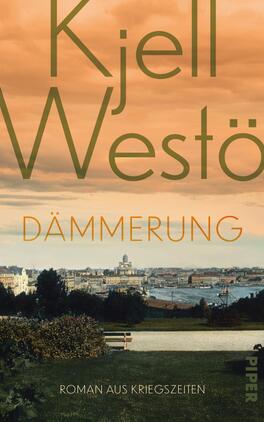

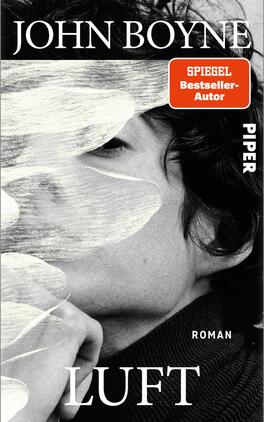

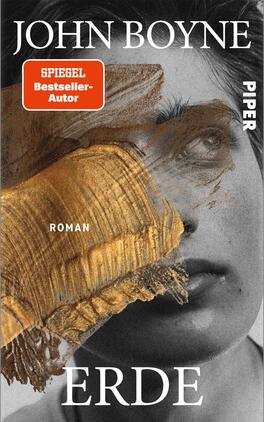
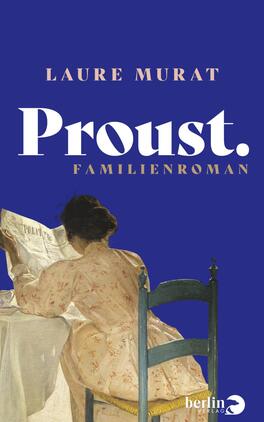
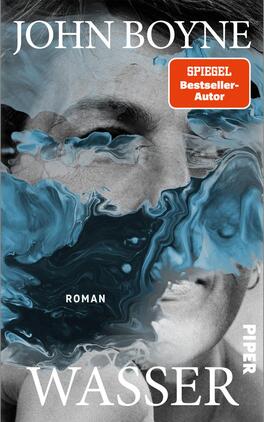
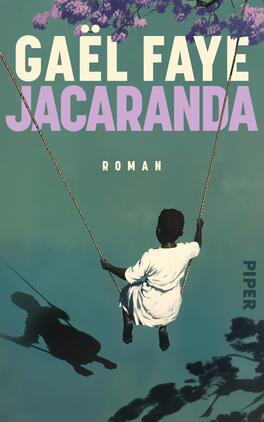





Die erste Bewertung schreiben