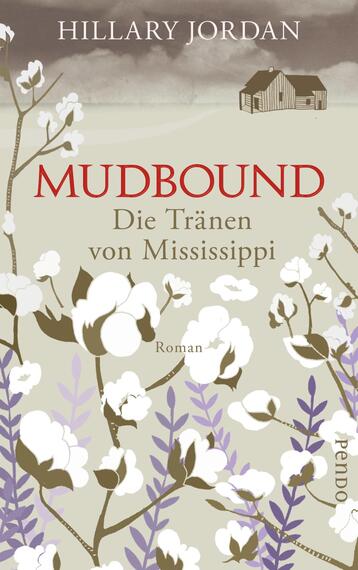
Mudbound – Die Tränen von Mississippi - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine bewegende, dramatische, tragische und nachhaltig beeindruckende Südstaatengeschichte. Ein lesenswertes, tolles Buch (…).“
narrenstempelei.blogspot.comBeschreibung
Mississippi, 1946: Laura McAllan ist ihrem Ehemann zuliebe aufs Land gezogen, der als Farmer einer Baumwollplantage Fuß fassen will. Doch ihr ist die Umgebung fremd, und auf Mudbound gibt es weder fließendes Wasser noch Strom. Unterstützung erhalten die McAllans durch die Jacksons, ihre afroamerikanischen Pächter. Die aufgeweckte Florence Jackson hilft Laura, wo sie nur kann. Aber auch wenn der Alltag sie an ihre Grenzen treibt und sie für gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen ist, würde sie es nicht wagen, ihre Stimme zu erheben und Missstände anzumahnen. In diese angespannte Situation…
Mississippi, 1946: Laura McAllan ist ihrem Ehemann zuliebe aufs Land gezogen, der als Farmer einer Baumwollplantage Fuß fassen will. Doch ihr ist die Umgebung fremd, und auf Mudbound gibt es weder fließendes Wasser noch Strom. Unterstützung erhalten die McAllans durch die Jacksons, ihre afroamerikanischen Pächter. Die aufgeweckte Florence Jackson hilft Laura, wo sie nur kann. Aber auch wenn der Alltag sie an ihre Grenzen treibt und sie für gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen ist, würde sie es nicht wagen, ihre Stimme zu erheben und Missstände anzumahnen. In diese angespannte Situation geraten zwei junge Kriegsheimkehrer: Florences Sohn Ronsel und Lauras Schwager Jamie. Deren Freundschaft wird zu einer Herausforderung für beide Familien, und so lassen Missgunst und Ausgrenzung die Stimmung bald kippen ...
Medien zu „Mudbound – Die Tränen von Mississippi“
Über Hillary Jordan
Aus „Mudbound – Die Tränen von Mississippi“
Henry und ich gruben ein gut zwei Meter tiefes Loch. Wäre es flacher gewesen, wäre die Leiche wahrscheinlich durch die nächste starke Überschwemmung nach oben gespült worden: Hallo, Leute! Da bin ich wieder. Diese Vorstellung ließ uns weitergraben, obwohl die Blasen an unseren Handflächen aufplatzten, neu entstanden und sich wieder öffneten. Jede Schaufel voll war eine Qual – der alte Mann wischte uns zum letzten Mal eins aus. Trotzdem machten mich die Schmerzen froh. Sie vertrieben Gedanken und Erinnerungen.
Als das Loch so tief war, dass unsere Schaufeln nicht [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Hillary Jodan ist ein bewegendes Südstaatendrama gelungen, das dem Leser viel abverlangt, aber noch lange im Gedächtnis bleiben wird.“
madeofstil.com„›Mudbound‹ ist kein leichtes Buch, das man schnell nebenbei herunterliest und direkt wieder vergisst. Es erschüttert, schockiert, bewegt, fesselt und unterhält zugleich.“
legimus.de„Ein kluges, emotionales, dichtes Buch über Angst, Hass und Liebe.“
klappentextmag.de„Ein großartiges und vor allem wichtiges Buch (...). Hillary Jordan beweist, dass historische Romane auch auf unter 400 Seiten spannend, informativ und mitreißend sein können.“
eulenmatz-liest.com„Ein sprachgewaltiges, aufwühlendes Porträt zweier Südstaaten-Familien in den 1940er-Jahren.“
GLAMOUR„Ein faszinierender Roman, übrigens toll verfilmt derzeit auf Netflix zu sehen.“
Donna„Entwickelt einen Lesesog, nimmt den Leser gefangen, besticht durch lebendige Charaktere und ist unheimlich intensiv zum Lesen.“
Buchraettin auf lovelybooks.de„Eine bewegende, dramatische, tragische und nachhaltig beeindruckende Südstaatengeschichte. Ein lesenswertes, tolles Buch (…).“
narrenstempelei.blogspot.com




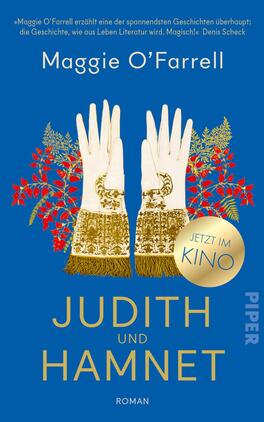

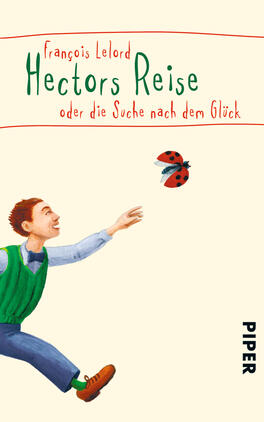


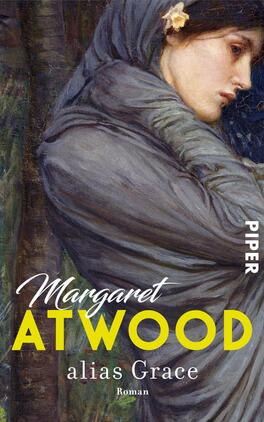

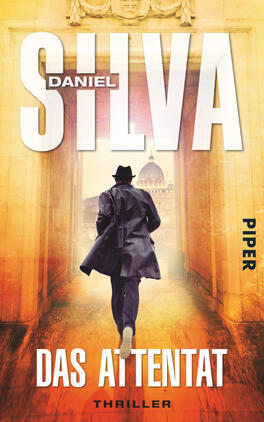


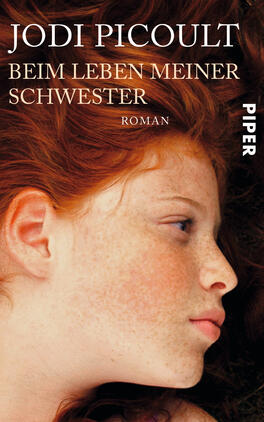



Die erste Bewertung schreiben