
Mein Blockhaus in Kanada
Wie ich mir den Traum von Wildnis und Einsamkeit erfüllte
Mein Blockhaus in Kanada — Inhalt
Ein Winter in British Columbia
2017/2018 erfüllte sich Carmen Rohrbach einen lang gehegten Traum und lebte mehrere Monate in einem Holzhaus fernab der Zivilisation, an einem See mit glasklarem Wasser, umkränzt von felsigen Bergen. Fesselnd berichtet sie von den Vorbereitungen und Schwierigkeiten ihres Abenteuers. Sie beschreibt, wie sie schon als Kind fasziniert war von den Geschichten über Trapper, Holzfäller und Goldsucher im ungezähmten Norden Amerikas. Wie sie auf ausgedehnten Wanderungen die Wildnis erkundete und schließlich mehrere Wintermonate in völliger Isolation bei bis zu minus 48 Grad verbrachte, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. Auf mitreißende Art lässt sie uns an ihren intensiven Erfahrungen und Wahrnehmungen, ihren Beobachtungen und Gedanken teilhaben.
Leseprobe zu „Mein Blockhaus in Kanada“
Prolog: Stimme der Wildnis
Kein Geräusch ist zu hören, kein Vogelruf durchbricht die Stille. Diese Lautlosigkeit erfüllt mich mit gespannter Erwartung. Seit dem frühen Morgen sitze ich am Ufer des Rainbow Lake in British Columbia, der nordwestlichen Provinz Kanadas, und stelle mir vor, ein Elch tritt mit seinem langnasigen Kopf und dem ausladenden Schaufelgeweih aus dem Wald heraus und zieht gemächlich zum Äsen in die sumpfigen Wiesen. Vielleicht taucht auch ein Wolf auf, der seinen Durst am Wasser stillt, oder sogar ein Schwarzbär. Nichts von alledem [...]
Prolog: Stimme der Wildnis
Kein Geräusch ist zu hören, kein Vogelruf durchbricht die Stille. Diese Lautlosigkeit erfüllt mich mit gespannter Erwartung. Seit dem frühen Morgen sitze ich am Ufer des Rainbow Lake in British Columbia, der nordwestlichen Provinz Kanadas, und stelle mir vor, ein Elch tritt mit seinem langnasigen Kopf und dem ausladenden Schaufelgeweih aus dem Wald heraus und zieht gemächlich zum Äsen in die sumpfigen Wiesen. Vielleicht taucht auch ein Wolf auf, der seinen Durst am Wasser stillt, oder sogar ein Schwarzbär. Nichts von alledem geschieht, dennoch langweile ich mich nicht. Mich durchströmt ein Glücksgefühl, hier sein zu dürfen, in einem der letzten, vom Menschen unbeeinflussten Wildnisgebiete unserer Erde.
Auf einmal schwebt ein sehnsuchtsvoller Laut über das Wasser, eine weithin tönende, melancholische Klage, ein schaurig-schöner Klang. Es ist die Stimme des Eistauchers, des loon, wie er in Kanada genannt wird. Die rauen und zugleich weich schwingenden Töne dieser Vögel scheinen wie für diese karge, weltabgeschiedene Landschaft geschaffen und verstärken das Gefühl von Einsamkeit. Der wildromantische Gesang des Eistauchers ergreift mich tief und lässt mein Herz schneller schlagen.
Bald werden diese Töne nicht mehr zu hören sein. Die Eistaucher fliegen im Spätsommer zu den südlich gelegenen Küsten des Pazifiks und Atlantiks, denn die Seen im Norden sind im Winter mit meterdickem Eis bedeckt. Aber gerade dann, im Winter, will ich wiederkommen, um während der kältesten Jahreszeit in einer einsam gelegenen Blockhütte zu überwintern.
Schon lange bewegt mich dieser Gedanke, eigentlich seit meiner Jugend, als fast all meine Reisesehnsüchte entstanden sind. Wie viele junge Menschen haben mich die Abenteuerbücher von Jack London, Friedrich Gerstäcker und Joseph Conrad inspiriert, spannende Beschreibungen wilder Natur, Geschichten von Goldsuchern, Holzfällern und Trappern. Diese Sehnsüchte nach der Wildnis haben mich nie verlassen, und so war ich mir sicher, irgendwann würde ich meinen Traum verwirklichen.
Wie aber sollte ich „mein“ Blockhaus in diesem riesigen Land finden? Kanada ist mit fast zehn Millionen Quadratkilometern der weltweit zweitgrößte Staat nach Russland. Meinen ersten Gedanken, mit einem Mietwagen das Land zu durchstreifen, verwarf ich gleich wieder. Mir war klar, die grandiose Landschaft von der Straße aus zu sehen würde mich traurig machen, weil ich sie nicht mit all meinen Sinnen erfassen, mich ihr nicht Schritt für Schritt nähern könnte. Auto und Wildnis, das sind zwei Begriffe, die für mich unvereinbar sind. Zudem sollte mein Domizil nicht über eine Straße erreichbar, also rundum von unbeeinflusster Natur umgeben sein, ohne elektrischen Strom, ohne Internetverbindung, heizbar mit selbst gehacktem Holz, Wasser aus dem Eisloch eines Sees. Gab es so eine Hütte überhaupt noch? Ja, früher, in den Zeiten der Fallensteller und Pelzhändler, also zu Jack Londons Zeiten, da mag es solche primitiven Hütten gegeben haben. Sie waren sicher längst in Einzelteile zerfallen und vom Urwald überwuchert.
Meinen Wunsch hatte ich fast aufgegeben, da las ich in dem Buch „Das Schneekind“ von Nicolas Vanier, einem französischen Abenteurer, dass er im Jahr 1994 an einem Bergsee eine Blockhütte gebaut hatte. Der See liegt in den Cassiar-Bergen, die zu den Rocky Mountains gehören. Die Fotos im Buch und die Landschaftsbeschreibung des Autors bestärkten mich darin, genau dies könnte mein Überwinterungsort sein. Die waldreiche Gegend, der kristallklare See, umkränzt von felsigen Bergen mit schneebedeckten Gipfeln, all das entsprach meinen Vorstellungen. Ich spürte, dass ich mich bereits aus der Ferne in das Holzhaus am Seeufer verliebt hatte. Mein Traumbild von einer Blockhütte existierte also in Wirklichkeit. Seltsam, als hätte der Abenteurer meine geheimen Sehnsüchte gekannt, hatte er meine inneren Bilder verwirklicht.
Fast 25 Jahre waren vergangen, seit das Blockhaus gebaut wurde. Nicolas Vanier wohnte schon lange nicht mehr dort, er hatte sich anderen Abenteuern zugewandt. Auf den Fotos im Buch konnte ich erkennen, dass die Unterkunft aus massiven Baumstämmen gefertigt war, mit einem stabilen Satteldach und einer Veranda mit Blick zum See. Allerdings, wenn kein Mensch in der Hütte lebte und für ihren Erhalt sorgte, war sie sicherlich von Schneelasten im Winter beschädigt, vom Sturm zerfleddert, von hungrigen Bären eingedrückt, von Stachelschweinen und anderen Tieren zernagt worden. Doch wer weiß, vielleicht existierte sie noch?
Zunächst besorgte ich mir eine Karte vom Gebiet der Cassiar-Berge. Vergeblich suchte ich darauf den See, denn Nicolas Vanier hatte ihm einen anderen Namen gegeben, um die unberührte Natur vor Nachahmern zu schützen. Thukada Lake hat er ihn genannt, und diese Bezeichnung will ich beibehalten. Er hat in seinem Buch keine einheimischen Helfer erwähnt, doch ich war überzeugt, es musste sie geben. Woher sonst hätte er die Pferde gehabt, mit denen er von der Ortschaft Prince George in das unbesiedelte Gebiet gezogen ist? Zudem brauchte er Ausrüstung und Werkzeug zum Hüttenbau und Hilfe bei der Dachkonstruktion.
Ich begann also meine Nachforschungen in Prince George und fand den ehemaligen Trapper John, mit dessen Pferden der Franzose zum Thukada Lake geritten war. Und welch Glück – Vaniers Hütte war noch intakt, und John organisierte jährlich Wander- und Reittouren dorthin.
Mit John stand ich mehrere Monate lang in Kontakt, und wir einigten uns, dass ich im Sommer bei ihm eine Wandertour vom Blue Lake zum Blockhaus am Thukada Lake für mich und meinen Freund Helmut buchen würde, damit ich meine Entscheidung für die Überwinterung überdenken und mir ein Bild von der Gegend und der Hütte machen konnte. Wichtiger noch, John und der Chief der Tsay Keh Dene – ein Stamm der First Nations, wie die Ureinwohner hier genannt werden – wollten mich kennenlernen und prüfen, ob ich für das Unternehmen geeignet wäre, und mir, bei positivem Eindruck, ihre Erlaubnis und Unterstützung geben. Die Hütte befindet sich auf indigenem Gebiet, und daher durfte ich nur mit der Genehmigung des Stammes im Blockhaus wohnen. Zudem musste die Administration des kanadischen Staats informiert und deren permit eingeholt werden.
John wollte alles für mich regeln. Also meldeten wir uns für die Sommerwanderung an. Bis zuletzt wussten wir nicht, was genau uns erwarten würde.
Teil 1
Wildnistour im Sommer
Eine Stadt entsteht durch die Eisenbahn
Smithers liegt im fruchtbaren Tal des lebhaft strömenden Bulkley River und schmiegt sich an bewaldete Berge, die von den felsigen Gipfeln des 2589 Meter hohen Hudson Bay Mountain gekrönt werden. Bis 1913 herrschte hier undurchdringliche Wildnis. Erst als die transkontinentale Zugverbindung der Grand Trunk Pacific Railway Company von Ost nach West durch das Land gezogen wurde, entstand hier ein wichtiger Knotenpunkt, der genau zwischen den beiden schon damals existierenden Orten Prince George und Prince Rupert lag. Arbeiter kamen von überallher, auch aus Europa und Asien, halfen beim Trassenbau, manche blieben und siedelten sich an. Smithers würde wohl kaum existieren, wäre die Eisenbahn nicht gebaut worden. Inzwischen leben etwa 5400 Einwohner in dem Gebirgsort und 20 000 in der näheren Umgebung in land- und forstwirtschaftlichen Gemeinden und auf einzelnen Farmen.
Die Leute, die der Eisenbahnbau angelockt hatte, waren aber nicht die ersten Menschen im Bulkley Valley. Seit Jahrtausenden war es das Heimatgebiet des indigenen Stammes der Wet’suwet’en, die noch heute in sechs Gemeinden hier leben. Der Stammesname bedeutet „Menschen der niedrigen Berge“.
Nach fast elfstündigem Flug hatten wir gegen Abend Vancouver erreicht, aber noch immer war es der gleiche Tag, denn die Zeitverschiebung beträgt neun Stunden. Wir waren also stets der Sonne vorausgeflogen, ohne dass es Nacht wurde. Ich fand es faszinierend, am Bordbildschirm die Flugstrecke zu betrachten und zu sehen, wie sich die Erde hinter dem Flugzeug verdunkelte. Fast gespenstisch sah es aus, als würden wir von einem dunklen Schatten verfolgt.
Am nächsten Morgen fliegen wir weiter nach Smithers. Den Ort habe ich nicht aus eigenem Interesse gewählt, sondern weil wir vom Buschflieger von hier in die Wildnis geflogen werden. In der Flughafenhalle werden wir von einem ausgestopften Grizzly begrüßt. Vor neugierigen Berührungen der Menschen sicher, steht er aufgerichtet in einem Glaskasten. Ein wahrhaft imposantes Tier, furchteinflößend, wenn er nicht schon tot wäre. Erlegt wurde er von zwei Offizieren der kanadischen Parkverwaltung, um die Rinder der Farmer zu schützen. „Phantom of the Hungry Hill“ wurde der Bär genannt, der drei Jahre lang seine Verfolger narrte, jeder Falle auswich und sich nie bei Büchsenlicht blicken ließ. Immer dichter zog sich der Kreis der Fallen, den seine Verfolger aufstellten. Er aber, der mächtige Grizzly, schaffte es, die als Köder ausgelegten toten Kälber zu fressen, ohne dabei in die Fallen zu geraten. Mehr als 30 Rinder soll er innerhalb von drei Jahren getötet haben. Dann, im Oktober 2001, schlug seine Schicksalsstunde. Eine seiner Pfoten war in eine Eisenschlinge geraten. Das kluge, misstrauische Tier, das bis dahin allen Nachstellungen entgangen war, sie geschickt erspürt hatte, war gefangen. Fast hätte der Bär es geschafft, den Draht durchzubeißen, doch da näherten sich die beiden Offiziere. Mit einem gewaltigen Ruck zerriss er die Fessel und stürzte sich auf seine Feinde. Wenige Schritte vor ihnen brach der 460 Kilogramm schwere Koloss im Kugelhagel zusammen.
Diese Geschichte und der imposante Bär stimmen mich auf Kanadas Abenteuer ein. Zunächst aber geht es nicht in die Wildnis, sondern in bewohnte Gegenden. Während der Taxifahrt vom Flughafen nach Smithers, wo wir eine Nachricht erwarten, wie es am nächsten Tag weitergehen wird, erklärt uns der Fahrer mit düsterer Stimme: „Diese Straße wird ›Highway der Tränen‹ genannt. Seit Jahren verschwinden hier junge Frauen, die per Anhalter unterwegs sind, manchmal findet man irgendwann die Leichen. Mindestens 43 Mädchen sind schon umgebracht worden, vermutlich sogar mehr.“
„Hat man denn nie einen Verdächtigten gefasst?“, fragt Helmut.
„Wie denn?“, antwortet Jim. „ Die Frauen sind tot. Sie können nicht mehr sprechen. Im Jahr 1969 hat man das erste ermordete Mädchen gefunden, und bis heute dauert das Morden an. Es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Mörder, sondern mehrere. Meist waren die Opfer sehr jung, das jüngste erst 14 Jahre alt, und fast alle indigener Herkunft. Ein Mädchen habe ich flüchtig gekannt. Ihre Leiche fand man hier in der Nähe des Flughafens.“
Ich blicke aus dem Autofenster. Die Landschaft spiegelt nicht die Schrecken wider, die sich hier seit Jahren abspielen. Da sprudelt ein idyllischer Bergbach neben der Straße, auf einer saftigen Wiese weiden Pferde, aber dann kommen wieder Abschnitte mit dichten Wäldern, keine Ortschaft weit und breit. Niemand, von dem man in der Not Hilfe erwarten könnte. Wenn wir kurz halten würden und jemand stiege ein, würde es keiner bemerken.
„Man hat Schilder aufgestellt“, erzählt Jim weiter. „Dort ist eins, lest selbst.“
Girls don’t Hitchhike on the Highway of Tears. Killer on the Loose!
„Wenn die indigenen Frauen von ihren Siedlungen in die Stadt zum Einkaufen wollen, müssen sie per Anhalter fahren, denn es gibt keine Busse oder andere öffentliche Verkehrsmittel“, erläutert der Taxifahrer.
Die Straße wird auch Yellowhead Highway genannt, nach dem Pass, der an der Grenze zu Alberta über die Rocky Mountains führt, lese ich später in einem Reiseführer. Als Route 16 erstreckt sie sich über 2687 Kilometer von Winnipeg im Osten bis nach Prince Rupert an der Pazifikküste. An die gewaltigen Entfernungen in diesem Land muss ich mich erst gewöhnen.
Gebaut wurde der Highway von der Hudson’s Bay Company, um den wilden Westen Kanadas zu erschließen. Lange hat es gedauert, die Rocky Mountains zu überqueren. Erst 1970 wurde der letzte Streckenabschnitt geschafft, und die Straße konnte eingeweiht werden. Die Hudson’s Bay Company, deren Hauptquartier in der Hudson Bay lag, ist das älteste Handelsunternehmen Kanadas. Sie wurde bereits 1670 gegründet und mit einem Privileg des damaligen englischen Königs ausgestattet. Über Jahrhunderte beherrschte die Hudson’s Bay Company den Pelzhandel, baute ein Netzwerk von Handelsposten auf und intensivierte die Beziehungen zu den Angehörigen der First Nations, die ihnen die Pelze lieferten. Prinz Ruprecht von der Pfalz war erster Direktor der Gesellschaft, nach ihm erhielt die Ortschaft am Pazifik ihren Namen. Noch öfter werde ich während meines Aufenthalts in Kanada feststellen, dass wichtige Personen der frühen Zeit sich mit ihrem Namen in Ortschaften, Flüssen und Seen verewigt haben.
Smithers gefällt mir sofort. Vor allem seine Lage in den Bergen, überragt von hohen Felsgipfeln, begeistert mich. Die übersichtlich angelegte Ortschaft mit nur einer einzigen Einkaufs- und Geschäftsstraße ist schnell erkundet. Auffallend sind die zahlreichen Restaurants, Bars und Hotels, denn Smithers ist ein beliebter Ausflugsort für Kanadier und wird im Winter zur Skisaison stark besucht.
Mehr als die Einkaufsstraße mit ihren Geschäften interessiert mich die Geschichte der Ortschaft. Um mehr über sie zu erfahren, bietet sich das Bulkley-Museum an, untergebracht in einem historischen Gebäude, das im Jahr 1925 erbaut wurde. Da Nordwestkanada erst spät erforscht und in Besitz genommen wurde, gelten Gebäude und Erinnerungsstücke aus dem 20. Jahrhundert als historisch. In den Räumen, die früher die Wohnräume des Gouverneurs sowie die Verwaltung, die Polizeistation und das Gefängnis beherbergten, sind Fotos aus vergangenen Tagen, Steine, Fossilien und Mineralien, indigene Folklore und Ausstellungen lokaler Künstler zu besichtigen. Ein Raum widmet sich dem Eisenbahnbau. Nach Sir Alfred Smithers, dem Direktor der Eisenbahngesellschaft, die ihr Hauptquartier hier hatte, wurde die Ortschaft benannt. Der Name des 220 Kilometer langen Bulkley River, der bei den Einheimischen Wetzin Kwa hieß und an dessen Ufer die Neusiedler ihre Häuser bauten, stammt von Colonel Charles Bulkley, einem Ingenieur, der die Installation einer Telegrafenleitung vermaß und beaufsichtigte. Noch vor der Erschließung des Landes durch die Eisenbahn begann man bereits 1866, eine Fernsprechleitung durch den ganzen Kontinent bis nach Alaska zu planen. Ursprünglich sollte es eine russisch-amerikanische Telegrafenverbindung werden.
Diese frühe Zeit der Pioniere, Entdecker und Forscher ist es, die mich seit jeher fasziniert und meine Fantasie zu lebhaften Bildern anregt. Dabei bestärkt mich das Panorama von Smithers mit seinen Holzhäusern, von denen einige sogar aus dem Jahr 1913 stammen, aber natürlich neu hergerichtet sind. Im Norden der Stadt, hinter der letzten Straße, wo die wild gezackten Felszinnen emporragen, liegt das alte, ebenfalls renovierte Bahnhofsgebäude.
Auf einem Nebengleis reiht sich ein Güterwaggon an den anderen, zwei Kilometer ist der Zug lang, dem ich nun folge. Ich halte nach Tieren Ausschau, entdecke aber nur eine Schar Spatzen und ein paar Krähen. Ein vertrautes Gurren lässt mich genauer hinschauen. Tatsächlich, es sind Türkentauben, die gleiche Art, die seit den 1930er-Jahren von Osten nach Deutschland eingewandert ist. Wegen ihrer Herkunft tragen sie den auf die Türkei verweisenden Namen, obwohl sie ursprünglich noch weiter entfernt in Asien beheimatet waren. Ich frage mich, wie diese Tauben es über den Atlantik in den Westen Kanadas geschafft haben. Später lese ich in meinem Vogelbestimmungsbuch, dass die Tauben 1970 auf den Bahamas absichtlich ausgewildert worden waren oder unabsichtlich freikamen. Genaueres konnte ich nicht herausfinden. Von dort gelangten sie auf eigenen Schwingen nach Florida und flogen weiter nach Norden, bis sie Kanada erreichten.
Am Weg weist eine Infotafel mit dramatischen Worten und Fotos auf einen 1929 stattgefundenen Bankraub hin. Mit einem Taschenmesser hatte ein Mann den Bankangestellten bedroht, der 2000 Dollar herausrückten musste. Der Räuber flüchtete und versteckte sich ein paar Tage in den Bergen, wurde schließlich aufgespürt und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Erstaunlich, dass dieses lange zurückliegende Ereignis es wert ist, so ausführlich geschildert zu werden.
Außerhalb der Ortschaft entdecke ich im Gebüsch neben den Waggons alte Schlafsäcke, Pappkartons und andere Gegenstände, die auf Übernachtungsplätze schließen lassen. Einer möglichen Gefahr will ich mich nicht aussetzen und wende mich wieder der Stadt zu, in deren Zentrum mich ein aus Holz geschnitzter übermannsgroßer Alphornbläser überrascht. Ich erfahre, dass sich außer den frühen Pionieren vom Eisenbahnbau vor allem Menschen aus der Schweiz hier angesiedelt haben; neben ihnen gibt es auch noch eine große Gemeinschaft von Holländern.
Die Bewohner von Smithers leben vor allem vom Wintertourismus. Die mit Liftanlagen erschlossenen Berghänge des Hudson Bay Mountain gelten als hervorragendes Skigebiet. Zudem ist die Ortschaft eine wichtige Versorgungsbasis für zahlreiche Lodges, für Jagd- und Wildhütten und für Outdoor-Aktivitäten. Auch die Minenarbeiter versorgen sich hier, denn noch immer wird in den Bergen nach Gold und anderen Mineralien geschürft. In der Umgebung von Smithers widmen sich Menschen zudem der Forstwirtschaft, der Viehzucht, dem Fischfang und der Landwirtschaft.
Als wir in Louise’s Kitchen unseren Hunger mit ukrainischen Spezialitäten stillen, kommen wir mit einem meiner Meinung nach echt kanadisch aussehenden Mann ins Gespräch, der entweder Wildhüter oder Förster sein könnte. Wie es in Kanada üblich ist, spricht er uns ganz selbstverständlich an, als wären wir alte Bekannte: „Hi, guys! What you are doing in Smithers?“
An meinem Englisch erkennt er in mir sofort die Ausländerin und freut sich, als er hört, dass wir aus Deutschland kommen. Sein Name sei Wolfgang und er stamme aus der Eifel, erklärt er uns. In Deutschland habe er Biologie studiert und wollte promovieren, indem er Biologie, Forstwirtschaft, Jagd, Fischfang und Naturschutz in seiner Doktorarbeit miteinander verband. Das habe nicht so geklappt, wie er es sich vorgestellt hatte. Sein Doktorvater starb, als er fast mit der Arbeit fertig war, niemand wollte sein Projekt weiter betreuen, und so sei er vor 25 Jahren nach Kanada ausgewandert.
„Jahrelang habe ich mit den Ureinwohnern gelebt, wollte ethnologische Studien treiben. Ich interessierte mich vor allem für die Heilkunst der First Nations. Doch meinen Idealismus habe ich bald verloren, denn nur noch wenige Alte hatten Kenntnisse von der ursprünglichen Lebensweise. Die nachfolgenden Generationen sind ganz und gar entwurzelt, nur wenige finden Arbeit, das Alkohol- und Drogenproblem nimmt überhand. Ich habe versucht, einigen Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, bin mit ihnen im Wald gewandert, auf Berge gestiegen, wollte mit ihnen Tiere beobachten und sie Pflanzenkunde lehren, ihnen beibringen, was ihre Vorfahren noch wussten, doch vergeblich.“
Inzwischen hat er sich ein neues Leben aufgebaut, besitzt eine Farm außerhalb von Smithers, hat Pferde und Hunde und ein Sägewerk. In die Stadt sei er nur gekommen, weil er zum Flughafen muss, um seinen Sohn abzuholen, der in Vancouver studiert und bei ihm die Ferien verbringen will. Wolfgang nimmt noch einen letzten Schluck aus seinem Bierglas und verabschiedet sich freundlich von uns.
Mit dem Buschflieger zum Rainbow Lake
Dort, wo der Bulkley und der Telkwa River zusammenfließen, liegt die kleine Ortschaft Telkwa. Schon im Jahr 1906, also eher als in Smithers, haben Siedler ihre Häuser hier gebaut, als das Telegraph Trail System von Süden nach Norden durch das Land gezogen wurde.
Am frühen Vormittag fahren wir von Smithers mit einem Taxi etwa 20 Kilometer Richtung Telkwa. Dort, am Tykee Lake, so die per E-Mail erhaltene Information, werden wir von einem Wasserflugzeug abgeholt, das uns zum Ausgangpunkt unserer Wildniswanderung am Blue Lake bringen soll. Wir sind früh dran, unsere Mitreisenden sind noch nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, mich am Seeufer umzuschauen.
Zunächst erregt ein Propellerflugzeug, das im Wasser dümpelt, meine Aufmerksamkeit. Vom Steg aus ist es leicht zu erreichen. Während ich noch überlege, ob wir vielleicht damit fliegen werden, sehe ich aus dem Augenwinkel ein Flattern, und als ich genauer hinschaue, entdecke ich einen etwa 30 Zentimeter großen Vogel. Es muss ein kingfisher sein, wie ich anhand der Fotos im Bestimmungsbuch, das ich immer dabeihabe, sogleich feststelle. Verwandt mit unserem Eisvogel, nur viel größer und ohne das schillernde Federkleid, hockt der am Rücken schwarzblaue Vogel mit seiner leuchtend weißen Brust, die ein breites, dunkles Band ziert, dekorativ auf einem knorrigen Ast. Die rostroten Flecken an den Flanken zeigen mir, dass es ein Weibchen ist. Es ist bei dieser Vogelart attraktiver gefärbt als sein männlicher Partner. Wegen des bandförmigen Streifens über der Brust heißen die Vögel auf Englisch belted kingfisher, also Gürtelfischer.
Bevor ich meine Kamera in Position bringen kann, stürzt sich der Vogel ins Wasser und taucht bald darauf mit einem silbrig schimmernden Fisch im Schnabel wieder auf. Es dauert eine Weile, bevor die Beute, Kopf voran, im Schnabel liegt. Als er sie endlich verschluckt, stellt er seine Federhaube demonstrativ in die Höhe, sodass der Kopf mächtig groß im Verhältnis zum ganzen Körper erscheint. Noch einmal taucht er ab, und erneut hat er Glück. Seinen Aussichtsposten auf dem weit übers Wasser ragenden Ast hat er schlau gewählt. Im klaren See kann er die Fischwelt unter sich gut erspähen und zielgenau zustoßen.
Bald werden die kingfisher, von denen es nur diese eine Art in Kanada gibt, Richtung Süden fliegen. Den Winter verbringen sie in den USA, in Mexiko oder sogar im Norden Südamerikas, um dann im Frühjahr in ihr angestammtes Revier zurückzukehren. Dort graben sie mit ihrem erprobten Partner meterlange Röhren in lehmige Uferwände, in denen die Weibchen ihre Eier ablegen. Gemeinsam ziehen sie dann ihren Nachwuchs auf. Wegen ihrer monogamen Lebensweise erhielten die Vögel den wissenschaftlichen Namen alcyon, in Anlehnung an Alkyone, eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Als Alkyones Gatte, den sie über alles liebte, bei einem Sturm mit seinem Schiff kenterte und ertrank, geriet sie in abgrundtiefe Verzweiflung. Da alles Klagen nichts half, wollte auch sie nicht mehr leben und stürzte sich ins Meer. Der römische Dichter Ovid, der zahlreiche griechische Legenden in seinen „Metamorphosen“ verarbeitete, schenkte den sich treu liebenden Eheleuten ein Weiterleben, verwandelt in Eisvögel.
Ich freue mich über diese erste wirklich interessante Vogelbeobachtung, die durch die Ankunft von Cornelia unterbrochen wird. Die junge Schweizerin reist seit einigen Wochen in Kanada umher und erzählt uns begeistert von ihren Erlebnissen und Begegnungen. Sie wird mitfliegen, aber nicht an unserer Wandertour teilnehmen, sondern mit Pferden unterwegs sein. Das Gleiche gilt für Gabi und Andreas, die bald darauf eintreffen. Das Ehepaar lebt im Vogtland, ist schon viel gereist und freut sich auf seine erste echte Wildnistour.
Motorengeräusch hallt über den See, und dann sehen wir auch schon die Maschine, die sich auf die Wasserfläche niedersenkt und Gischt sprühend auf ihren Kufen landet. Langsam schwimmt sie zum Steg. Einige Gäste steigen aus, die in einem anderen Gebiet unterwegs waren. Wir hatten gedacht, dass es nun gleich losgehen würde, schließlich ist es inzwischen bereits Mittag, und wir sollten doch eigentlich am Vormittag starten. Jedoch vergehen Stunden bis zum Abflug. Zuerst wird unser Gepäck gewogen, dann sind wir dran, um zu berechnen, wie viele von den in einem Verschlag gestapelten Lebensmitteln mitgenommen werden können. Einige der Kisten und Schachteln müssen zurückbleiben.
Es ist später Nachmittag, als der Pilot, ein Schweizer und Chef der Alpine Lake Air, der schon lange in Kanada lebt, endlich den Motor seiner Twin Cessna anwirft. Fast zwei Stunden wird der Flug über Wälder, Berge, Seen und Flüsse dauern. Alle Personen haben Fensterplätze und schauen gespannt nach draußen. Cornelia darf sogar vorn neben dem Piloten sitzen, worum ich sie beneide. Die Propeller drehen sich, die Maschine schiebt einen Wasserschwall vor sich her und hebt Tropfen versprühend ab. Schnell gewinnt das Flugzeug an Höhe. Der Pilot zieht einige Schleifen über dem See, der von hoch oben wie ein blauer Fleck zwischen grünen Wiesen und grauen Bergfelsen wirkt.
Nachdem wir Smithers und den Ort Telkwa hinter uns gelassen haben, sehen wir keine Siedlungen mehr. Wir fliegen über die nördlichen Ausläufer der Rocky Mountains, eine endlos scheinende Wildnis. Allerdings werden die Wälder zunächst noch von Schotterstraßen zerfurcht, und Holzfäller haben Schneisen geschlagen, außerdem kann ich einzelne Hütten erkennen, dann aber breiten sich unberührte dunkelgrüne Nadelwälder aus. In breiten Trogtälern winden sich glitzernde Flüsse und münden in einsame Seen. Bald fliegen wir tiefer hinein in die Rocky Mountains. Felsige Höhen, steile Wände, tiefe Canyons und öde Hochflächen bestimmen nun die Landschaft und schaffen ein Labyrinth, in dem sich nur ein erfahrener Pilot orientieren kann.
Wir blicken begierig hinunter auf diese wilde Landschaft, die inzwischen ohne Spur menschlichen Lebens ist, aber auch Tiere sind nicht zu entdecken. So niedrig fliegen wir, dass die dunklen Körper von Schwarzbären, Grizzlys, Karibus oder Wapitis an den grünen Flussufern leicht zu erkennen gewesen wären. Sie scheinen sich aber in den dichten Wäldern zu verbergen.
Was mir allerdings auffällt, auch als wir längst die Gebiete mit Holzeinschlag hinter uns gelassen haben, sind riesige Flächen sterbender Bäume, die rostrot leuchten. Es sind nicht einzelne Bäume mal hier, mal dort, sondern alle Bäume über eine Strecke von mehreren Quadratkilometern sind tot. Ihre roten Nadeln können keine Fotosynthese mehr betreiben, sie haben das Chlorophyll verloren. Die Wurzeln verankern die Stämme noch im Boden, bis Stürme irgendwann die toten Bäume zu Boden zwingen werden.
Ich hatte gelesen, dass die bisher unberührte Natur Kanadas von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht wird. Das Ausmaß des Waldsterbens jetzt mit eigenen Augen zu sehen ist beängstigend. Es sind mountain pine beetles, Borkenkäfer, die Kiefern, aber auch Fichten und Lärchen befallen. In früheren Jahren haben sie sich nur über kranke und alte Bäume hergemacht, inzwischen haben sie sich so enorm vermehrt, dass ihnen auch gesunde Bäume zum Opfer fallen. Die Käferweibchen senden Pheromone aus, Duftstoffe, mit denen sie Männchen massenhaft anlocken. Nach der Paarung bohren sich die Weibchen durch die Borke bis zu den nährstoffreichen Leitungsbahnen, wo sie Eier ablegen, aus denen dann die Larven schlüpfen. Normalerweise schützen sich Bäume durch erhöhte Harzproduktion, wodurch die Killerkäfer verkleben und unschädlich gemacht werden. Die gewieften Insekten haben sich aber mit einem Pilz zusammengetan, den sie bei ihrem Angriff gleich mitbringen und der die Harzabsonderung mittels seines Pilzgeflechts stoppt. Auch gesunde Bäume können sich gegen den Angriff nicht mehr zur Wehr setzen und sind nun den Borkenkäfern hilflos ausgeliefert. Es dauert wenige Wochen, dann ist der Baum unrettbar verloren. Weil seine Transportbahnen beschädigt sind, verhungert und verdurstet er, die Nadeln verfärben sich rot, sitzen aber weiter an den Zweigen, obwohl der Baum schon lange tot ist. Nach ein bis zwei Jahren rieseln sie herab, dann stehen graue Stämme wie Mahnmale da, bis sie irgendwann zu Boden brechen.
Niemand hat mit einer so starken Vermehrung der Käfer gerechnet. Die schwarzen reiskornkleinen Insekten sind weit nach Norden und selbst in sicher geltende Höhenlagen vorgedrungen. Der Grund für die ungezügelte Massenvermehrung ist die Klimaerwärmung. Im Winter müsste es wie früher kälter als minus 40 Grad Celsius sein, und das über mehrere Wochen hinweg, damit ein Großteil der Larven unter der Rinde abstirbt. Weil es inzwischen viel zu warm ist, überleben fast alle und können im Frühjahr, in Käfer verwandelt, ausschwärmen und ungehindert ihr Zerstörungswerk fortsetzen. In nur zehn Jahren ist in der Provinz British Columbia fast ein Fünftel der Bäume durch den Kiefernkiller vernichtet worden. Das ist fast die halbe Fläche Deutschlands.
Ich atme befreit auf, als ich keine rostroten Wälder mehr erblicke. Doch die Gefahr ist für die gesunden Bäume nicht gebannt. Je wärmer es wird, umso weiter werden sich die gefräßigen Insekten nach Norden ausbreiten.
Ein See kommt in Sicht. Das Flugzeug kreist, der Pilot sucht zwischen den Felsgipfeln einen Durchschlupf und kommt dabei immer tiefer. Schließlich setzt die Maschine mit ihren Kufen auf dem glasklaren Wasser auf. Am Ufer stehen Holzhäuser und Vorratsschuppen. Das muss das Camp am Blue Lake sein, wie ich es zuvor auf Fotos gesehen hatte. Der Pilot steuert zum Steg, wo einige Leute warten. Für sie sind die Lebensmittel in den Kisten und Paketen bestimmt. Laut Plan werden Helmut und ich uns hier einige Tage akklimatisieren und unseren Guide Bob treffen, der uns durch die Wildnis zu „meinem“ Blockhaus am Thukada Lake führen soll.
Wie sich herausstellt, ist Bob nicht unter den Leuten. Er warte am Rainbow Lake auf uns, heißt es. Also steigen wir wieder ins Flugzeug, nehmen unsere Sitzplätze ein, fliegen eine Ehrenrunde über den See, und weiter geht es nach Norden. Die Landschaft wird zunehmend wilder, die Berge ragen noch höher empor.
Eine knappe halbe Stunde später landen wir am nächsten See. Nur ein einziger Mensch steht am Steg – Bob, unser Guide. Schon auf den ersten Blick wirkt der große und sportliche Mann sympathisch. Er hat wache Augen und kräftige, von Wind und Wetter gegerbte Gesichtszüge.
Helmut und ich steigen aus, die anderen Gäste fliegen weiter zum Thukada Lake, wo sie ihre Pferdetour beginnen werden und der später das Endziel unserer Wanderung sein wird. Dort werde ich „mein“ Blockhaus erstmals mit eigenen Augen sehen!
Bob hatte die Information bekommen, dass wir gegen 14 Uhr ankommen würden, und hat fast nicht mehr mit uns gerechnet. Wegen der Verzögerung beim Start und durch das Entladen der vielen Lebensmittelkisten am Blue Lake ist es spät geworden, und die Sonne verschwindet bereits hinter den sich im See spiegelnden Felsgipfeln. Das Abendrot ergießt sich über den Horizont, fließt über den See, taucht in ihn ein. Einen Moment ist das Bild wie eingefroren, als würde sich die Sonne vor ihrem Verschwinden noch kurz ausruhen, um dann ihre Reise zur anderen Seite der Erde fortzusetzen.
Das Camp am Rainbow Lake gefällt mir sofort. Es fügt sich, anders als die vielen Gebäude, die ich bei der kurzen Landung am Blue Lake gesehen hatte, harmonisch in die Landschaft ein. Es gibt nur zwei Holzhäuschen dicht am Seeufer, hinter denen der Wald beginnt. Die etwas größere Hütte dient Bob als Unterkunft und uns gemeinsam als Aufenthaltsort bei den Mahlzeiten. In der zweiten Hütte gibt es innen an der Rückwand ein Holzgestell mit einer Schaumstoffmatte, auf der Helmut und ich unsere Schlafsäcke ausbreiten. Ein Tischchen, zwei Hocker und, ganz wichtig, ein Ofen vervollständigen die karge Einrichtung, für mehr wäre kein Platz. Beide Hütten sind nicht aus Baumstämmen gebaut, sondern aus Sperrholzplatten. Für meine Überwinterung würde so eine Hütte sich nicht eignen, sind wir uns sicher, weil sie gegen die Kälte nicht genügend schützt.
Kaum haben wir uns eingerichtet, ruft Bob zum Abendessen. Für mich, die ich noch nie mit einem Führer unterwegs war, ist es ungewohnt, bei einer Wildnistour bekocht zu werden. Bob lässt meinen Widerspruch nicht gelten und erklärt mir, es gehöre zur Aufgabe eines Guides, seine Gäste mit Nahrung zu versorgen. Zu unserer großen Überraschung gibt es Steaks, Gemüse und Salat, ein richtiges Menü. Offenbar war ein Teil der im Flugzeug mitgebrachten Lebensmittel für uns bestimmt.
Von Bob erfahren wir, warum wir nicht, wie geplant, am Blue Lake ausgestiegen und in zwei Tagen hierher gewandert sind, sondern gleich bis zum Rainbow Lake geflogen wurden. Er musste vor unserer Ankunft die Hütte, in der wir jetzt zu Abend essen, reparieren. Ein Schwarzbär hatte die eingelagerten Konserven erschnuppert und sich gegen die Holzwände geworfen, bis sie brachen. Wir bekommen auch gleich jeder eine Dose Pfefferspray extrastark, die wir am Gürtel griffbereit tragen müssen.
„Geht nie nach draußen ohne diesen Schutz“, schärft Bob uns ein. „Selbst der Gang zur Toilette könnte tödlich sein.“
Mitten im Wald liegt das Plumpsklohäuschen. Der Weg dorthin ist romantisch eingerahmt von moosverhüllten Bäumen, von deren Ästen geisterhaft Flechten herabhängen. Der schmale Pfad federt weich unter meinen Schritten. Modrig kühle, nach Pilzen riechende Luft umfängt mich und ruft augenblicklich die Erinnerung an frühe Kindheitserlebnisse wach.
Bis zu meinem fünften Lebensjahr wohnten wir in Bautzen. Meine Eltern verbrachten die Sommertage mit mir und befreundeten Familien in einfachen Bungalows auf einer Wiese, umgeben von Wald, die von einem Bauern gepachtet worden war. Während dieser ersten fünf Jahre genoss ich Sonne, Luft und Freiheit und wurde vertraut mit der Natur, mit Pflanzen und Tieren. Für mich als Kind waren dies einprägsame Erlebnisse, die meinen Lebensweg maßgeblich bestimmten.
Ich erinnere mich noch lebhaft an das Gefühl, wenn ich von meiner Mutter zum Wasserholen an die Quelle geschickt wurde, einem verwunschenen Ort tief im Wald. Nach den ersten Schritten von der sonnenbeschienenen, hellen Wiese hinein in das Reich der hohen Bäume wurde ich von Kühle und gedämpftem Licht begrüßt. Eine andere Welt begann. Ich spürte deutlich die scharfe Grenze von einer Welt in die andere. Immer wieder wunderte ich mich, wie plötzlich der Übergang war, von der Wiese zum Wald, von draußen nach drinnen, von Helligkeit zu Dunkelheit. Mich faszinierte dieser krasse Wechsel. Ich wollte ihn immer wieder von Neuem erleben und ging mehrmals am Tag bereitwillig zum Wasserholen. Nicht nur das Licht, auch die Luft war anders im Wald. Kühl umspielte sie meine nackte Haut, die sofort kleine Huckel bekam. Die Waldluft war feucht und schwer mit einer Fülle von Düften, die ich noch nicht benennen konnte. Mit bloßen Füßen tappte ich über den weichen Waldboden, ein erregendes Gefühl, barfuß die Erde zu spüren. Der Pfad wurde immer feuchter, je näher ich der Quelle kam. Kühles Wasser sprudelte zwischen Steinen aus dem Erdinneren am Berghang. Ich wusste nicht zu erklären, warum mich dieser Ort so anrührte, es war, als würde er ein Geheimnis in sich bergen. Immer ging ich allein zur Quelle und fühlte mich sicher und geborgen. Dass ich mich nach so vielen Lebensjahren an dieses Erleben so deutlich erinnere, zeigt mir, wie tief es mich im Inneren angerührt hat. Jetzt bei der ersten Berührung mit der kanadischen Wildnis steigt es wieder an die Oberfläche meines Bewusstseins. Ich bin meinem Schicksal dankbar, dass sich Erlebnisse meiner Kindheit wie in einem Kreis mit meinem späteren Leben verbinden. So wie damals, habe ich auch diesmal keine Angst, allein in den fremden Wald hineinzugehen, obwohl ich weiß, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Bär in der Nähe war.
Die unbekannte Umgebung nehme ich mit allen Sinnen freudig wahr, während ich auf dem gewundenen Pfad zu dem hinter Bäumen verborgenen Häuschen gelange, dessen Tür wie von starken Pranken zerfetzt ist. Ganze Holzstücke sind herausgerissen. Also war er auch hier, der Bär. Prüfend blicke ich umher, ob ich im verwucherten Wald eine dunkle Gestalt wahrnehmen kann. Nichts! Mein Herz schlägt vielleicht etwas schneller, doch Angst steigt nicht in mir auf.
Als ich Bob von der arg zerstörten Tür berichte und meine, dass der Bär doch sehr hungrig sein müsse, wenn er sich von den intensiven Gerüchen des Klos nicht abschrecken ließe, lacht er laut: „Nein, nein, kein Bär. Das waren Stachelschweine!“
„Was, die können festes Holz zerstören?“
„Und ob! Mit ihren kräftigen Nagezähnen vernichten sie selbst Bäume, ganze Blockhäuser haben sie schon zum Einsturz gebracht.“
Stachelschweine sind mit etwa einem Meter Körperlänge fast so groß wie Biber. Mit Schweinen haben sie rein gar nichts zu tun, wie so oft, wenn Tiere willkürlich mit Namen belegt werden, die biologisch nicht stimmen. Es gibt weltweit elf verschiedene Arten in Asien, Afrika, sogar in Südeuropa, zum Beispiel in Süditalien und auf Sizilien, wohin sie von den Römern gebracht wurden. Allen gemeinsam sind die Stacheln am Rücken und Schwanz aus umgewandelten Haaren, die den Tieren als Waffe dienen und mit denen sie sich wirksam gegen Feinde verteidigen. Die Stacheln sind mit Widerhaken versehen. Bei jeder Bewegung des unglücklichen Angreifers dringen sie tiefer in sein Fleisch, durchbohren schließlich innere Organe und können so dem verletzten Feind lange nach der Auseinandersetzung noch den Tod bringen.
Stachelschweine sind mir erstmals in Afrika begegnet. Bedeckt von 30 Zentimeter langen, hell und dunkelbraun gebänderten Stacheln sehen die Tiere aus wie ein lebendes Mikadospiel. Vorsichtig hielt ich Abstand, denn sie können durch Muskelkontraktion die Stacheln abschießen, die dann mehrere Meter weit fliegen. Dabei drehen sie dem Angreifer ihr Hinterteil zu, stellen die Stacheln zu einem Fächer auf, schütteln sie drohend, wie eine Rassel, und schon ist der Gegner von spitzen Spießen durchbohrt. Es gibt Erzählungen, dass ein einzelnes Stachelschwein ein Löwenrudel in die Flucht geschlagen haben soll.
Die Riesennager Kanadas sind nur entfernt mit den afrikanischen Stachlern verwandt. Sie heißen hier Baumstachelschweine oder Urson. Ihrem Namen gemäß klettern sie sehr geschickt auf Bäume, während die Stachelschweine Afrikas sich am Boden aufhalten.
Morgens am Rainbow Lake
Vom Berghang springt ein Wildbach herab und stürzt sich, nur wenige Schritte von unserer Hütte entfernt, schäumend in den See. Das Wasser ist abschreckend kalt – eine Katzenwäsche muss genügen. An meinem ersten Morgen in der Wildnis stehe ich Zähne putzend am Seeufer, da bemerke ich im Gras ein Streifenhörnchen, ein chipmunk. Mausklein, mit buschigem Schweif, dunkelbraunen und hellen Längsstreifen am Rücken, hüpft es hurtig umher auf der Suche nach Futter. Fasziniert beobachte ich den kleinen Nager, wie er eine Grasrispe zierlich in beiden Vorderpfötchen hält und die Samen herausknabbert. Dann springt das Hörnchen wieder davon, so schnell, dass ich ihm kaum mit den Augen folgen kann.
Mit dem ersten Lichtschimmer bin ich aufgestanden, und so habe ich genügend Zeit, noch vor dem Frühstück den Tag mit einer Erkundung der Gegend hinter den beiden Hütten zu beginnen. Den Waldboden bedecken dicke Polster silberheller Rentierflechte, auch irrtümlich als „Isländisches Moos“ bezeichnet, die den Karibus als Nahrung dient. Karibus sind Rentiere, die gleiche Art, die auch auf dem eurasischen Kontinent durch die eiskalten Tundren zieht. Die Bezeichnung stammt aus einer indigenen Sprache und bedeutet „Der mit den Hufen scharrt“, weil die Tiere im Winter den Schnee mit ihren Hufen wegschieben, um Flechten freizulegen.
Eine andere Flechtenart prunkt mit korallenroten Fruchtkörpern, die auf weiß umpelzten Stielchen sitzen. Reife Preiselbeeren leuchten zwischen lackgrünen Blättern, und an hüfthohen Sträuchern kann ich blutrote Johannisbeeren identifizieren. Die wilden Früchte sind kleiner als die gezüchteten Garten-Johannisbeeren, schmecken aber genauso gut, wie ich erfreut feststelle.
Steil steigt der Pfad den Hang hinauf. An einigen Stämmen entdecke ich von Menschen gemachte Markierungen. Mit einer Axt wurde in Mannshöhe Rinde abgeschlagen. Wie ich später von Bob erfahre, dienen sie zur Orientierung im Winter, damit man im hohen Schnee das Camp findet.
Mir fällt auf, wie still es im Wald ist. Von ferne rauscht der Bach, aber kein Vogelruf, kein Tierlaut ist zu hören, auch nicht das Sirren und Surren von Insekten, selbst am See gibt es keine Mücken. Die Zeit der bissigen Schwärme beginnt nach der Schneeschmelze in den Monaten Juni und Juli und ist zu unserem Glück schon vorbei. Das Klima so hoch in den Bergen ist rau und kalt. Obwohl es August ist, steigt das Thermometer, selbst wenn die Sonne im Zenit steht, kaum über zwölf Grad Celsius.
Der lautlose Wald mit seinen mit Moos ummantelten Bäumen, den geisterhaften Bartflechten, den halb vermoderten Stämmen wirkt gespenstisch. Vorsichtig schaue ich umher, ob sich irgendwo ein Bär verbirgt. Zwischen den Baumstämmen kann ich einigermaßen gut hindurchsehen, auch das Unterholz ist nicht allzu dicht, sodass ich wahrnehmen würde, wenn sich ein Bär in der Nähe aufhielte. Obwohl – sicher ist das nicht. Ich habe schon oft erfahren, selbst große Tiere verstehen es bestens, sich zu tarnen.
Ein Bär begegnet mir bei diesem ersten Erkundungsgang nicht, doch dass er da war, signalisiert mir seine Hinterlassenschaft, die ich mitten auf dem Pfad entdecke. Der lilafarbene Haufen ist noch ganz frisch und zeigt an, was dem Bär zuletzt geschmeckt und woran er sich gütlich getan hat, nämlich an einer reichlichen Beerenmahlzeit.
Zum Frühstück überrascht uns Bob mit Rührei, dazu Würstchen aus der Dose, Kaffee und Tee. Ich muss mich erst daran gewöhnen, hier derartigen Komfort zu genießen. Irgendwie passt das nicht zu einer Wildnistour. Es ist wie ein in die Wildnis mitgenommener Teil der Zivilisation.
„Wir bleiben noch einen Tag“, eröffnet uns Bob. „Die Wanderung beginnen wir morgen.“
Sein Vorgesetzter John und der First-Nations-Chief Howard haben sich per Funk angemeldet, berichtet er. Sie werden am Vormittag einfliegen, um mit mir über meine Überwinterung zu sprechen. Zwar stand ich mit beiden seit Monaten in E-Mail-Kontakt, aber getroffen haben wir uns noch nicht. Nun bin ich ziemlich aufgeregt, denn von dieser Begegnung hängt es ab, ob sich mein Traum verwirklichen lässt. Der Chief der Tsay-Keh-Dene-Indianer und zugleich Direktor der Lands, Resources & Treaty Operations muss sein Einverständnis geben. Ich hatte ihm und John eine Liste mit meinen Fragen gemailt. Die erste war eher eine Bitte, nämlich ob sie mir die cabin, wie Blockhütten in Kanada bezeichnet werden, vermieten würden, und zwar für drei bis vier Monate. Die nächste Frage betraf den Piloten: Ob er mich im Winter hinfliegen und wieder abholen würde, wobei auch die Lebensmittel für die gesamte Zeit meines Aufenthalts mitgenommen werden müssten. Weiter wollte ich wissen, ob es ein Funkgerät gäbe, um Hilfe herbeizurufen, wenn ich in Not geriete, und jemanden, der meine Funknachrichten empfangen würde. Ebenso wichtig würde es sein, genügend Holz zum Heizen zur Verfügung zu haben. Ein weiterer Wunsch war, ein Gewehr mit Erlaubnis der kanadischen Behörden mitnehmen zu dürfen. Die letzte Frage lautete, wie viel ich ungefähr zu bezahlen hätte für Miete, Feuerholz, Pilot, Lebensmittel und nicht zuletzt für ihre Unterstützung. Bisher hatten weder der Chief noch John verlauten lassen, was sie von meiner Idee hielten, sondern mich auf das Gespräch nach meiner Ankunft in Kanada vertröstet.
Es ist ein sonnenheller Vormittag. Der See schmückt sich mit glitzernden Wellen, ein paar Enten dümpeln im Wasser. Helmut und ich sitzen in der Sonne am Seeufer, Bob repariert inzwischen das vom Baumstachelschwein ramponierte Klohäuschen, als plötzlich Motorengeräusch ertönt, das schnell lauter wird, und schon taucht das Flugzeug über den Felsgipfeln auf, senkt sich hinunter zum See. Nun entscheidet es sich. Mein Herz klopft heftig.
Ein hochgewachsener, drahtiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht und ein zweiter, kleinerer mit eindeutig indigenem Aussehen verlassen die Maschine und balancieren über die Schwimmkufen zum Steg. Wir schütteln uns förmlich die Hände und stiefeln zur Hütte, wo wir uns um den Tisch herum gruppieren, auch Helmut und Bob sind beim Gespräch dabei. Zwei Stunden wird die Unterredung dauern.
Bevor sie meine Fragen beantworten, stellen John und Howard mir die ihren. Zuerst wollen sie wissen: „Warum wollen Sie den Winter in der kanadischen Wildnis verbringen?“
Oje, wie erkläre ich auf Englisch, warum ich in Dunkelheit und eisiger Kälte, noch dazu allein, in einer Blockhütte überwintern will? Wie mache ich deutlich, dass ich keine verrückte Abenteuerin bin, die nicht weiß, worauf sie sich einlässt? Wie kann ich ihnen klarmachen, dass ich mir keine romantischen Vorstellungen von der Wildnis mache? Mir ist bewusst, von meiner Antwort hängt viel ab, wenn nicht alles. Hätte ich mir nur vorher ein paar passende englische Sätze zurechtgelegt. Ich darf nicht zu lange zögern. Johns stahlblaue Augen und die schwarzen von Howard blicken mich scharf und forschend an.
Am besten wird sein, ich beginne mit einigen Infos über mich: „So weit ich in meinem Leben zurückdenken kann, habe ich eine enge Beziehung zur Natur. Schon als Kind bin ich allein im Wald auf Entdeckungstour gegangen, habe manchmal sogar draußen übernachtet, um Tiere zu beobachten. In Büchern las ich als Jugendliche über Kanadas Wildnis. So entstand schon damals der starke Wunsch, diese Gebiete zu besuchen. Zunächst habe ich Biologie studiert und mich gleichzeitig auf Wildnisexpeditionen vorbereitet, indem ich meinen Körper trainierte, Hunger und Kälte und Entbehrungen auszuhalten. Außerdem habe ich Klettern und Tauchen gelernt, habe auch den Jagdschein gemacht, um mich im Notfall mit Nahrung versorgen zu können. Ein Jahr lang erforschte ich als Biologin das Leben der Meerechsen auf den Galapagosinseln, lebte auf einer einsamen Insel, wobei ich feststellte, dass ich es gut aushalte, lange Zeit ohne andere Menschen zu sein. Danach war ich in Ländern unterwegs, oft monatelang, wo die Natur noch ursprünglich und vom Menschen wenig beeinflusst ist, wie in Patagonien, der Mongolei, Ecuador, den Philippinen, im Jemen. Meinen Traum, die Wildnis Kanadas zu erleben, habe ich dabei jedoch nie vergessen. Nachdem ich all die Jahre umfangreiche Erfahrungen gesammelt habe, wäre nun der richtige Zeitpunkt, ihn zu verwirklichen.“
Während ich spreche, weichen Johns durchdringend blaue Augen keinen Moment von meinem Gesicht, ohne dass ich erkennen könnte, was meine Worte bewirken. Noch weniger kann ich dem Chief ansehen, was er denkt. Seine Lider verdecken halb seine Augen, und kein Muskel bewegt sich in seinem faltenlosen Gesicht.
„Und warum ausgerechnet im Winter?“, greife ich deren zuvor gestellte Frage auf. „Weil das Erlebnis in der kalten Jahreszeit intensiver ist. Ich möchte in der Wildnis sein, wenn die Natur extrem und das Leben hart ist, wenn es darum geht zu überleben. Dabei kann ich nicht nur mehr über die Natur erfahren, sondern auch über mich und meine Fähigkeiten. Und gerade hier in British Columbia kann ich finden, was auf der Erde schon so selten geworden ist – echte Wildnis.“
In Johns Augen leuchtet Interesse auf, als würde er ähnlich denken und fühlen. Er nickt, räuspert sich und sagt: „Ein Aufenthalt von November bis Januar ist unmöglich!“ Ich erschrecke, und mein Herz schlägt hart. Ist das eine Absage?
Da ergreift der Chief das Wort: „Wenn es draußen kälter als minus 40 Grad Celsius ist, erfrierst du in der cabin.“
„Du müsstest Tag und Nacht alle zwei Stunden Holz nachlegen“, ergänzt John. „Nach einiger Zeit schläfst du übermüdet ein und wachst nicht mehr auf.“
Sie schlagen mir die Monate ab Februar vor, auch im März und April sei immer noch tiefer Winter bei minus 20 Grad Celsius.
Howard meint, und dabei huscht ein Lächeln über sein Gesicht: „Das müsste doch kalt genug für dich sein. Auch dann ist der Winter noch nicht vorbei, aber die Tage werden länger, die Temperatur steigt, die Natur erwacht, die Vögel kommen zurück, und der Frühling beginnt.“
Ich halte den Atem an. Bedeutet das eine Zusage?
„Wir können dich aber erst im Mai abholen“, fährt John fort. „Der See muss vollkommen eisfrei sein, damit das Wasserflugzeug landen kann. Im Februar setzt es mit Schneekufen auf dem Eis auf, aber in den Monaten danach wird es für den Piloten gefährlich, weil sich Risse, Spalten und Aufwölbungen bilden. Wenn du in dieser Zeit Hilfe benötigst, müssten wir dich mit dem Hubschrauber holen lassen.“
Helmut und Bob hören zu, ohne sich einzumischen, wobei Bob sich während des Gesprächs eifrig Notizen macht, die er später in Johns und meinen Vertrag einarbeiten wird.
„Deinen Wunsch nach einer Waffe können wir nicht erfüllen“, sagt der Indianer. „Es ist ein Schutzgebiet, in dem nicht gejagt werden darf.“
„Ein Gewehr zur Selbstverteidigung gegenüber Bären ist auch viel zu gefährlich“, ergänzt John. „Selbst wenn ein Bär tödlich getroffen ist, hat er oft noch genug Kraft, dich wütend anzugreifen, dann gibt es keine Rettung. Besser, du vertreibst Bären mit Pfefferspray und Knallern.“
Bevor die Männer wieder ins Flugzeug steigen, wendet sich John mir fürsorglich zu und warnt: „Du musst gut auf dich aufpassen und vorsichtig sein. März und April sind gefährliche Monate. Das Eis auf dem See wird brüchig. Wenn du Trinkwasser aus dem Eisloch holst und einbrichst, kann dir niemand helfen, und du bist schnell erfroren. Das ist eine viel größere Gefahr als ein Bär.“
Keiner von beiden hat wortwörtlich die Zusage ausgesprochen, doch da Bob einen Vertrag zwischen mir und Johns Outfitter-Unternehmen (so werden Tourveranstalter und Ausrüster hier genannt) aufsetzen soll, kann das doch nur heißen, dass ich meinen Plan verwirklichen kann.
Was habe ich für ein Glück, denke ich, während wir drei am Seeufer stehen und dem Flugzeug hinterherschauen, bis es über den Bergen verschwindet. Am Anfang war meine Kanadaüberwinterung nur ein Traum gewesen, aus dem der starke Wunsch entstand, ihn zu verwirklichen. Allmählich entwickelte sich ein Plan, der immer konkreter wurde. Und jetzt habe ich mit den beiden Kanadiern erfahrene und verantwortungsvolle Partner an meiner Seite, die mich ernst nehmen, mir helfen und mich unterstützen. Was mehr könnte ich mir wünschen?
Ich sitze mit Helmut auf der Holzbank am Grillplatz, um mich mit ihm über das Treffen auszutauschen, während Bob sich wieder der Reparatur am Toilettenhäuschen widmet. Noch benommen von dem Gespräch und der Konzentration, die mich die Stunden in englischer Sprache gekostet haben, kann ich vorerst keinen klaren Gedanken fassen. Mich durchströmt ein großes Glücksgefühl. Wie seltsam – glücklich sein wollte ich nie. In meiner Jugend war ich der Meinung, Glück wäre wie Opium, würde mich in einen schläfrigen Zustand versetzen, betäuben und mir die Kraft rauben, für meine Ziele zu kämpfen. Damals konnte ich nicht verstehen, warum Menschen sich nach Glück sehnen. Leben war und ist für mich, Herausforderungen zu bestehen, Pläne zu schmieden und zu verwirklichen, sich zu entwickeln und zu verändern. Paradoxerweise, obwohl ich früher so abwertend über das Glück gedacht habe, führe ich ein glückliches Dasein. Doch wichtig ist mir nach wie vor, mein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, nicht zu warten und zu hoffen, dass sich Wünsche erfüllen, sondern selbst dazu beizutragen.
„Na ja“, meint Helmut, dem ich gerade meine Gedanken mitgeteilt habe. „Mitunter kann es nützlich sein abzuwarten. Manche Probleme lösen sich dann von selbst und besser, als man es gekonnt hätte.“
„Das kann sein“, gebe ich zu. „Wie du aber weißt, bin ich ein ungeduldiger Mensch. Lieber nehme ich eine Fehlentscheidung in Kauf, statt tatenlos abzuwarten.“
„Manchmal genügt schon ein kurzer Moment, um stillzuhalten und nachzudenken“, sagt er lächelnd.
Mit Helmut verbindet mich eine Seelenverwandtschaft. Wir denken und fühlen ähnlich. Immer wieder sind wir verblüfft, wenn der eine etwas sagt, was der andere gerade in diesem Moment gedacht hat. Dabei kennen wir uns erst seit fünf Jahren. Meine Freunde waren total überrascht, als meine Wahl auf Helmut gefallen ist. Von unserer beruflichen Ausrichtung passen wir, von außen gesehen, erst einmal nicht zueinander. Helmut hat nicht wie ich Biologie studiert oder ein anderes verwandtes Fach, sondern Betriebswirtschaft und arbeitet als Firmenkundenbetreuer bei einer Bank.
„Sag mal, was willst du denn mit einem Banker?“, fragten ungläubig die Freunde. „Du bist doch auf Natur, Tiere, Abenteuerreisen abonniert.“
Über die Jahre hinweg hatte ich vergeblich nach einem Partner Ausschau gehalten, der ähnliche Vorlieben wie ich hat, mit dem ich gemeinsam meine abenteuerlichen Unternehmungen hätte durchführen können. Als ich Helmut kennenlernte, begriff ich, dass ich bei meiner Suche völlig falsche Prioritäten gesetzt hatte. Statt mich nach einem Fotografen oder Tierfilmer umzuschauen, hätte ich lieber nach jemandem suchen sollen, der meine Gefühle erwidert. Doch die hatte ich vor mir selbst verborgen, weil mir die Verwirklichung meiner Träume wichtiger war. Mein Leben in die von mir gewünschte Bahn zu lenken hatte mir enorme Kraft abverlangt, da wollte ich mich nicht durch die Liebe und ihre Irrungen und Wirrungen von meinem Weg abbringen lassen. Gefühle hatte ich einfach nicht zugelassen und sie wie in einer Kühltruhe fest verschlossen. Erst Helmut hatte den Schlüssel, und so ist er mein Lebenspartner geworden. Gut hat es sich gefügt, dass er trotz seines kaufmännischen Berufs ein echter Naturbursche ist. Aufgewachsen in einem Dorf, wo all seine Vorfahren Bauern waren und sein Vater der Hoferbe hätte sein sollen, ist Helmut von klein auf mit der Natur und dem ländlichen Leben verbunden gewesen. Seine Wurzeln pflegt er, wohnt dort, wo er geboren wurde und seine Verwandten leben, und er ist wohl der einzige Banker auf der Welt, der nicht nur einen eigenen Wald besitzt, sondern auch eigenhändig Bäume fällt, das Holz mit der Axt spaltet und nicht mit einer Spaltmaschine. Bei Wanderungen in den Alpen haben wir uns erprobt, und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass unsere Wildniswanderung ein wunderbares Erlebnis werden wird.
Bob hat inzwischen die Tür des Häuschens repariert und fragt uns, ob wir angeln wollen. Wir sind nicht erpicht darauf. Weder Helmut noch ich sehen ein Vergnügen darin, einen Fisch mittels eines Köders zu überlisten und gewaltsam aus seinem angestammten Element zu reißen. Für mich gibt es nur einen Grund zu angeln, und zwar, wenn die Nahrung knapp ist und das eigene Überleben vom Fischfang abhängt. Im Angeln ein Vergnügen zu sehen, widerstrebt mir zutiefst. Im Winter werde ich vielleicht versuchen, aus dem Eisloch meinen Eiweißbedarf zu decken, jetzt aber genießen wir lieber die Stille am See, freuen uns, dass wir hier sind, dass der Traum Wirklichkeit geworden ist.
Zwei schwarze Vögel fliegen über den See hinüber zum anderen Ufer. Es sind Kolkraben, bussardgroß und durch ihren keilförmigen Schwanz von den Rabenkrähen zu unterscheiden. Ihre sonoren Rufe klingen vertraut. Korrk und klong, klong schallt es schnarrend über das Wasser, als würde eine Glocke geschlagen. Es ist die gleiche Art Kolkraben, die auch in Europa vorkommt. Mein Herz hüpft freudig, wie immer, wenn ich diese intelligenten Gefiederten sehe und höre.
Am Himmel kreist ein noch größerer Vogel mit dunklen Schwingen und leuchtend weißer Unterseite. Auch diese Art kenne ich aus Deutschland. Es ist ein Fischadler, in Kanada osprey genannt. In Mecklenburg hatte ich Fischadler bei der Jagd beobachten können. Hatten sie beim Kreisen über dem Wasser einen Fisch erspäht, legten sie die Flügel dicht an den Körper und schossen wie ein Pfeil herab, die Fänge weit vorgestreckt. Hoch spritzte das Wasser auf, wenn der Vogel eintauchte und für einen Moment verschwunden war, und schon stieg er wieder aus den Fluten auf, in seinen Fängen glitzerte silbern die Beute. Während sich der Adler damals in die Luft erhob, schüttelte er sein Gefieder, und ein Regen sprühender Wassertropfen fiel in den See zurück. Ein faszinierender Anblick. Wie wunderbar, dass es diese mächtigen Greifvögel noch auf unserer Erde gibt. Der kanadische Fischadler schraubt sich höher und höher in den Himmel hinauf und entschwindet unseren Blicken.
Bob lässt sich durch unser Desinteresse nicht vom Angeln abhalten und greift selbst nach der Rute. Dort, wo der Bergbach in den See mündet, wirft er die Leine aus, beködert mit einer künstlichen Fliege. Wir können es nicht fassen, nur drei Mal hat er die Angel geworfen, da zappelt ein Fisch am Haken – eine Seeforelle, mindestens einen Meter lang. Sie hatte ihr Revier hier, wo der Bach organisches Material in den kalten, nährstoffarmen See einbringt.
Oh, wie schade, denke ich, dass ein so großer Fisch sein Leben einbüßen musste. Wie viele Jahre er wohl im See gelebt hat, um zu so stattlicher Größe heranzuwachsen? Aber wie erschrecke ich, als Bob die Forelle aufschneidet und ihr Leib mit orangefarbenem Rogen, den Fischeiern, gefüllt ist. Es war also ein Weibchen. Eine neue Generation Seeforellen hätte heranwachsen können. Später erfahren wir von der Reitergruppe, die nach uns am Rainbow Lake geangelt hat, dass John, der diese Gruppe führte, dafür sorgte, dass nur kleine Forellen gefangen wurden, größere mussten wieder freigelassen werden.
Bob schlägt vor, die Forelle erst am Abend zu essen und nach einem schnellen Mittagsimbiss mit dem Kanu über den See zu paddeln und am anderen Ufer zu einem Wasserfall zu wandern.
Begeistert stimmen wir zu und freuen uns, mehr von der Gegend zu sehen. Vielleicht können wir unterwegs auch das ein oder andere Tier beobachten. Zwar würde ich gern Fotos vom Paddeln machen und von der Mitte des Sees aus unser Camp fotografieren, vorsichtshalber verpacke ich den Apparat aber lieber in einem wasserdichten Sack.
Zu dritt im Kanu ist es ziemlich eng. Ich hocke in der Mitte bei den Rucksäcken und vermeide jede Bewegung in dem wackeligen Boot. Helmut sitzt vorn mit einem Paddel, Bob will hinten paddeln und steuern. Kaum haben wir uns vom Ufer abgestoßen, da passiert es blitzschnell. Noch bevor wir in Fahrt kommen, kippt das Kanu um, und wir drei fallen kopfüber ins Wasser. Ich kann gerade noch meinen Rucksack mit den Fotosachen packen und strample nach oben. Der See ist unweit des Ufers bereits so tief, dass ich keinen Boden unter den Füßen habe. Unangenehm, wie das kalte Wasser, nachdem es Anorak, Hose, Pullover und Unterwäsche durchtränkt hat, bis zu meiner Haut vordringt. Prustend und hustend streben wir dem rettenden Ufer zu. Am glitschigen erhöhten Rand rutsche ich ab und plumpse zurück ins kalte Nass. Der Rucksack mit der schweren Fotoausrüstung, den ich umklammere, drückt mich unter Wasser. Da reicht mir Helmut schon die Hand und zieht mich samt Rucksack heraus. Wie begossene Pudel tropfen wir drei um die Wette, eigentlich ein Bild zum Lachen. Was sind wir doch für Anfänger, kippen um, noch bevor wir richtig „in See gestochen“ sind. Uns jedoch ist nicht zum Lachen zumute. Alles ist pitschnass, und ich bin besorgt, ob die Verpackung meiner Kamera dem unfreiwilligen Bad standgehalten hat. Wir flüchten uns in unsere Hütten, schüren das Feuer und drapieren Kleidung und Schuhe zum Trocknen rund um den Ofen.
Ich habe schon manche Kanu- und Kajaktour gemacht und kann mir nicht erklären, warum wir umgekippt sind. Beim Abendessen berichtet Bob, er habe das Boot gründlich untersucht, aber die Ursache nicht finden können. Vielleicht sei es mit drei Personen plus Gepäck einfach zu schwer beladen gewesen.


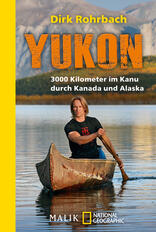

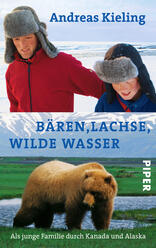


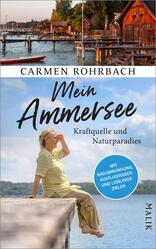



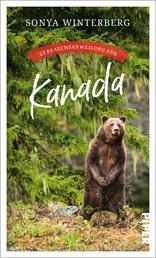

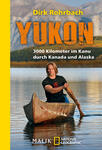


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.