Bronzener HOMER 2024 für Ulrike Fuchs
Piper-Autorin Ulrike Fuchs erhielt für ihren historischen Roman „Reporterin für eine bessere Welt“ die renommierte Auszeichnung. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer feierlichen Gala am Samstag, den 14. September, in Lübeck statt.
Wie es in der Begründung der Jury heißt, gelingt es Ulrike Fuchs mit ihrem Roman über die bedeutende Reporterin Nelly Bly, einen bedeutenden Abschnitt der Geschichte einzufangen. Dabei zeichne sie den Geist, die Sitten und die sozialen Umstände jener Ära mit akribischer Detailtreue und faktischer Genauigkeit nach und weise zudem eine hohe literarische Qualität auf.
Neben Ulrike Fuchsstanden acht weitere Autor*innen, darunter auch Piper-Autor Jørn Precht für „Die Heilerin vom Rhein“ auf der Shortlist. Der Goldene HOMER ging dieses Jahr an Michael Römling für „Tankred“, der Silberne HOMER an Noah Martin für „Florentia – Im Glanz der Medici“.
Geboren 1967 in Schleswig-Holstein, ist Ulrike Fuchs Übersetzerin und Autorin. Sie studierte in Berlin und Kiel Altgermanistik sowie Geschichte. Danach absolvierte sie ein Volontariat zur Fernsehredakteurin in Hamburg. Anschließend arbeitete sie als Drehbuchautorin und Texterin. Sie lebt in den USA und Deutschland und veröffentlichte bereits belletristische Werke unter dem Pseudonym Laura Bastian.

Bronzener HOMER 2023 für „Botschafterin des Friedens“
Eva Grübl gewinnt mit „Botschafterin des Friedens“ den bronzenen HOMER Literaturpreis 2023.
Mit ihrem ersten historischen Roman bei Piper konnte sich die gebürtige Wienerin den dritten Platz bei der diesjährigen Verleihung des HOMERS sichern. Der HOMER Literaturpreis will die Vielfalt der historischen Unterhaltungsliteratur fördern und zeichnet die besten historischen Romane des Jahres aus. Über den goldenen HOMER kann sich der Wiener René Anour für „Die Totenärztin“ freuen.
In ihrer Romanbiografie erzählt Eva Grübl das spannende Leben der österreichischen Pazifistin Bertha von Suttner. Die Friedensforscherin und Schriftstellerin wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und ist bis heute eine Ikone der Friedensbewegung. „Botschafterin des Friedens. Ihr Kampf für die Liebe war ein Skandal, ihr Kampf gegen die Waffen veränderte die Welt“ ist im Juli 2022 erschienen und ist Teil der Piper-Reihe über „Bedeutende Frauen, die die Welt verändern“.


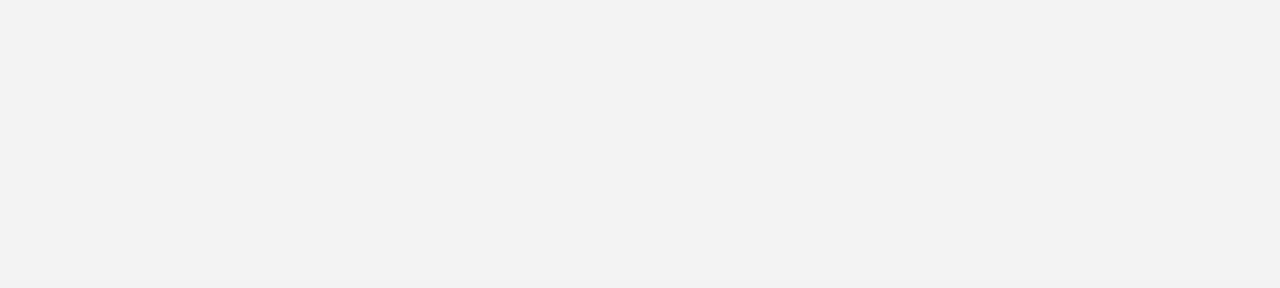





Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.