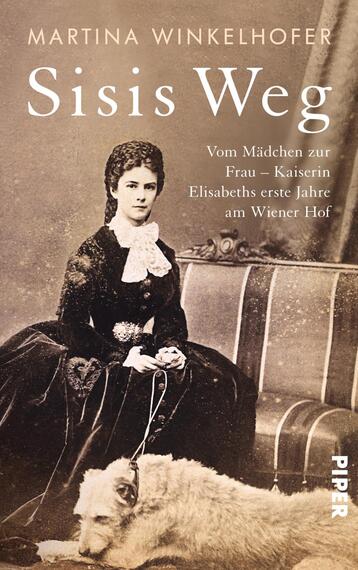
Sisis Weg - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Kaiserin Elisabeth gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Frauen der Geschichte. Längst ist Sisi zum Mythos geworden. Doch was wissen wir wirklich über ihr Leben? Wie sah ihr Alltag aus? Welche gesellschaftlichen Normen und Ideale beeinflussten ihr Fühlen, Denken und Handeln? Und wie unterschied sie sich von anderen Frauen ihres Standes?
Martina Winkelhofer hat erstmals zahlreiche Originalquellen zum Alltagsleben Elisabeths ausgewertet und den Sisi-Mythos neu hinterfragt. Überzeugend und detailgetreu zeigt sie eine neue Seite der legendären, österreichischen Kaiserin: die private Sisi vor dem…
Kaiserin Elisabeth gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Frauen der Geschichte. Längst ist Sisi zum Mythos geworden. Doch was wissen wir wirklich über ihr Leben? Wie sah ihr Alltag aus? Welche gesellschaftlichen Normen und Ideale beeinflussten ihr Fühlen, Denken und Handeln? Und wie unterschied sie sich von anderen Frauen ihres Standes?
Martina Winkelhofer hat erstmals zahlreiche Originalquellen zum Alltagsleben Elisabeths ausgewertet und den Sisi-Mythos neu hinterfragt. Überzeugend und detailgetreu zeigt sie eine neue Seite der legendären, österreichischen Kaiserin: die private Sisi vor dem Hintergrund ihrer Zeit.
Über Martina Winkelhofer
Aus „Sisis Weg“
Vorwort
Seit ich vor vielen Jahren zum ersten Mal die Zeremonialprotokolle des Kaiserhofes in den Händen hielt, fasziniert mich die Figur der jungen Kaiserin Elisabeth. Das schüchterne sechzehnjährige Mädchen, von dem heute alle Welt denkt, es in- und auswendig zu kennen, zog mich mit all seiner Eleganz und Tapferkeit in seinen Bann. Die kostbaren Quellen, die heute im Haus-, Hof- und Staatsarchiv verwahrt werden, zeichnen ein deutliches Bild von der gigantischen und komplexen Organisation des Wiener Kaiserhofes, der als vornehmster Hof des alten Europas galt. Die [...]




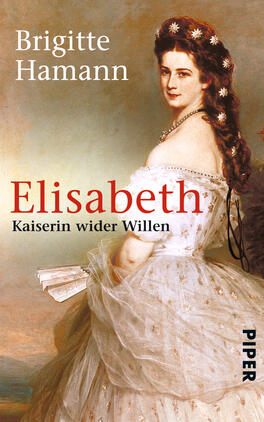
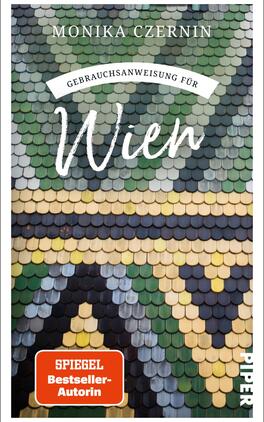

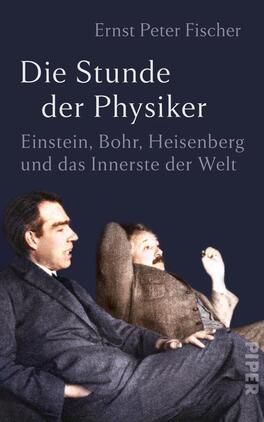
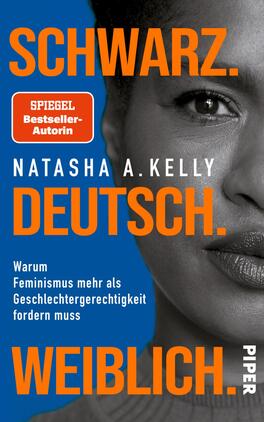


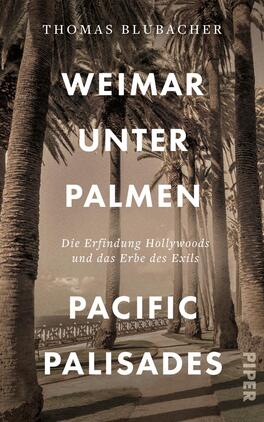


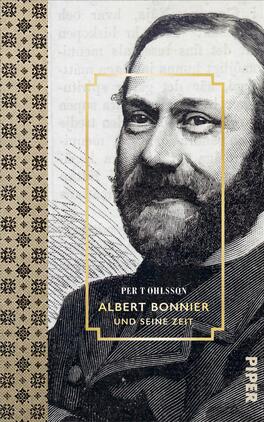




Die erste Bewertung schreiben