

Mia san mia - eBook-Ausgabe Mia san mia
Die andere Geschichte Bayerns
„Die für ein solches Werk bis dato unerreichte Klammer von der Römerzeit bis zum Bayern des Horst Seehofer setzt Fiedler mit der leichten Feder des Journalisten.“ - Süddeutsche Zeitung
Mia san mia — Inhalt
Seit die „Boiari“ aus dem Nebel der Völkerwanderung aufgetaucht sind, halten sie sich für etwas Besonderes. Nichtbayern, Nachbarn oder Feinde (was für die Bayern eigentlich immer dasselbe war) sehen das mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung, aber sie nehmen es hin. Denn bei den Bayern entfaltet die Geschichte ihre ganze Farbigkeit, malt das Geschehen immer noch etwas bunter, prächtiger, oft auch maßloser als im Rest Deutschlands. Teja Fiedler spannt ein Panorama, das vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart reicht. Da gibt es Kaiser (nicht nur im Fußball), Könige (normale und verrückte), Kriege um Land, Religion und Bier, aufsässige Bauern und große Literaten, Kunst und Kultur wie in kaum einer anderen Region. Bayern ist weit mehr als Ludwig-Kult, Laptop und Lederhose, das zeigt Teja Fiedler ebenso amüsant wie erhellend.
Leseprobe zu „Mia san mia“
Das Bajuwaren-Puzzle
Seit der Erschaffung der Welt sind Anfänge gern ins Dunkel gehüllt. Das gilt auch für die Bayern. Der Münchner Hof-Historiker Aventinus glaubte im 16. Jahrhundert zwar zu wissen, die „Baiern“ seien schon vor Christi Geburt im heutigen Altbayern gesessen. Dann über 500 Jahre lang von den Römern geknechtet worden, schließlich aber mit Verstärkung durch Stammesgenossen von jenseits der Donau über die Besatzer hergefallen und hätten „also sich und ihre Vorvorderen gerächt“.
Nun ist Aventins Version der bairischen Frühgeschichte der [...]
Das Bajuwaren-Puzzle
Seit der Erschaffung der Welt sind Anfänge gern ins Dunkel gehüllt. Das gilt auch für die Bayern. Der Münchner Hof-Historiker Aventinus glaubte im 16. Jahrhundert zwar zu wissen, die „Baiern“ seien schon vor Christi Geburt im heutigen Altbayern gesessen. Dann über 500 Jahre lang von den Römern geknechtet worden, schließlich aber mit Verstärkung durch Stammesgenossen von jenseits der Donau über die Besatzer hergefallen und hätten „also sich und ihre Vorvorderen gerächt“.
Nun ist Aventins Version der bairischen Frühgeschichte der Wahrheit zwar noch deutlich näher als die Behauptungen phantasievoller Schreiber aus dem Mittelalter. Sie behaupteten, das Volk der Bajuwaren stamme wahlweise aus dem biblischen Land der Arche Noah oder gar vom griechischen Halbgott Herakles ab, doch auch seine These hat einen großen Haken. Als die Römer das Land zwischen Alpen und Donau im Jahr 15 vor Christus in Besitz nahmen, gab es überhaupt noch keine Baiern.
Wer damals dort siedelte, das waren die Kelten. Ein Volk, das die ältere Geschichtsschreibung gerne als unstet und rätselhaft titulierte, weil es überall in Europa bis hin nach Kleinasien Spuren, leider aber nichts brauchbar Schriftliches hinterließ. Und so wissen wir heute vor allem durch archäologische Funde, dass die Kelten strategisch geschickt platzierte und mit Erdwällen geschützte Siedlungen anlegten, Könner im Metallhandwerk und Wagenbau waren, einen Gott mit einem Hirschgeweih verehrten und eigenwillige Goldmünzen, die sogenannten Regenbogen-Schüsselchen, prägten. Letzteres taten sie in so großer Zahl, dass im Lauf der Jahrhunderte genügend davon auf Äckern und Wiesen gefunden wurden, um den Volksmund poetisch zu beflügeln: Dort, wo ein Regenbogen auf die Erde trifft, schlägt er sich als Gold nieder.
Erfreulicherweise hat ein gewisser Julius Cäsar in der Rechtfertigungsschrift seines Eroberungskrieges namens „De Bello Gallico“ jenseits einer Menge Eigenlob aber doch so viel über die tapferen Gallier, sprich die Kelten, geschrieben, dass man daraus sogar einen höchst erfolgreichen Comic machen konnte. „Asterix und Obelix“ haben unser Keltenbild weit mehr geprägt als gesicherte historische Erkenntnisse: Kelten, zumindest die aus einem kleinen, gallischen Dorf, fürchten nichts, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Sie essen Wildschwein in Massen, trinken ein Urbier namens „cervisia“ und haben eine Gewissheit: „Die spinnen, die Römer!“ Dafür vermöbeln sie Cäsars Legionäre regelmäßig.
Zum Glück für die echten Römer wurden die Kelten zwischen Donau und Alpen im wahren Leben den Asterix-Maximen nicht gerecht. Sie ergaben sich den anrückenden Legionen unter Drusus und Tiberius im Jahr 15 vor Christus nach einer sehr nebulösen, doch wohl verlorenen Schlacht am Bodensee ohne große weitere Gegenwehr.
Einer der besiegten keltischen Stämme hieß zum Unglück für die bayerische Geschichte „Boier“. Laut Tacitus, dem unbestrittenen Deutschlandexperten des Römischen Reichs, wohnten diese Boier – wie üblich nur vage zu lokalisieren – irgendwo nördlich der Alpen. Weil „Boier“ und „Baier“ so verführerisch ähnlich klingen und Tacitus außerdem eine Autorität war, fielen die Chronisten aller Zeiten gerne auf diesen Beinahe-Gleichklang herein. Schon im 7. Jahrhundert konstatierte der Abt Jonas von Bobbio in einer Heiligen-Vita: „die Boier, die man jetzt Baiern nennt“. 800 Jahre später machte dann auch Aventin die keltischen Boier zu den Urbayern – und wie er bis vor Kurzem noch Heerscharen beflissener Historiker mit altphilologischem Hintergrund.
Nach ihrer Niederlage stellten die Kelten zwischen Alpen und Donau das Prägen der niedlichen Regenbogen-Schüsselchen ein und stiegen als Untertanen des Römischen Reichs wie damals fast alle zivilisierten Menschen in Europa auf die Sesterze als Münze um. Sie erfreuten sich an den Annehmlichkeiten der Eroberer und legten auch sonst sehr schnell jegliche Berührungsängste mit ihnen ab: Schon ein Jahrhundert später kann man von einer keltisch-romanischen Mischbevölkerung in diesem Raum sprechen, der zum größten Teil der Provinz Raetien angehörte. Die Boier als Volk gab es nicht mehr, und so konnten sie auch keine rächenden bajuwarischen Urenkel hervorbringen. Die Stammväter der Bajuwaren – die „Altvorderen“ für Aventinus – sind es definitiv nicht.
Das heutige Südbayern bis zur Donau wurde zu einer ländlichen, eher schläfrigen römischen Provinz. Die Menschen lebten auf verstreuten Gutshöfen, den „villae rusticae“, in den wenigen Städten, voran Augusta Vindelicum, heute Augsburg, und Cambodunum, Kempten, oder als Grenzsoldaten in Kastellen wie Castra Regina, Regensburg. Die Wohlhabenden schmückten ihre Häuser mit klassischen römischen Mosaiken, hielten sich in den kalten Wintern die Füße mittels der weitverbreiteten Unterflurheizung warm und reisten auf sprichwörtlich guten, da gepflasterten Straßen so flott über Land wie es nach dem Untergang des Römischen Weltreichs weit mehr als 1000 Jahre nie wieder der Fall sein sollte. Sie labten sich – wir wissen es durch archäologische Funde aus dem antiken Kempten – exquisit an Weinbergschnecken, Fröschen, Amseln, Drosseln und sogar Austern oder Venusmuscheln von weit her.
Man konnte fast allgemein lesen und schreiben, ging ins öffentliche Bad und auf die öffentliche Latrine mit Wasserspülung unter den Sitzen, hatte auch in kleineren Städten ein Theater, das mit derb-lustigen Stücken die größten Erfolge feierte. Natürlich auch das eine oder andere Bordell mit erstaunlich volksnahen Tarifen. Und auch in der Provinz musste man nicht auf die blutrünstige Massenbelustigung Nummer eins, die tödlichen Gladiatorenkämpfe, verzichten, auch wenn die Arenen, wo diese Metzeleien stattfanden, hier keine repräsentativen Steinbauten wie das Kolosseum in Rom waren, sondern wohl nur aus Holzaufbauten und Erdaufschüttungen bestanden. Man verpflanzte aus Italien sowohl die Weinrebe ins Land nördlich der Alpen als auch die römische Mythologie, deren Protagonisten von Merkur bis Minerva die keltischen Götter mitsamt ihren Druiden-Priestern schnell verdrängten.
Und so schien, was heute Altbayern ist, auf dem besten Weg, romanisch zu werden. So wie die römischen Eroberungen Gallien und Hispanien im Lauf der Zeit zu Frankreich und Spanien bzw. Portugal wurden. Das hätte für das Bayernland Pasta statt warmen Leberkäs, Rotwein statt Weißbier, mediterrane Sprachmelodik statt gutturaler nördlicher Wortkaskaden und aalglatte Bösewichte statt raubeiniger Halunken bedeutet. Wenn es so gekommen wäre … doch so kam es nicht.
Denn in den undurchdringlichen Wäldern nördlich der Donau lauerten die wilden Völker der Germanen und schauten zunehmend begehrlich ins zivilisierte Raetien herüber. Ihre eigene Romanisierung war 9 nach Christus mit der vernichtenden Niederlage des Varus in der sogenannten Schlacht im Teutoburger Wald (die aber wohl irgendwo anders in Ostwestfalen stattfand) gescheitert. Tacitus zeichnete mit Blick auf seine Landsleute, bei denen er nur Lotterleben und Verweichlichung sah, ein leuchtendes, wenn auch manchmal befremdliches Bild dieser unbezähmbaren Feinde mit „blauen Augen, trotzigem Blick, rötlich blonden Haar und hoch gewachsenen Körpern“.
Sie leben laut Tacitus „… in den Schranken der Sittsamkeit, durch keine lüsternen Schauspiele, keine verführerischen Gelage verdorben … Fälle von Ehebruch sind bei dem so zahlreichen Volk eine große Seltenheit. Ihre Bestrafung erfolgt auf der Stelle und ist dem Gatten überlassen. Mit abgeschnittenem Haar, entkleidet, stößt sie der Gatte in Gegenwart der Verwandten aus dem Haus und treibt sie mit Schlägen durch das Dorf.“ Ehebrechende Gatten findet Tacitus übrigens nicht der Rede wert.
Allerdings, das schon, seien die sittsamen Germanen dem Trunk zugeneigt mittels einer „Flüssigkeit, die aus Gerste oder Weizen ganz ähnlich dem Wein zusammengebraut ist“, was nicht selten zu Mord und Totschlag führe. Sie verbrächten ganze Tage mit Würfelspiel, bei dem sie häufig sogar ihre Freiheit verspielten und dann ohne sich zu wehren als Sklaven abgeführt würden. Auch wenn ihre Bewaffnung schlecht sei – dies glichen sie aber durch große Tapferkeit aus –, stehe Kriege zu führen in hohem Ansehen. Rechtschaffener körperlicher Arbeit seien sie dagegen nur mäßig zugetan: „Sie halten es für Faulheit und Schwäche, mit Schweiß zu erwerben, was man mit Blut gewinnen kann.“
Solange das Römische Weltreich funktionierte, hielten Grenztruppen und Grenzbefestigungen, wie vor allem der über 500 Kilometer lange Limes zwischen Donau und Rhein, die rotblonden, würfelnden Biertrinker im Schach. Es gab nicht selten lange friedliche Perioden mit regem Handel über die Grenze hinweg. Vor allem die Oberschicht der einzelnen germanischen Stämme deckte sich gerne mit Schmuck, Waffen und Hausrat römischer Herkunft ein. Doch schon Kaiser Marc Aurel musste zwischen 167 und 180 nach Christus in zwei erbitterten Kriegen gegen die Markomannen und deren Verbündete die Donaugrenze verteidigen.
Und als im 3. Jahrhundert das Römische Reich durch ziviles und militärisches Chaos, drückende Steuerlast und galoppierende Inflation endgültig zu bröckeln anfing, war es mit dem ruhigen Leben im schönen Raetien für immer vorbei. Die rivalisierenden Soldatenkaiser, die meist schon wieder ermordet wurden, bevor sie richtig regierten, konnten trotz Truppenverstärkungen Beutezüge der Germanen bis tief hinein in römisches Gebiet nicht mehr verhindern. Getreu ihrer Maxime, lieber mit Blut als mit Schweiß zu erwerben, mordeten und plünderten die Eindringlinge in Raetien ohne Erbarmen.
In zwei Brunnenschächten einer römischen Villa in der Nähe von Regensburg etwa fanden Archäologen Schädel und abgehackte Glieder von 13 Männern, Frauen und Kindern. Allem Anschein nach waren die Bewohner des Gutshofs skalpiert, gemartert, erschlagen und in den Brunnen geworfen worden. Aufgrund der Spuren an den Knochen liegt sogar der Verdacht auf Kannibalismus nahe. Verstört flüchteten die Überlebenden mehr und mehr in die Städte, die jetzt auch im Inneren Raetiens befestigt wurden. Die Gutshöfe wurden weitgehend aufgegeben, das flache Land verödete. Die Bevölkerung der Provinz verringerte sich drastisch. Das öffentliche Leben verkümmerte.
Rom versuchte sich zu wehren. Da eigene Soldaten knapp waren, heuerten die Kaiser ausgerechnet germanische Söldner an. Zur Zeit von Kaiser Konstantin um 300 nach Christus bestand das ruhmreiche römische Heer schon zu einem großen Teil aus Germanen. So standen sich an den Grenzen oft Angehörige eines Stammes als Feinde gegenüber, die einen als römische Söldner, die anderen als beutegierige Invasoren. Nicht selten nahmen die Römer aber auch ganze Volksgruppen als „foederati“, Verbündete, ins Reichsgebiet auf, die sich dort ansiedelten und die Grenzregionen verteidigen sollten.
Leider war die schreibkundige eingesessene Bevölkerung Raetiens zu sehr mit dem Überleben beschäftigt, als dass sie irgendwelche schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hätte. Und die Neuankömmlinge hatten mit Lesen und Schreiben sowieso wenig im Sinn. Und so müssen wieder die Archäologen ran, um zumindest schwaches Licht ins vorbayerische Dunkel zu bringen.
Nach ihren Erkenntnissen scheinen viele der Neusiedler an der Donaugrenze uns namentlich unbekannte Germanen aus Böhmen gewesen zu sein. Wenn sie gerade nicht mit Plündern beschäftigt waren, lebten sie wohl häufig in Koexistenz mit der keltisch-romanischen Bevölkerung. Wenigstens legen Gräberfunde von Friedhöfen aus dem 4. und 5. Jahrhundert, bei denen typisch germanische Tongefäße in friedlicher Nachbarschaft mit klassisch römischer Keramik gefunden wurden, diesen Schluss nahe. Westgoten, Elbgermanen und thüringische Stämme dürften ebenso eingesickert sein, wie andere Grabbeigaben vermuten lassen. Und so herrschte ein rechter Mischmasch im Lande – aber noch immer herrschten nicht die Bajuwaren.
Zumindest wird ihr Name in der einzigen vernünftigen schriftlichen Quelle aus dem bayerischen Raum im 5. Jahrhundert nicht erwähnt. Das Römische Reich war unter Kaiser Konstantin, gestorben 337 nach Christus, christlich geworden, von Kaiser Theodosius wurde das Christentum dann gegen Ende des 4. Jahrhunderts zur Staatsreligion erhoben. Und so ist es kein Zufall, dass es sich bei diesem Text um die Biografie des Einsiedlers Severin, eines Heiligen, handelt, verfasst nach dessen Tod von einem seiner Schüler.
Hier erfahren wir, wie der Mönch Severin erstaunlich weltgewandt und weltzugewandt um 480 nach Christus in Raetien und der angrenzenden Provinz Noricum, grob dem heutigen Österreich, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Lager Künzing erst nach Passau und dann noch weiter die Donau abwärts organisierte. Denn überall drohten in der Folge der durch den Hunnensturm ausgelösten Völkerwanderung jetzt germanische Attacken – das Römische Reich taumelte seinem Untergang entgegen. In der Vita des hl. Severins werden eine Menge Orte, Flüsse, Landschaften und Völker im heutigen Bayern aufgeführt, der Name Bajuwaren kommt jedoch nicht vor.
476 hatte in Italien der Germanenfürst Odoaker die Macht übernommen und den letzten Kaiser Romulus Augustulus („Das Kaiserlein“) in die Verbannung geschickt. Kurz nach Severins Tod ordnete Odoaker, der sich durchaus als neuer Augustus fühlte, im Jahr 488 für die Menschen römischen Geblüts und die wenigen verbliebenen Truppen die Rückkehr aus den unhaltbaren Provinzen Raetien und Noricum nach Italien an. Die Oberschicht aus Verwaltungsbeamten, höheren Offizieren und Kaufleuten leistete wohl Folge. 500 Jahre römischer Herrschaft nördlich der Alpen endeten ohne großes Spektakel wie mit einem leisen Seufzer.
In dieses Vakuum stießen recht ungehindert weitere germanische Eroberer und Siedler. Vakuum? Nur was die Macht anging. Raetien war nicht menschenleer. Ein guter Teil der Bewohner, schon jetzt ein Gemisch aus Kelten, Römern und Germanen aller Schattierungen, hatte die Heimat nicht verlassen. Sie wurden von den Neuankömmlingen nicht ausgelöscht oder vertrieben, die verstärkte Zuwanderung erhöhte allerdings den germanischen Anteil der Bevölkerung.
Und jetzt endlich tauchen sie plötzlich wie aus dem Nichts auf, die Bajuwaren, wenn erst auch einmal nur in zwei Randnotizen. 50 Jahre nachdem der heilige Severin noch kein Wort über sie verloren hatte, schrieb der Historiker Jordanes in seiner Gotengeschichte den entscheidenden Satz: „Das Land der Schwaben hat im Osten die Baiobaren … zu Nachbarn.“ Und ein paar Jahrzehnte später bekräftigte der spätantike Poet Venantius Fortunatus ihre Existenz. Nachdem der Reisende in Augsburg die Gebeine der Märtyrerin Afra verehrt habe, meint der Dichter, könne er anschließend übers Gebirge (die Alpen) heimkehren nach Italien, „wenn die Straße offen ist und dir nicht der Baier entgegentritt“.
Abgesehen davon, dass schon in dieser kurzen Bemerkung vom „Entgegentreten“ das leicht Herausfordernde des bayerischen Wesens anklingt, belegt sie eindeutig: Mitte des 6. Jahrhunderts waren die Bajuwaren in der Historie und in ihrer künftigen Heimat angekommen. Ganz sicher nicht so, wie sie die patriotisch-nationalistische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts gerne sah: Einmarschiert um 550 nach Christus als trutziges Germanenvolk in schimmernder Wehr, voran auf einem feurigen Schimmel ein König oder Herzog mit wallendem Blondhaar.
Nein, was der Dichter als „baibaros“ bezeichnet, ist die Quersumme aus keltischen, römischen und germanischen Elementen, die sich jetzt, warum auch immer, als Einheit verstanden und so von außen auch wahrgenommen wurden. Weshalb sich für dieses multikulturelle Amalgam ausgerechnet der Name Bajuware durchsetzte, darüber streiten die Gelehrten noch heute. Weil die Quellenlage so dürftig ist, streiten sie sich besonders erbittert. Am wahrscheinlichsten scheint die Theorie, dass ein Teil des Völkergemisches, nämlich die Einwanderer aus „baiahem“, also Böhmen, kulturell oder machtpolitisch dominant genug war, um pars pro toto der gesamten Bevölkerung den Namen zu geben. Ein ähnliches Phänomen wie „Allemand“ oder „Alemán“ in Französisch und Spanisch, wo aus dem Namen eines Stammes, den Alemannen, die Bezeichnung für alle Deutschen wurde. So sehr wir im Detail auch im Dunkeln tappen, eines steht fest: Der Bayer ist nicht aus einem Guss.
Baiern bis Herzog Tassilo
Da gibt es endlich die Bajuwaren, doch ihr langer Weg durch die Geschichte, den dereinst Meilensteine wie ein exkommunizierter bairischer Kaiser, das Reinheitsgebot für Bier, König Ludwigs genialischer Wahnsinn oder die jahrzehntelange absolute Mehrheit der CSU säumen sollten, beginnt nicht anders, als das römische Vorspiel auf bairischem Boden geendet hatte: in dichtem historischem Nebel.
Die Konturen der ersten 200 Jahre bairischer Herrschaft sind mehr als verschwommen. Bis zum Jahr 700 tauchen ganze drei Herzöge namentlich auf – nebst der einen oder anderen Gattin sowie Widersachern oder Verbündeten vor allem aus den beiden angrenzenden Reichen der Franken und Langobarden. Danach kennen wir zwar durchgehend die Namen der Herrscher, doch die wenigen Nachrichten über sie und ihre Taten sind so knapp und dürftig wie Telegrammtexte.
Die Historiker haben trotzdem versucht, ein Bild der Zeit zu malen, wenn auch mit sehr groben Pinselstrichen. Demnach stammte schon Grimald, der erste uns bekannte Baiernherzog, aus dem Geschlecht der Agilolfinger, und dieses Haus, nicht mehr heidnischen, sondern christlichen Glaubens, regierte bis zum Sturz des tragischen Herzogs Tassilo im Jahr 788. Die Agilolfinger scheinen aus dem fränkischen Herrschaftsbereich zu kommen. Fränkische Quellen, auch sie sehr sporadisch, betonen übereinstimmend, dass die Agilolfinger den Frankenkönigen schon seit jeher untertan gewesen seien, bairische räumen immerhin eine gewisse Abhängigkeit ein.
Da aber die Merowinger nicht selten anderweitig beschäftigt waren – Eroberungen auswärts, Meuchelmorde daheim –, hatten die Baiern häufig freie Hand, und die Herzöge konnten sich zeitweise als souveräne Herrscher fühlen. Es gibt Notizen einer Verehelichung der Tochter Grimalds mit einem Langobardenkönig, obwohl die Franken das Langobardenreich in Oberitalien als Feind und diese Ehe wohl als kontraproduktiv ansahen. Es gibt einen Kurzbericht über eine Reise des Herzogs Theodo zum Papst nach Rom wegen der Einrichtung einer eigenen bairischen Kirchenprovinz – ein früher Schritt in Richtung besonderer Nähe des bairischen Staates zum Stellvertreter Gottes auf Erden. Dieser Sonderstatus überlebte mehr als 1000 Jahre. Noch bis 1934 unterhielt Bayern beim Papst eine eigene diplomatische Vertretung parallel zur deutschen Botschaft.
Doch immer wieder machten die Merowinger und später dann die Karolinger, wenn es sein musste mit Waffengewalt, den Baiern auch klar, dass ihre Souveränität nur eine Scheinselbstständigkeit war. So wurde Tassilo I. 591 ausdrücklich vom Frankenkönig Childebert eingesetzt, und Mitte des 8. Jahrhunderts drückte Karl Martell an der Spitze eines Heeres den ihm genehmen Kandidaten für das bairische Herzogsamt durch. Und so kam es schließlich zwischen Karl dem Großen und Tassilo III. im Jahr 788 zum finalen Showdown, von dem noch die Rede sein wird.
Wo die Grenzen des Herzogtums Baiern damals genau verliefen, lässt sich heute nur schwer sagen. Sicher ist, dass es die ehemaligen römischen Besitzungen zwischen Alpen und Donau vom Lech an bis weit nach Österreich hinein umfasste, dazu Teile der heutigen Oberpfalz und ganz Südtirol. So groß es war, so schön war es auch. Und nicht einmal die Baiern störten:
„Herrlichstes Land, erstrahlend in Anmut, überreich an Wäldern, fruchtbar an Wein, ergiebig an Eisen, an Gold und Silber und Purpur; die Männer hochgewachsen und strotzend in Kraft, aber gutmütig und handsam, das Erdreich gesegnet mit Garben, Zugvieh und Herden so viel, dass sie fast den Boden bedecken; Bienen und Honig in Mengen; in den Seen und Flüssen ein Gewimmel von Fischen; das Land bewässert durch Quellen und Bäche; Salz, was man nur braucht; auch das Bergland fruchtbar und für die Weide geeignet; gute Kräuter im Überfluss; die Wälder prachtvoll besetzt mit Hirschen und Elchen und Auerochsen, mit Gemsen und Steinböcken und sonstigem Wildzeug.“
Ein wahrer Garten Eden, der da Arbeo, Bischof von Freising, um 770 aus dem Federkiel quoll. Wenn auch noch kein Biergarten, Arbeo spricht nur von Wein. Sollte der Bischof bei seiner Lobpreisung des Baiernlandes und seiner kraftstrotzenden Bewohner ein bisschen überzogen klingen, ist das nicht verwunderlich. Er war Fachmann fürs Wunderbare, er verfasste vorrangig Heiligenlegenden. Im richtigen Leben waren die Zustände für die frühen Baiern nicht ganz so paradiesisch.
Im Gegensatz zur Geschichte der Mächtigen wissen wir über das Leben der einfachen Menschen dank der Gräberfunde recht gut Bescheid. Sie wurden nicht alt, die Lebenserwartung lag nur wenig über 30 Jahre. Sie waren – wohl durch das germanische Erbe – allerdings verhältnismäßig groß. Die Männer etwas über 1,70 Meter, die Frauen im Schnitt zehn Zentimeter kleiner. Die römischen Legionäre hatten es nur auf gut 1,50 Meter gebracht. Eine merkwürdige Sitte aus der Zeit der Völkerwanderung, wahrscheinlich hunnischen Ursprungs, war schon wieder abgeebbt. Um durch eine hohe Stirn ein edleres Aussehen zu erlangen, wurden manchen Babys im 6. Jahrhundert die noch weichen Schädelknochen mit einer Bandage zusammengeschnürt und hochgepresst zu einer „turmartigen Verlängerung des Kopfes“. Ob diese plastische Schädelkorrektur tatsächlich schöner machte? Sicher scheint, dass die Turmköpfe unter den Baiern keine bleibenden Gehirnschäden davontrugen.
Die guten alten römischen Zeiten, als man in Kempten Austern schlürfte, waren vorbei. Hatten sich raetische Hausfrauen noch im 5. Jahrhundert beklagt, das gewohnte Olivenöl aus dem Süden treffe zu spärlich ein, war jetzt Butterschmalz aus eigener Produktion das Fett der Wahl. Geld kam für das tägliche Leben kaum mehr in Umlauf, seine Stelle hatten Tauschgeschäfte eingenommen. Der Fernhandel hatte praktisch aufgehört, die Bajuwaren lebten von dem, was ihre eigenen Felder, Wiesen und Wälder hergaben. Das war eher spärlich. Man baute Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel und auch schon Weizen an. Auf ein Saatkorn kamen aber nur drei oder vier Körner Ernteertrag. Heute sind es zehn Mal so viel.
Bier braute man – das schien so wirklich zu klappen – noch ohne Hopfen, der erst im 9. Jahrhundert in einer Freisinger Handschrift erwähnt wird, weltweit zum ersten Mal, wie patriotische Historiker stolz bemerken. Fleisch musste gepökelt oder getrocknet werden, wollte man es länger aufheben. Anders als die Kelten, die Hundebraten geschätzt hatten, hauten die Bajuwaren ihre vierbeinigen Freunde nicht in die Pfanne. Auch Pferdefleisch verschmähten sie in der Regel. Aus der freien Wildbahn war als Proteinquelle alles begehrt, was kreuchte und fleuchte, vom Kranich bis zum Braunbären. Der Biber fand ebenfalls großen Zuspruch, des Fleisches, aber auch eines Drüsensekrets wegen, das „Bibergeil“ genannt wurde und bei vielen Leiden, wenig überraschend jedoch besonders bei Potenzschwäche, als Wundermittel galt. Große Herren leisteten sich sogar Wildgehege, die manchmal ganz raffiniert mit einem hölzernen Lockhirsch bestückt wurden, der wohl Rivalen, besonders die kurzsichtigen, anlocken sollte.
Der kleine Mann schuftete schwer auf seinen Äckern. Noch ging er hinter dem Ochsengespann an einem einfachen Hakenpflug her, der den Boden nur aufriss, nicht wendete. Getreide wurde mit der Sichel geerntet, Gras jedoch schon mit der Sense geschnitten. Er lebte in stroh- oder schilfgedeckten Häusern, besser Hütten aus Holz, oft noch unter einem Dach mit dem Vieh. Holz wurde beim Hausbau mit Holz verbunden. Metall war viel zu kostbar, um es als Nägel zu vergeuden. Die Ritzen zwischen den Balken waren mit Lehm verfugt.
Die Fenster waren einfache Löcher, durch die der Wind pfiff. (Das englische Wort für Fenster „window“, wörtlich Windauge, hat diesen frühmittelalterlichen Zustand, wie er nicht nur in Baiern herrschte, verewigt.) Männer und Frauen trugen Selbstgewebtes, hatten aber – endlich einmal was Erfreuliches – viel seltener Karies als die Menschen heute, weil es außer Honig keinen Süßstoff gab und Honig kostbar war. Die Hälfte ihrer Zeit mussten sie für ihren Grundherren arbeiten, der sie dafür beschützte, mehr schlecht als recht, wie die vielen Skelettfunde mit Spuren von Stichen, Hieben und anderen Verstümmelungen im Wortsinn „bis auf die Knochen“ beweisen.
Was nicht heißen soll, dass im frühen Baiern Faustrecht und blanke Anarchie zu Hause waren. Jenseits der Heiligenleben ist die „Lex Baiuvariorum“ als einer der wenigen Texte aus der Zeit der Agilolfinger erhalten. Diese Gesetzessammlung entstand wohl schon im 6. Jahrhundert, wurde bis ins 8. Jahrhundert mehrmals überarbeitet und regelte das Zusammenleben der damaligen Gesellschaft. Sie beginnt mit einer recht bombastischen Vorrede. Dort werden sehr eigenwillig antike Gesetzgeber wie Moses, Solon oder Konstantin der Große als Vorbilder bemüht, besonders aber der „ruhmreiche“ Frankenkönig Dagobert, auf den die Aufzeichnung der „Lex Baiuvariorum“ zurückgehe, ein deutlicher Hinweis auf die Abhängigkeit der Baiern von den Franken. Diese Gesetze, bis 1140 schriftliche Rechtsgrundlage bairischer Gerichtsbarkeit, seien in Kraft, „damit aus Furcht vor ihnen die menschliche Bosheit in Zaume gehalten und die Unschuld unter den Ehrbaren gesichert sei“.
Mit gleichbleibender Gewissenhaftigkeit geht das Werk in 23 Kapiteln unter anderem auf Mord und Totschlag, Arbeit am Sonntag, unzüchtige Griffe an fremden Frauenkörpern oder die Verpfändung von Schweinen ein. Die Todesstrafe wird erstaunlich selten gefordert, nur bei Hochverrat oder Tötung des Herzogs ist sie obligatorisch, obwohl der Herrscher in einem Gnadenakt auch die Vergeltung für diese Kapitalverbrechen noch in eine Geldstrafe umwandeln kann. Ansonsten wird bei Freien fast alles mit Geldbußen geregelt, selbst Mord und Totschlag werden so gesühnt.
Mit Ausnahme des Herzogsgeschlechts und fünf alter adeliger Familien, denen die „Lex Baiuvariorum“ besondere Wertschätzung entgegenbringt, sind alle Freien, ob arm oder reich, vor dem Gesetz gleich. Die „servi“, von den Historikern heute lieber Sklaven als Unfreie genannt, sind nicht rechtlos, doch deutlich minderwertig. Sie müssen mit Prügelstrafen, dem Abschneiden von Gliedmaßen oder der Todesstrafe rechnen. Bei Delikten gegen sie ist das Bußgeld viel niedriger, und ihr eigener Herr kann mit ihnen praktisch machen, was er will. Bestraft werden nur Übergriffe von Freien auf die Knechte anderer. Da es im alten Baiern einerseits auch Freigelassene gab, andererseits Freie im Lauf der Zeit zu Knechten eines Grundherrn absanken, ist es heute schwierig zu definieren, wer in der frühmittelalterlichen Realität frei oder unfrei war.
In flagranti ertappte ehebrechende Gattinnen darf der Bajuware samt dem Liebhaber straflos umbringen, es sei denn, er zieht eine monetäre Entschädigung seitens des Bösewichts vor. Bei ehebrechenden Männern hingegen ist stets nur von einer Geldbuße die Rede, über Rachemord der Ehefrau schweigt das Gesetz. Allerdings ist schon der Versuch der Verführung strafbar: „Und wenn er mit einem Fuße in das Bett gestiegen ist, von dem Weib aber gehindert, nichts weiter tut, der soll mit fünfzehn Schilling büßen, weil er zu Unrecht ein fremdes Ehebett betreten hat.“ Billiger kommt Grapschen: „Wenn einer aus böser Lust an eine Freie Hand anlegt, sie sei eine Jungfrau oder das Weib eines anderen, was die Baiern ›unzüchtigen Griff‹ nennen, der büße es mit sechs Schillingen.“
Strafbar sind auch das Umstürzen einer Leiter – natürlich nur, wenn oben einer steht –, das Verzaubern der Ernte eines Nachbarn oder das Verprügeln fremder Knechte, was aber beim Fehlen sichtbarer Verwundungen mit Pfennigbeträgen, im Falle einer Kopfverletzung, „sodass der Schädel heraussieht oder eine Ader platzt“, mit nur einem Schilling abgegolten werden kann – ein früher Hinweis auf die eher wohlwollende Haltung der Baiern gegenüber Handgreiflichkeiten unter Männern im Gegensatz zum „unzüchtigen Griff“ bei Frauen.
Gerichtsverhandlungen fanden mindestens einmal im Monat unter dem Vorsitz des Grundherren, meist ein Graf, oder eines Richters statt. Erscheinen aller Freien des Bezirks war Pflicht, auf Fernbleiben standen hohe Geldbußen. Neben dem Eid war der Zweikampf als Gottesurteil ein wichtiges Instrument zur Wahrheitsfindung. Anscheinend konnten auch erfahrene, bezahlte Kämpfer für die gerechte Sache jeder Seite einspringen, was Gottes Eingreifen für uns etwas fragwürdig macht. Die Folter, das Schreckensinstrument der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit bis weit in die Neuzeit hinein, diente noch nicht als probate Hilfe auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Zeugen wurden offensichtlich nicht vereidigt, sondern an den Ohren gezogen. Der Grund für diese bairische Eigenheit liegt im Dunkeln.
Die Tarife der Bußgelder schwankten, wie schon erwähnt, je nach Stand und Geschlecht. Es waren nicht Delikte gegen den Hochadel, für die ein Delinquent am meisten bezahlte, sondern am teuersten kam das Umbringen von Geistlichen. Es kostete bis zu viermal so viel wie die Tötung eines Laien. Besonders an höheren Klerikern sollte sich der Bajuware besser nie vergreifen. Für den Mord an einem Bischof musste der Täter laut Gesetz das Gewicht einer bleiernen Tunika in Gold aufwiegen – eine unvorstellbar hohe Summe. Diese Regelung war, so mutmaßt die Forschung, eine Antwort auf den noch zu behandelnden Märtyrer-Tod des heiligen Emmerams. Sie hatte Erfolg. Außer dem Fall Emmeram ist sonst kein Bischofsmord bekannt.
Diese Sonderbehandlung der Geistlichkeit bis hin zur Absurdität ist ein deutliches Indiz für die überwältigende Bedeutung, die das Christentum und seine Repräsentanten im frühmittelalterlichen Baiern hatten. Denn auch der Bruch der biblischen Sonntagsruhe wurde unverhältnismäßig heftig bestraft. Im Wiederholungsfall drohten da selbst den Freien 50 Rutenhiebe. Einem verstockten Sünder wurde sogar ein Drittel seines Besitzes weggenommen. Gab er dann noch immer keine (Sonntags-)Ruhe, verlor er seine Freiheit und fand sich als Knecht wieder.
Auch wenn Papst Gregor III. (731–741) die Baiern noch glaubte ermahnen zu müssen, sich von „Wahrsagen und Losdeuten, Totenopfern, Vorzeichen an Quellen, Amuletten, Zaubern und Hexen“ abzukehren, Mitte des 8. Jahrhunderts war Baiern bereits überwältigend christlich. Schon im antiken römischen Raetien hatte es ja Christen gegeben. Und auch Grimald, der erste bekannte Agilolfinger, war kein Heide mehr. Missionare aus Irland und Frankreich, voran die allesamt heilig gesprochenen Rupert, Emmeram und Korbinian, hatten dann um 700 dem katholischen Glauben endgültig den Boden bereitet. Die Klöster, die in der Folge überall in Baiern entstanden, trugen die christliche Lehre hinaus ins ganze Land. Allein Herzog Odilo und sein Sohn Tassilo III., der letzte Agilolfinger, gründeten zusammen 15 Klöster, darunter Niederaltaich, Wessobrunn oder Chiemsee. Aber auch andere Adelige stifteten eifrig Klöster und Kirchen. Metten und Benediktbeuern etwa gehen auf große Grundherren zurück.
Ganz sicher übte die Verheißung eines ewigen Lebens nach der irdischen Mühsal auf alle Gesellschaftsschichten eine ungeheure Faszination aus, doch gerade bei den Herzögen war der Antrieb zur Klostergründung nicht nur missionarischer Glaubenseifer. Die Mönche, damals ausnahmslos Benediktiner, trieben getreu ihrer Grundregel „ora et labora“, arbeite und bete, die Rodung der Wälder voran, die damals noch den größten Teil des Landes bedeckten, und sie beteten für das Seelenheil der Stifter nach deren Hinscheiden. Vor allem aber: Auf die Klöster hatten die Herzöge direkten Zugriff. Mit ihnen gab es keine lästigen Erbfolgeprobleme oder gar gefährlichen Versuche, konkurrierende Dynastien zu etablieren. Und außerdem konnten die Klöster das stellen, was sonst im Lande rar war und die Herrscher fürs Regieren dringend brauchten: Menschen mit Bildung.
Lesen und Schreiben war ein Privileg des Klerus. Und sollte es noch lange bleiben. Bis ins 12. Jahrhundert war „litterati“, des Lesens und Schreibens Mächtige, das Synonym für „clerici“, Kleriker. Hingegen stand „illitterati“ für „laici“, Laien. Die Schriftsprache war fast durchgehend Latein, Texte in Althochdeutsch wie das in Bruchstücken erhaltene bairische „Muspilli“-Lied sind die absolute Ausnahme.
Nur gelehrte Mönche waren in der Kunst des geschriebenen Wortes wirklich bewandert. Schon die Geistlichkeit draußen im Lande war alles andere als sattelfest. Die Priester an den Kathedralschulen der Bischofssitze mussten auf Latein nur singen und etwas lesen, aber nicht unbedingt schreiben können. Überliefert ist der Tadel des heiligen Bonifatius am Latein eines Pfarrers im Bistum Salzburg, der – übersetzt man sein Kauderwelsch ins Deutsche – „im Namen für das Vaterland und die Tochter und des Heiligen Geistes“ taufte (In nomine patria et filia et spiritus sancti). Und auch der schwärmerische Lobpreis Baierns des Bischofs Arbeo ist in einem Latein verfasst, das selbst ein wohlwollender Altphilologe wie Franz Brunhölzl „ein Wildwasser, das sich seinen Weg über felsigen Grund und Geröll bohrt“ nannte.
Die bayerische Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, die nicht sonderlich überraschend katholisch eingefärbt ist, hat der Rolle der Klöster in der Bewahrung des antiken Erbes eine überragende Rolle zugeschrieben. Einerseits zu Recht, die Mönche des frühen Mittelalters haben als Stubengelehrte in ihren Zellen oder Schreiber an den Fürstenhöfen Wort und Schrift der römischen Antike in einer brutalen, analphabetischen Welt am Leben erhalten. Andererseits war es nicht der Geist der Antike, den sie weitergaben. Den wollten sie auch gar nicht weitergeben. Ihr Blick zurück war stark eingeengt. Antike Bildung, besser Bruchstücke davon, war bestenfalls von Nutzen, wo sie dem alles unterzuordnenden Lebensziel jedes Christenmenschen, der ewigen Erlösung, gerecht wurde.
Schon der heilige Hieronymus, der Übersetzer der Bibel ins Lateinische, stand den heidnischen Dichtern und Philosophen misstrauisch gegenüber: „Was soll Horaz zusammen mit den Psalmen? Wir können nicht gleichzeitig den Kelch Christi und den Kelch der Teufel trinken.“ Papst Gregor der Große hielt um 600 die klassischen Artes liberales – Grammatik, Rhetorik, Logik, Mathematik, Geometrie, Musik und Astronomie – nur in dem Maße berechtigt, wie sie das bessere Verständnis der Bibel förderten. Selbst in der süditalienischen Abtei Bobbio, die sich im Gegensatz zu den Klöstern nördlich der Alpen noch eine Bibliothek mit Ovid, Vergil oder Livius leistete, überpinselte man die klassischen Texte bei Pergamentknappheit ohne Zögern mit erbaulicher christlicher Gebrauchsliteratur. Das Wichtigere hatte Vorrang.
Wichtiger waren leuchtende Beispiele für ein wahrlich christliches Leben. Apostellegenden, Märtyrergeschichten, gerne mit standhaften Jungfrauen. In Baiern tat sich auch dabei Arbeo von Freising hervor. In seinem Wildwasser-Latein erzählte er die Lebensläufe der Heiligen Korbinian und Emmeram. Letzterer, ein Franke, war Mitte des 7. Jahrhunderts Bischof in Regensburg, von Herzog Theodo hoch geachtet. Zu seinem Unglück aber geriet er laut Arbeo in eine Sex-Affäre. Ein Hofbeamter hatte die Herzogstochter Ota geschwängert. Bänglich vertraute das Paar sich Emmeram an. Der nahm in christlicher Nächstenliebe die Schuld auf sich, um den wahren Vater vor Bestrafung zu schützen.
Der Bruder Otas lauerte daraufhin dem Bischof in einem Wald auf, ließ ihn auf eine Leiter binden und dann schön langsam in Stücke hacken, die Augen ausstechen, Ohren und Nase abschneiden. Ein Diener meinte zu dem Gemarterten, er möge doch so schnell wie möglich sein Ende herbeiwünschen. Nein, antwortete ihm der Heilige, trotz allem müsse man den Tod so lange es ginge hinauszögern, um durch fromme Fürbitte Gott gnädig zu stimmen. Er wurde schließlich enthauptet und ging als rundum leuchtendes Beispiel – von seinem Leichnam ging laut Legende ein überirdisches Licht aus – in die Heiligengeschichte ein. Natürlich kam die Wahrheit zutage. Emmeram wurde in Ehren bestattet und zum Schutzpatron des Bistums Regensburg. Die heutige Forschung neigt dazu, hinter dem Foltertod des Bischofs aus dem Fränkischen weniger ein Vaterschaftsproblem als eine Hofintrige zu vermuten, Ausdruck des Konflikts zwischen bairischem Unabhängigkeitsstreben und fränkischem Hegemonieanspruch.
Arbeo, gestorben 784, lebte leider nicht lange genug, um das Ende dieses Konflikts aufzuzeichnen. So bleiben uns nur fränkische Quellen, deren Objektivität, vorsichtig gesagt, zweifelhaft ist. Im Jahr 787 musste Herzog Tassilo III. auf dem Lechfeld bei Augsburg in demütigender Weise Frankenkönig Karl dem Großen Unterwerfung geloben. „Er fand sich bei König Karl ein, legte seine Hände in die des Königs und ergab sich als Vasall. Er gab das Herzogtum zurück, das ihm von König Pippin (Karls Vater) verliehen worden war, und er bekannte, dass er in allen Stücken schlecht gehandelt und gesündigt habe. Dann erneuerte er seine Treueeide, gab zwölf Geiseln und als dreizehnten seinen eigenen Sohn.“ So weit die offiziöse Version der fränkischen Reichsannalen, die auch klarmachen, warum Tassilo sich so bedingungslos unterwarf. Karl der Große hatte die gesamte fränkische Militärmacht mitgebracht, die in drei Heersäulen konzentrisch gegen Baiern aufmarschierte. Fürs Erste aber blieb der Baier im Amt.
Wie konnte es so weit kommen mit dem stolzen Tassilo, der bis zu seinem jähen Fall fast 40 Jahre erfolgreich regiert hatte?
Es war wohl gerade der Erfolg, der dem Herzog zum Verhängnis wurde. Ausgerechnet der Frankenkönig Pippin, der Vater Karls des Großen, hatte den siebenjährigen Tassilo 748 als Baiernherzog eingesetzt. Pippin war Tassilos Onkel, Tassilos Mutter war Pippins Schwester. Sie und nach ihrem Tode der fränkische König selbst bestimmten bis zu Tassilos Volljährigkeit die Politik des bairischen Herzogtums. Auch nach seiner Volljährigkeit regierte der junge Herzog erst als braver Vasall seines Onkels und begleitete ihn mit einem Heer auf mehreren Feldzügen nach Aquitanien. Doch 763 ließ er – so die fränkischen Annalen – den Onkel bei Kämpfen in Aquitanien im Stich und kehrte, angeblich krank, nach Baiern zurück. Pippin scheint dies für den Moment hingenommen zu haben.
Dann heiratete Tassilo die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius und pflegte von nun an mit ihm engen Kontakt – sicher nicht zur Freude seiner fränkischen Verwandtschaft, die in den Langobarden natürliche Feinde ihrer Großmachtpläne sah. Tassilo zog nach Rom, ließ seinen Sohn vom Papst taufen. Er stiftete Klöster, besiegte die Slawen in den südöstlichen Alpen und erweiterte sein Herzogtum um das heutige Kärnten, kurz, er regierte wie ein König, ohne sich so zu nennen.
Die königsgleiche Stellung seines Vetters konnte und wollte der neue ehrgeizige Frankenherrscher Karl, 768 gekrönt, nicht hinnehmen. Sie stand seinen Großmachtplänen im Wege. Karls Hofchronisten geben natürlich Tassilo und seiner Treulosigkeit, die nicht von seinen Untertanen geteilt worden sei, die Schuld für seinen Untergang: „… er musste erkennen, dass alle Baiern dem König Karl treuer seien als ihm.“ Doch alles spricht dafür, dass Karl Schritt für Schritt darauf hinarbeitete, den lästigen Verwandten im Südosten erst zu isolieren und dann zu eliminieren.
Karl erfüllte die hervorragenden Beziehungen der Franken zum römischen Papst, die sein Vater Pippin geknüpft hatte, mit neuem Leben. Damit verlor Tassilo eine wichtige Unterstützung. Dann eroberte Karl 784 das Langobardenreich – Tassilos Politik war das Gegengewicht zur fränkischen Macht weggebrochen. Für ein paar Jahre noch konnte der Baier Vetter Karl mit wohl nur halbherzigen Treueschwüren auf Distanz halten, doch dann schlug der König zu. Als 787 Tassilo dem Befehl, auf einem Reichstag in Worms zu erscheinen, nicht Folge leistete, setzte Karl seine Militärmaschinerie gegen ihn in Gang. Es kam zur bedingungslosen Kapitulation auf dem Lechfeld.
Noch aber war Tassilo Herzog, und noch war Karl nicht zufrieden. Er drückte einen Passus in die ehrwürdige „Lex Baiuvariorum“: „Sollte der vom König eingesetzte Herzog so kühn und hartnäckig sein, so leichtsinnig, frech und aufgeblasen, so übermütig und rebellisch, dass er einen Befehl des Königs missachtet, so soll er des Geschenkes des Herzogtums verloren gehen.“ Darauf lud er Tassilo 788 zu einem Schauprozess vor den Großen des Reichs nach Ingelheim. Fränkische Quellen behaupten, dies sei notwendig geworden, weil der Herzog weiter gegen Karl gehetzt und sich sogar zu der Bemerkung verstiegen habe, lieber wolle er zehn Söhne verlieren, als Karl gehorchen.
Die Anklage wog schwer, auch wenn ihr Hauptpunkt etwas angestaubt war. Vor 25 Jahren habe Tassilo Fahnenflucht begangen, als er König Pippin damals in Aquitanien im Stich ließ. Außerdem warf Karl seinem Vetter ein Bündnis mit den Awaren vor, erklärten Reichsfeinden, die Karl vernichten wollte. (Das gelang ihm auch ein paar Jahre später.) Ob und wie Tassilo sich verteidigte, wissen wir nicht. Er wurde zum Tode verurteilt. Der kühle Rechner Karl ließ taktische Milde walten und verbannte Tassilo, nun ein Mönch mit kurz geschorenem Haar, samt Frau und Kindern „nur“ auf Lebenszeit in ein Kloster. Dann belehnte er einen Vertrauten mit dem schönen Herzogtum Baiern. Schon unter Karls Sohn Ludwig dem Frommen wurde es zu einem karolingischen Teilkönigtum.
Sechs Jahre nach seinem Fall wurde Tassilo vom tragischen auch noch zum kläglichen Helden. Denn der Frankenkönig ließ den armen, machtlosen Mönch Tassilo 794 noch einmal aus seiner Zelle holen, vor einem Reichstag in Frankfurt seine Verfehlungen als stolzer Herzog wiederholen und dann zur Sühne für sich und seine Nachkommen ein für alle Mal auf das Herzogtum Baiern verzichten. Dann schickte Karl, auf dem besten Weg zum Beinamen „der Große“, den erniedrigten Vetter ins Kloster zurück. Dort ist er verschollen. Und so endete das Stück von Aufstieg und Fall des letzten Agilolfingers als traurige Farce.
„Teja Fiedler hat einen gewaltigen geschichtlichen Stoff aufs Papier gebracht...Die Lektüre ist informativ, verständlich und bisweilen ironisch-amüsant verfasst, so dass sie einen manchmal zum Schmunzeln verlockt.“
„Auf jeden Fall ist Fiedlers neues Buch ein Muss für alle an der Geschichte des Freistaats Interessierten. Ein höchst lesenswerter Streifzug durch den Freistaat, wie ihn noch niemand kennt.“
„Die für ein solches Werk bis dato unerreichte Klammer von der Römerzeit bis zum Bayern des Horst Seehofer setzt Fiedler mit der leichten Feder des Journalisten.“
„Der Autor fügt Stück um Stück ein Bayernpuzzle zusammen, das sehr schön zu lesen ist. (...) Er beweist, dass Bayernliebe nicht blind machen muss und einem um Bayern als ›schönstes Stück Deutschlands‹ nicht bange sein muss.“
„Fiedler erzählt die Geschichte ›anders‹. Das beginnt schon mit dem überraschungsreich biegsamen Stil, flapsig pointiert, doch niemals närrisch ausartend.“
„›Anders‹ ist die kurzweilige Chronik weil sie sonst wenig hervorgehobene Einzelheiten präsentiert. Wer weiß schon, dass Holland mit Borkum und Norderney rund ein dreiviertel Jahrhundert lang, bis 1425, zum Wittelsbacher Herrschaftsbereich gehört hat?“
„Teja Fiedler erzählt in seinem Buch ›Mia san mia. Die andere Geschichte Bayerns‹ im amüsanten aber doch klaren Stil von Kaisern und Königen, von Religion und Bier, aber auch von großen Literaten und Kunst.“
„Ein Highlight des facettenreichen Autors (...) mit feinsinnigem Humor und Wortwitz.“
„Ironisch, mit einer guten Portion Schalk, führt der ehemalige Plattlinger durch die bayerische Geschichte. (...) Unterhaltsam, amüsant, packend und aufschlussreich.“
„Das im Plauderton gehaltene, immer wieder Pointen und Spitzen setzende, manchmal auch scharfzüngige Panorama ist ein liebenswerter Überblick über die bayerische Geschichte“
„Bayern ist weit mehr als Ludwig-Kult, Laptop und Lederhose, das zeigt Teja Fiedler ebenso amüsant wie erhellend.“
„Wer endlich einmal ganz genau erfahren möchte, warum Bayern so unendlich dominierend, außerordentlich, formschön und weltnabelig ist, liegt bei Herr Fiedler richtig.“

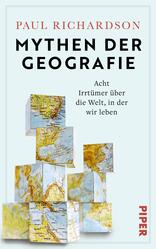



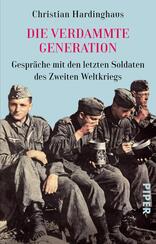







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.