

Das schwarze Herz des Winters – Unforgiving (Das schwarze Herz des Winters 2) Das schwarze Herz des Winters – Unforgiving (Das schwarze Herz des Winters 2) - eBook-Ausgabe
Roman
— Düster-romantische High FantasyDas schwarze Herz des Winters – Unforgiving (Das schwarze Herz des Winters 2) — Inhalt
„Freu dich auf einen Dark-Fantasy-Roman voller tief in Blut und Verrat getauchter Magie, in dem das Spiel um Macht und Göttlichkeit immer dramatischer wird.“ - Kirkus
Nadya hat die Stimmen ihrer Götter verloren.
Serefin hört wispernde Stimmen in der Dunkelheit.
Und Malachiasz muss jene Stimmen um jeden Preis finden ...
Doch die Stimmen verfolgen ein eigenes grausames Ziel – und die Schicksale der drei sind unwiderruflich damit verflochten.
In ihrer atemlosen Fantasy-Reihe „Das schwarze Herz des Winters“ zeichnet Emily A. Duncan eine eisige, finstere Welt, in der Stimmen aus den Schatten flüstern und niemand ist, was er zu sein scheint.
Leseprobe zu „Das schwarze Herz des Winters – Unforgiving (Das schwarze Herz des Winters 2)“
Prolog
DAS MÄDCHEN, GEFANGEN IM INNERN
Alles war Dunkelheit. Gewaltig, kalt und doch lebendig wie ein Wesen. Sie konnte fühlen, wie dieses Wesen atmete, sich bewegte, wie es etwas von ihr begehrte. Nichts konnte es davon abhalten, sie zu verschlingen.
Ihre Arme waren an eine Steinplatte gefesselt – es gab kein Entkommen von diesem fremdartigen Ort. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie mit dem Kämpfen aufgehört hatte. Doch die echte Angst – das brandheiße Entsetzen, das sie zu zerreißen drohte – bestand darin, dass sie nicht wusste, wer sie war.
»Das [...]
Prolog
DAS MÄDCHEN, GEFANGEN IM INNERN
Alles war Dunkelheit. Gewaltig, kalt und doch lebendig wie ein Wesen. Sie konnte fühlen, wie dieses Wesen atmete, sich bewegte, wie es etwas von ihr begehrte. Nichts konnte es davon abhalten, sie zu verschlingen.
Ihre Arme waren an eine Steinplatte gefesselt – es gab kein Entkommen von diesem fremdartigen Ort. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie mit dem Kämpfen aufgehört hatte. Doch die echte Angst – das brandheiße Entsetzen, das sie zu zerreißen drohte – bestand darin, dass sie nicht wusste, wer sie war.
„Das kommt zurück.“ Eine sanfte, ruhige Stimme wand sich um sie, die Hand auf ihrem Haar berührte sie sacht, nicht wie all die anderen, die hart und grausam gewesen waren. „Wisse, man wird dir eine Sache erlauben. Sie wird dir zurückgegeben, wenn die Verwandlung vollendet ist. Allerdings nicht, ehe sie den Geschmack von bitterem Wein annimmt, den du zugleich ersehnst und verabscheust. Wenn du für diese Sache töten würdest, sie aber auch dich töten wird, sobald du sie erlangst, erst dann wird sie dir wiedergegeben.“
Sie verzehrte sich nach der Stimme. Sie war ihr fürchterlich vertraut. Sie war Knochen und Gold und Blut, so viel Blut. Ein Junge mit einem Thron und ein Junge, der nach einem anderen Thron griff, und ein Mädchen mit schneeweißen Haaren, nirgendwo zugehörig.
Doch nichts von all dem war hier wichtig.
Die Dunkelheit kroch ihr unter die Haut. Breitete sich in ihr aus, richtete sich in ihren Knochen ein und floss durch ihre Adern, riss sie in Stücke und formte sie zu etwas Neuem, etwas Anderem.
Hätte sie schreien können, so hätte sie geschrien. Hätte sie kämpfen können, so hätte sie gekämpft.
Doch sie vermochte nichts davon.
Sie konnte nur ihr Schicksal erleiden.
Es gab nur die Dunkelheit, die sich so weit erstreckte, dass sie sich fragte, ob sie sich das alles eingebildet hatte. Es hatte niemals eine Stimme gegeben. Es hatte niemals eine sanfte Hand auf ihrem Haar gegeben. Es gab nichts, nichts außer dieser Dunkelheit.
1 SEREFIN MELESKI
Eine Viper, eine Gruft, eine Täuschung des Lichts: Velyos greift immer nach allem, was ihm nicht gehört.
Die Briefe des Włodzimierz
Serefin Meleski hauste in dem Streifen der Nacht, der reif war für Verrat. Es war eine Zeit, in der Dolche gezückt, in der Pläne geschmiedet und ausgeführt wurden. Es war eine Zeit für Monster.
Er war mit diesen Stunden sehr vertraut, aber selbst die Kenntnis des Unvermeidlichen genügte nicht, um es weniger schmerzhaft zu machen. Es war nicht so, dass er die Nächte wach blieb, weil er eine weitere Tragödie erwartete.
Nein, er blieb wach, weil es einfacher war, bis zur Bewusstlosigkeit zu trinken, als sich den Albträumen zu stellen.
Also war er wach, als sich Kacper in seine Räumlichkeiten schlich. Offenbar wollte er ihn wecken, war aber wohl auch nicht sonderlich überrascht, als er Serefin auf der Polsterbank im großen Gemach vorfand: liegend, mit einem Bein auf dem Boden und dem anderen über der Rückenlehne. Ein leeres Glas stand am Boden in Reichweite und ein Buch lag mit den Seiten nach unten über der Armlehne, während er über dieselben Bilder nachgrübelte wie schon in den letzten vier Monaten: Träume von Motten, Blut und Monstern.
Schrecken an den Rändern seines Bewusstseins und diese Stimme. Die dünne Stimme – wie ein Pfeifen im Schilf –, die von einem Ort hinter dem Tod auf ihn einstach. Ihr sirrender Gesang verstummte nie. Die fremdartigen Melodien summten unablässig in seinen Adern.
„Jeglichen Ärger hast du dir selbst eingebrockt“, zischte die Stimme.
Er versuchte, sie zu überhören.
„Wer ist es?“, fragte er Kacper. Die Krone aus gehämmertem Eisen war ihm schon längst auf den Kopf gesetzt, eine seiner Handfläche aufgeschnitten und sein Blut auf einem Altar verteilt worden, als er zum König von Tranavia ausgerufen worden war: Sein Niedergang nahte. Die Adeligen hatten ihn noch nie gemocht, nicht als Kronprinz und erst recht nicht nach seiner Krönung. Das Was oder Wie hatte nie infrage gestanden, sondern nur wer als Erster so viel Mut aufbrächte, zuzuschlagen.
Er hatte das böswillige Geflüster weiter geduldet und immer wieder aufgeschoben, schlüssig zu erklären, wie sein Vater gestorben war. Er forderte das Schicksal heraus. Tranavische Staatsgeschäfte waren schmutzig. Sehr schmutzig.
„Es findet gerade ein Geheimtreffen statt“, antwortete Kacper mit leiser Stimme.
Serefin nickte, ohne sich aufzusetzen. Er hätte das von den slavhki, die seinen Vater unterstützt hatten, auch kaum anders erwartet.
„Ksęszi Ruminski ist beteiligt“, fuhr Kacper fort.
Serefin zuckte zusammen und stand schließlich auf. Er schnitt sich in den Finger, um einige Kerzen mit der Magie zu entzünden, die sein Blut versprühte, und wischte sich dann vorsichtig die Hand ab.
Żanetas Familie forderte schon seit Monaten Antworten von ihm. Serefin wusste nicht, was er sagen sollte. „Oh, es tut mir schrecklich leid, sie hat ein bisschen Hochverrat verübt, und der Schwarze Geier befand, sie sei bei seinesgleichen besser aufgehoben. Eine fürchterlich heikle Angelegenheit, aber so ist es nun einmal! Dagegen können wir nichts ausrichten.“
Dies war ein ständiger, eitriger Unruheherd, der unter seiner Haut schwelte. Ja, Żaneta hatte ihn verraten, und ja, er war deshalb gestorben. Aber verdiente sie das furchterregende Schicksal, das Malachiasz ihr bestimmt hatte?
„Du bleibst ungewöhnlich ruhig angesichts dieser Gefahr“, bemerkte Kacper.
„Was werden sie tun, frage ich mich. Mich hängen? Im Kerker verrotten lassen?“
Kacper schnaubte und ließ die Schultern sinken. „Ich hasse es, wenn du so pessimistisch bist“, murmelte er, während er sich an Serefin vorbeischob, um ins Schlafzimmer zu gelangen.
„Wohin willst du?“, fragte Serefin. Er betrachtete die Flaschen in seinem Schrank und zog dann eine Flasche Wodka, die wundersamerweise voll war, aus einem Fach. „Ich bin nicht pessimistisch“, grummelte er. „Ich bin nur abgeklärt und sehe die Dinge nüchtern. Diese Entwicklung war nicht zu vermeiden.“
„Ein Staatsstreich ist nie unvermeidlich“, schimpfte Kacper von nebenan. Packte er? „Nichts von alldem wäre passiert, wenn du diese verfluchte Klerikerin gehängt hättest, statt sie in denselben seltsamen Schwebezustand zu versetzen wie das ganze restliche Land. Aber das hast du nicht getan. Und jetzt haben wir es mit einem Staatsstreich zu tun, weil wir leider niemanden haben, dem wir die Schuld zuschieben können. Willst du so enden wie dein Vater?“
Serefin schrak zusammen. Er nahm einen tiefen Schluck. Träume von Motten und Blut und der Leiche seines Vaters, hingestreckt zu seinen Füßen. Er hatte den tödlichen Schlag nicht geführt, aber es war trotzdem seine Schuld.
„Nein“, flüsterte er und fegte eine bleiche Motte aus der Kerzenflamme.
„Nein. Das willst du nicht.“
Doch auch das ist wahrscheinlich unvermeidlich, dachte Serefin verdrießlich. Kacper hätte es ihm verübelt, wenn er diesen Gedanken laut ausgesprochen hätte.
„Die Hälfte deiner Gewänder ist von den Motten gefressen worden.“ Kacper klang verzweifelt.
Die Tür wurde aufgestoßen. Serefins Hand wanderte zu seinem Zauberbuch, sein ganzer Körper spannte sich an. Ihn schauderte, dann seufzte er. Es war nur Ostyia.
„Oh, du bist schon auf“, stellte sie trocken fest.
„Schließ die Tür hinter dir ab.“
Sie tat es.
„Ich habe ihm berichtet, was vor sich geht, und er steht nur da und trinkt“, beschwerte sich Kacper.
Serefin bot Ostyia die Wodkaflasche an.
Ächzend streckte Kacper seinen Kopf aus dem Zimmer, als sie die Flasche nahm und daraus trank.
Sie blinzelte Serefin an – ein übertriebenes Zusammenkneifen ihres einzigen Auges.
„Komm wieder zu uns, Kacper“, verlangte Serefin.
Kacper brummte laut und beugte sich über die Türschwelle.
„Wie lange treffen sie sich schon?“
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihr erstes Treffen ist“, erwiderte Kacper.
„Sie werden nicht heute Nacht zuschlagen.“
„Aber …“
„Sie werden nicht heute Nacht zuschlagen“, wiederholte Serefin entschieden.
Er unterdrückte seine aufsteigende Panik und nahm Ostyia die Flasche wieder ab. Angst hatte schon seit Monaten jeden seiner Schritte beschwert und nur darauf gewartet, dass er ins Wanken geriet. Hätte er innegehalten und genau über die Bedrohung nachgedacht, dann wäre er bei lebendigem Leib verschlungen worden. Er hatte sich vormachen müssen, dies alles sei unwirklich.
Kacper ließ sich gegen den Türrahmen fallen.
„Dass du so eifrig für meine Sicherheit sorgen möchtest, freut mich natürlich“, sagte Serefin und übersah dabei den kühlen Blick, mit dem Kacper ihn bedachte. „Du bist ein echter Meisterspion, aber ein bisschen voreilig.“
Kacper glitt am Türrahmen nach unten und ließ sich auf dem Boden nieder.
„Lasst uns jetzt erst einmal herausfinden, was sie wollen“, beschwichtigte Serefin. Er stellte die Flasche auf dem Tisch ab und wischte dabei eine weitere Motte weg.
Ostyia runzelte die Stirn, ging zu dem Sessel und hockte sich auf die Armlehne. Sie gähnte.
„Wir wussten, dass Ruminski irgendwann Antworten verlangen würde“, räumte er dann ein.
„Er fragt schon seit Monaten, Serefin. Er will einfach nicht länger warten“, stöhnte Kacper.
Serefin hob erschöpft die Schultern. „Vielleicht können wir mit ihnen verhandeln. Es muss doch irgendetwas geben, worauf sie versessen sind und das ich ihnen verschaffen kann.“
„Bei geheimen Zusammenkünften deiner Feinde wird keine Liste mit Forderungen mehr erstellt, die du erfüllen kannst“, sagte Ostyia.
„Alle am Hof sind meine Feinde“, murmelte Serefin und warf sich auf einen gepolsterten Stuhl. „Das macht es so schwierig.“
Sie nickte nachdenklich.
Er hatte versucht, den Hofstaat für sich zu gewinnen, aber nichts hatte Erfolg gezeigt. Es gab zu viele Gerüchte zu bekämpfen, für die er keine Erklärungen bereithatte. Er konnte nicht verraten, wer seinen Vater tatsächlich getötet hatte, und das durch die Tiefen des Hofstaates wirbelnde Geflüster näherte sich schon gefährlich der Wahrheit.
Eine kalyasische Attentäterin. Der Schwarze Geier. Verrat. Katastrophe. Eine vermisste Adlige. Ein toter König. Das gemeine Volk gab ihm Titel, die er nicht abschütteln konnte: Mottenkönig. Blutkönig. Serefin, gesegnet durch etwas Unerklärliches. Was hätte das Blut, das in dieser Nacht vom Himmel gefallen war, anderes sein können als ein Segen?
Serefin schlug nichts außer Verdächtigungen und Widerstand vonseiten seiner Adligen entgegen. Die Kalyaziner drängten die tranavischen Kräfte zurück, und selbst wenn Tranavia nicht wusste, dass die einzige Klerikerin Kalyazins den König getötet hatte, die Kalyaziner wussten es sicher.
Wiederaufkeimende Hoffnung bei den Kalyazinern war das Letzte, was Serefin brauchte.
Er konnte den Krieg nicht beenden. Er konnte die Fragen der Adeligen nicht beantworten, solange er Nadya nicht hängen lassen wollte, und er hatte festgestellt, dass er das nicht wollte. Sie hatte das zu Ende geführt, was er nicht vermocht hatte. Doch obwohl sie aus einem feindlichen Land stammte und einer Macht geweiht war, an die er nicht glaubte und auf die er nicht vertraute: Er würde sie nicht hinrichten lassen.
„Was tun wir?“, fragte Ostyia.
Serefin fuhr sich mit der Hand durch die Haare. „Ich weiß es nicht.“
Es gab eine offensichtliche Lösung, mit der sie Ruminski besänftigen konnten, doch Serefin war sich unsicher, auf welchem Wege sie Żaneta befreien konnten. Soweit zu erkennen war, hatten sich die Geier aufgesplittert. Er hatte nicht viele durch den Palast schleichen sehen, war aber auch nicht erpicht darauf, an die Tür der Kathedrale zu klopfen, um herauszufinden, wer ihm öffnen würde.
Müde rieb er sich die Augen. Er wollte die Nacht durchschlafen, nur einmal. Stattdessen suchte er die Klerikerin auf, die sich wie immer in der Bibliothek eingenistet hatte, denn, so drückte sie es aus, wo sollte sie auch sonst hin?
„Also lässt sich seine Majestät dazu herab, die arme boyar zu beehren, die in ihrem Turm weggesperrt wurde, um zu verrotten“, spottete sie, als er sie gefunden hatte. Sie saß in einer hohen Fensternische und hatte ein Bein ins Freie hinausgestreckt. Das weißblonde Haar hing ihr lose um die Schultern. Serefin konnte sich an keine Gelegenheit erinnern, bei der es nicht sorgfältig geflochten gewesen war.
Angespannt linste er durch die Spalten zwischen den Bücherstapeln, um zu überprüfen, ob sie jemand belauschte. Doch es war so früh, dass noch kein slavhki wach war.
„Du scheinst es darauf anzulegen, gehängt zu werden“, murmelte er.
Sie schnaubte leise, und ihre dunkelbraunen Augen blickten kurz abschätzig zu ihm herüber. Sie hatte die Rolle der ahnungslosen slavhka aus einer entlegenen Kleinstadt abgelegt, und das Mädchen, das Józefinas Platz eingenommen hatte, war klug, geistreich und brachte Serefin mühelos zur Weißglut. Rashid, der hübsche akolanische Junge, mit dem sie ständig zusammen war, hatte Serefin klammheimlich neue Papiere übergeben, die dieses Mädchen vor der Welt erklären sollten – helle Sommersprossen, helle Haut, helles Haar, aber wundersam dunkle Augen und Augenbrauen, ein himmelweiter Unterschied zu dem Rotschopf Józefina. Die Papiere waren gefälscht, die Erklärungen überraschend stichhaltig. Überschwemmte Straßen bei den Seen hatten leider ihre Reise erschwert, sodass sie zu spät zur Rawalyk eintrafen, aber noch nicht nach Hause zurückkehren konnten. Das würde genügen. Ihr richtiger Name klang tranavisch genug, um keinen Argwohn zu erwecken, wenn er nur etwas anders ausgesprochen wurde.
Mit einem Seufzer rutschte sie in die Ecke der Fensternische und gab ihm ein Zeichen, er möge hochklettern. Er machte es sich neben ihr bequem und sah sich den Bücherstapel an, den sie angehäuft hatte. Tranavische Texte über die alten Religionen, die so zerfleddert und abgenutzt waren, dass sie ihr in den Händen zu zerfallen drohten.
„Wo um alles in der Welt hast du die gefunden?“, fragte er.
„Du willst die Antwort gar nicht hören“, erwiderte sie geistesabwesend, während sie sich wieder ihrem Buch zuwandte. „Aber warne den Bibliothekar. Ich will doch nicht, dass der alte Blutmagier vor Schreck den Geist aufgibt, wenn er entdeckt, dass seine Sammlung verbotener Bücher geplündert wurde.“
„Ich wusste nicht, dass wir verbotene Bücher haben.“
Sie gab ein Brummen von sich. „Sicher weißt du das. Du musst sie doch verstecken, damit eure ganze Häresie in deinem Reich im Vordergrund leuchtet, oder?“
„Nadya …“
„Ich muss schon sagen“, fuhr sie fort, „ich bin doch überrascht, dass diese Bücher nicht verbrannt wurden. Kerle wie du sind doch versessen darauf, Bücher zu verbrennen.“
Er schaffte es gerade noch, diesen ausgesucht gemeinen Köder nicht zu schlucken.
Sie schwiegen, während Nadya las und Serefin ein weiteres Buch durchblätterte. Er konnte nicht wirklich herausfinden, was sie da studierte.
„Hast du in letzter Zeit irgendwelche Geier in der Nähe gesehen?“, fragte Serefin schließlich.
Sie senkte ihr Buch und schaute ihn ungläubig an. „Ob ich was habe?“
Er hatte wohl heimlich gehofft, die Antwort wäre Ja, und damit wäre alles einfacher für ihn; ein klarer Missstand, der leicht zu beseitigen wäre.
„Ich sollte meinen, der König von Tranavia hätte mehr mit diesem Kult zu schaffen als ein armes, gefangenes Bauernmädchen“, sagte sie geziert.
„Ich hoffe, noch jemand hört, in welchem Ton du hier sprichst, und nötigt mich, endlich zu handeln“, erwiderte er.
Dafür erntete er ein kurzes Lachen von ihr. Sie lehnte sich zurück und ließ nun beide Beine draußen in der Luft baumeln. Er wusste nicht einmal, warum er sie ausfragte. Immerhin war sie zur gleichen Zeit in Grazyk aufgetaucht wie Malachiasz und hatte ihn eindeutig von früher gekannt. Allerdings wusste er nicht, was genau zwischen ihnen gelaufen war. Er hatte auch nie gefragt. Doch aus kleinen Andeutungen Nadyas hatte er schließen können, sie und der Schwarze Geier wären einander mehr gewesen als nur ungleiche Verbündete und dass das Vergehen des Geiers aus mehr bestanden hatte als bloßem Verrat.
Warum nahm er überhaupt an, dass sie mehr über die Geier wusste als er? Sie, die Klerikerin aus Kalyazin. Es war lächerlich; das würde ihn nicht weiterbringen.
Er lehnte seinen Kopf nach hinten an die Wand.
„Warum fragst du?“, wollte sie wissen.
„Ich muss dir meine Beweggründe nicht erklären“, erinnerte er sie.
„Serefin, du lässt es mich täglich ein bisschen mehr bereuen, dass ich dich nicht umgebracht habe.“ Doch es schwang kein Zorn in ihren Worten. Zwischen ihnen herrschte ein beklommener Waffenstillstand. Und obwohl Nadya wütend war, weil er sie mehr oder weniger in Tranavia gefangen hielt, schien sie auch nicht besonders erpicht darauf zu sein, Abschied zu nehmen.
»Żaneta«, sagte er leise.
Nadya wurde bleich.
Er nickte knapp.
„Was ist mit ihr geschehen?“, fragte sie vorsichtig.
„Malachiasz hat sie mitgenommen.“
Sie verkrampfte sich, als dieser Name fiel, zupfte unruhig an einem abgebrochenen Fingernagel und sah ihn nicht an.
„Sie hat dich verraten“, erklärte sie. Es klang, als wollte sie sich selbst davon überzeugen, dass Malachiasz richtig gehandelt hatte.
„Und ich bin gestorben.“
„Und du bist gestorben.“
„Vermutlich.“
„Sie tuscheln bereits, weißt du“, sagte Nadya. Ihre Hand wanderte zum Nacken und fiel wieder zurück, als ihre Finger dort nichts fanden. Ein unbewusster Tick, den Serefin schon unzählige Male bei ihr beobachtet hatte. Eine Weile hatte sie um den Hals ein kleines silbernes Amulett getragen, aber das war verschwunden. „Wir waren nicht die Einzigen in der Kathedrale in dieser Nacht. Sie sagen: ›Nicht einmal der Tod kann diesem neuen jungen König Befehle erteilen.‹“
Serefin schauderte es.
„Meine Göttin ist der Tod“, fuhr Nadya fort. „Niemand betritt ihr Reich und kehrt zurück.“
Blut und Sterne und Motten. Und diese Stimme, diese Stimme.
Serefin schob sie innerlich beiseite, bevor sie zu ihm sprechen konnte.
„Und was denkt die Göttin?“
Nadya hob lustlos die Schultern und ließ ihren leeren Blick schweifen. „Sie spricht nicht mehr zu mir.“
Das war nicht das Gespräch, für das Serefin hergekommen war. Doch die Traurigkeit in Nadyas Stimme berührte sogar ihn.
„Was wird Tranavia über einen König denken, der vom Tod zurückgekehrt ist?“, fragte er nach einer langen Stille. Sie zog eine Braue hoch und musterte ihn. Er dachte an den Heiligenschein, der ihren Kopf umgeben hatte: zittrig, gebrochen und fleckig. Sie hob eine Hand, und eine der blassgrauen Motten, die Serefin ständig umflatterten, landete auf ihrem Zeigefinger.
„Serefin Meleski“, sagte sie nachdenklich. „Da lag ein Zeichen auf dir, das mit jedem Tag dunkler wurde. Ich dachte …“ Sie brach ab, wies mit der Hand auf die Bücherstapel. „Ich weiß nicht, was ich dachte … dass ich helfen könnte? Dass ich vielleicht helfen wollte? Es spielt keine Rolle.“
„Mir helfen? Oder ihm helfen?“
„Es spielt keine Rolle“, wiederholte sie mit einem spitzen Unterton.
„Wenn der Argwohn wächst, wird am Ende keiner von uns ungeschoren davonkommen“, sagte er.
Sie nickte. Es war hier bereits gefährlich für sie. Wenn sich sein Hof gegen sie wandte, konnte er nichts für sie tun. Er war sich auch noch immer nicht sicher, warum er sie überhaupt schützen wollte.
„Ich sollte nicht so hilfsbereit sein. Du hast mein Zuhause zerstört“, warf sie ihm vor.
Serefin hatte vermieden, das Thema anzusprechen, sich aber gefragt, wann sie es tun würde. Er schloss das Buch und legte es auf den Stapel. Serefin hatte nie die Absicht gehabt, das Kloster niederzubrennen, und was Teodore getan hatte, nachdem er gegangen war, lag nicht mehr in seiner Verantwortung. Er hatte gefunden, wonach er dort gesucht hatte: sie. Und der Druck, den sein Vater auf ihn ausgeübt hatte, die Klerikerin aufzuspüren und herauszufinden, wie ihre Macht vielleicht die eines Blutmagiers verstärken konnte, war verschwunden. Die Antwort auf diese Frage zu finden hatte Serefin mehr oder weniger aufgegeben. Er wollte einen Krieg beenden, und das würde mit diesem Mädchen als Geisel einfacher sein.
„Ich habe es zerstört. Zu behaupten, ich hätte mich nicht auf irgendeine Art von Rache gefasst gemacht, wäre gelogen.“
„Ich dagegen würde lügen mit der Behauptung, dass ich niemals Rache wollte.“
„Wer hätte das gedacht? Wir sind ehrlich zueinander.“
Sie verdrehte die Augen. „Bereust du es?“
„Es ist Krieg“, sagte er. Sie durchbohrte ihn mit Blicken und er seufzte. „Nadya, wenn ich alles bereuen wollte, was ich je getan habe, könnte ich morgens nicht mehr aufstehen.“
Sie gab ein nachdenkliches Grummeln von sich.
„Ist das dein Entschluss: Rache?“
„Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Serefin, ich habe deinen Hofstaat beobachtet. Ich glaube, ich kann relativ sicher sagen, dass jedes Chaos, das dein Tod hervorrufen würde, kaum ausreichen dürfte, um an der Front auch nur das Geringste zu verändern.“
„Ah, gerettet durch meinen eigenen, dysfunktionalen Hofstaat!“
Nadya starrte ihn an. »Was hat das alles mit Żaneta zu tun?«
„Ihr Vater wird einen Staatsstreich anzetteln, wenn ich sie nicht bald herbringe.“
„Und du glaubst, dass er es nicht sowieso tun würde, egal was du machst?“
„Ah, zugrunde gerichtet durch meinen eigenen, dysfunktionalen Hofstaat!“
Sie hatte recht. Er konnte nicht aufhalten, was da in Gang gesetzt worden war. Das Mystische, das ihn umgab, machte alles noch schlimmer. Wie konnte Tranavia von jemandem regiert werden, der von etwas völlig Unverständlichem ergriffen war?
Und diese Stimme. Sie flüsterte ihm ständig etwas zu, aber solange er nicht antwortete, war sie nicht real.
Oder vielleicht war er einfach der Sohn seines Vaters und verlor ebenfalls den Verstand?
Sie saßen schweigend da. Er wusste nicht, was er tun sollte, und sie konnte nicht wirklich helfen – würde er gestürzt, so würde sie gehängt.
„Wir können sie nicht zurückführen ohne einen Geier“, sagte Nadya und fügte leiser hinzu: „Hast du irgendetwas gehört von …?“
Er unterbrach sie, indem er den Kopf schüttelte. Alle paar Wochen pflegte sie nach Malachiasz zu fragen und er gab ihr immer dieselbe Antwort, eine Lüge.
Aber bestimmt wollte sie nicht hören, was man ihm berichtete. Die Gerüchte über Todesfälle und dunkle Magie, wie sie nur sein Cousin verursacht haben konnte.
„Du wirst eine Lösung finden“, sagte sie. „Du musst.“
Von dem Wir war also neuerdings nur noch er übrig geblieben, der die Dinge allein in Ordnung bringen musste. Das war der springende Punkt: Er hatte keine Wahl. Es würde sich nichts ändern, wenn er nichts unternahm.














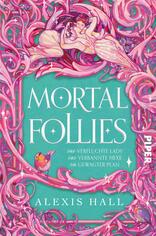


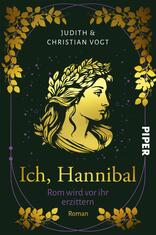






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.