„Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche“ auf der Shortlist des deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2023
„Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche“ von Dietmar Pieper wurde für die Shortlist des Wirtschaftsbuchpreises 2023 nominiert.
weitere Infos
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Detailliert beschreibt er, wie hanseatische Kaufleute die Kolonialherrschaft des Deutsche Reiches vorantrieben.“
Philosophie MagazinDer deutsche Kolonialismus entstand im Zusammenspiel von Kaufleuten, Bankiers und Reedern, für die der außereuropäische Handel seit Langem eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen war. Gerade Hamburg und Bremen spielten eine bedeutende Rolle: Ohne die hanseatischen Unternehmer hätte es die deutschen Kolonien nicht gegeben, erst auf ihr Drängen reagierte die Politik. Die Deutschen in Afrika waren berüchtigt für ihre Prügelstrafen, Zwangsarbeit war unter ihrem Regime die Regel. Dietmar Pieper beleuchtet ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind.
Einleitung: Deutschland und der Kolonialismus
„Es gibt einen dunklen Weltteil, der Entdecker aussendet.“
Karl Kraus, Die Fackel (1909)
Lange bevor die Deutschen ein eigenes Kolonialreich gründeten, hatten sie sich an den Kolonialismus gewöhnt. Sie nannten ihn nicht so, sie brauchten überhaupt kein Wort dafür, denn es war eine schleichende Gewöhnung, die vor mehr als 300 Jahren anfing und ihren Alltag für immer veränderte – erst in der Küche oder bei geselligen Zusammenkünften, dann in ihren Kleiderschränken und Kommoden und schließlich überall. Der Kolonialismus kam [...]
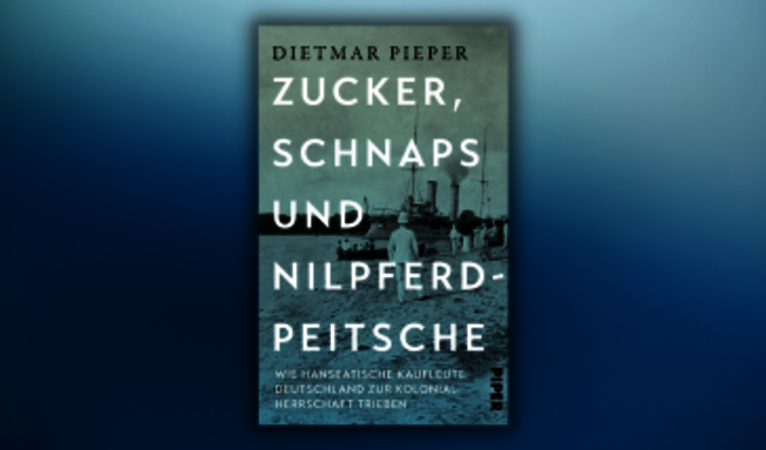
„Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche“ von Dietmar Pieper wurde für die Shortlist des Wirtschaftsbuchpreises 2023 nominiert.
weitere Infos„›Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche‹ vermittelt ein exzellentes Bild vor allem von dem historischen Hamburg.“
Hamburger Abendblatt„Piepers Buch ist ein kluges, und angenehm unaufgeregtes Plädoyer dafür, über einen verantwortlichen Umgang mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu diskutieren und geeignete Lehren aus ihr zu ziehen.“
Deutschlandfunk „Andruck“„Es ist ein wichtiges Buch, das zeigt, dass heute die Kolonialgeschichte mit ihren Auswirkungen gerne kleingeredet wird.“
kultur-extra.de„Dieses Buch ist seit Jahren überfällig und sollte als Pflichtlektüre an allen Schuleinrichtungen eingeführt werden.“
freundederkuenste.de„Spannend, faktensatt, an Personen und Schicksalen entlang erzählt. Kurz: so, wie man sich die Vermittlung historischen Wissens immer gewünscht hätte.“
Wochenanzeiger„Dietmar Piepers ausgesprochen gut recherchiertes und lesbares Buch zu diesem Thema zeigt unter anderem den immensen Einfluss hanseatischer Kaufleute auf die Politik.“
Weser-Kurier„Der Reiz des Buches liegt vor allem in der historischen Tiefenschärfe, mit der die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft verfolgt werden. Es ist über die Hamburger Lokalgeschichte hinaus eine umfassende Darstellung des deutschen Kolonialismus und seiner Vorgeschichte seit dem 18. Jahrhundert.“
Tagesspiegel„Hamburg war die eigentliche Hauptstadt des Kolonialismus, und viele der ehrbaren Kaufleute haben davon nicht nur profitiert, sondern die Kolonialisierung aktiv vorangetrieben. Das belegt Dietmar Pieper eindrücklich in seinem Buch.“
NDR Kultur "Das Journal"„Ein wichtiger Beitrag dazu, sich mit der eigenen Vergangenheit kritisch zu befassen.“
Münchner Merkur„Gespickt mit historischen Anekdoten erweckt Piepers Werk die Welt der Hamburger Patrizierfamilien des 18. und 19. Jahrhunderts zum Leben, der Sievekings und Godeffroys.“
Handelsblatt„Piepers kolonialistische Spurensuche im deutschen Norden lässt sich mit Spannung verfolgen. Auch sein Spaziergang am Ende des Buches durch das heutige Hamburg vorbei am vormaligen Völkerkundemuseum, dem Bismarck-Denkmal, Chile-Haus und der Hafen-City, alle in Schwarz-Weiß-Bildern gezeigt, schärft den Blick für manche in dieser Form bislang nicht wahrgenommene Ungereimtheiten.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung„Er schildert detailliert und spannend.“
Das Parlament„kenntnisreich und detailliert“
Business & Diplomacy„Pieper zeichnet akribisch nach, dass bereits vorher schon in deutschen Landen bei diesem Spiel eifrig mitgemischt wurde.“
(A) Buchkultur - Das internationale Buchmagazin„Detailliert beschreibt er, wie hanseatische Kaufleute die Kolonialherrschaft des Deutsche Reiches vorantrieben.“
Philosophie MagazinHerr Pieper, in drei Sätzen gesagt: Worum geht es in Ihrem Buch?
Die Deutschen hatten viel mehr mit dem weltweiten Kolonialismus zu tun, als heute meistens angenommen wird. Das fing schon vor Jahrhunderten im privaten Alltag an, mit angenehmen Dingen wie Kaffee und Zucker aus der Karibik oder Brasilien, und führte schließlich zu einem weitgespannten Kolonialreich. Ich erzähle diese Geschichte möglichst anschaulich anhand ausgewählter Personen und Ereignisse.
Welche Rolle spielten hanseatische Kaufleute beim deutschen Kolonialismus?
Sie waren die entscheidenden Wegbereiter. Die Händler in Hamburg und Bremen verfügten nicht nur über die nötigen internationalen Kontakte, sondern dank ihrer Häfen auch über den direkten Zugang zum Atlantik und damit zur kolonialen Welt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren es hanseatische Geschäftsleute, die in Afrika Kolonien gründeten und Reichskanzler Otto von Bismarck dazu brachten, dafür die staatliche Verantwortung zu übernehmen.
Viele meinen, dass Deutschland eine vergleichsweise kleine Kolonialmacht war. Stimmt das?
Was heißt klein? Es ist noch nicht furchtbar lange her, da waren viele Deutsche ganz stolz darauf, dass sie das drittgrößte Kolonialreich der Welt beherrschten, hinter Briten und Franzosen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sich die Perspektive um: Auf einmal schien die koloniale Ära weit weg und ziemlich unbedeutend gewesen zu sein. Aber das war sie nicht.
Wie haben die deutschen Kolonialherren in Afrika konkret gehandelt?
Ihr Ziel war es, aus den unterworfenen Gebieten wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Dazu war ihnen fast jedes Mittel recht. Zwangsarbeit und Prügelstrafen galten als normal, die Verhältnisse waren oft nicht besser als auf Sklavenplantagen. Die deutsche Gesellschaft war von Rassismus durchdrungen.
Hat der Kolonialismus Auswirkungen bis heute? Und wenn ja, welche?
Seinem Wesen nach war der Kolonialismus immer ein ökonomisches und kein machtpolitisches Unternehmen. Davon wird unsere heutige Welt noch stark geprägt, denn die Globalisierung ist ein Kind der Kolonialzeit. Für den globalen Norden waren und sind die Länder des globalen Südens in erster Linie dafür da, Ressourcen zu liefern – billige Arbeitskräfte, begehrte Lebensmittel und Bodenschätze. Der unfaire Handel wird oft beklagt, dauert jedoch in vieler Hinsicht an. Und noch etwas: Der hemmungslose Umgang mit Ressourcen, der den Kolonialherren zur zweiten Natur wurde, dürfte die wichtigste Ursache des menschengemachten Klimawandels sein.
Einleitung Deutschland und der Kolonialismus
Editorische Notiz
1 Der bittere Zucker des Herrn Schimmelmann
2 „Hamburg hat Kolonien erhalten“
3 Ein Südseekönig, der niemals in der Südsee is
4 »Eine fröhliche Conquista
5 Regime der Gnadenlosen
6 Im deutschen Inselreich
7 Das Heimweh einer arabischen Prinzessin
8 „Solang Brasilien Kaffee hat“
9 Krieg in Südwestafrika
10 Das Erbe einer Epoch
Ausblick Die Zukunft des Erinnerns
Dank
Bildnachweis
Anmerkungen
Die erste Bewertung schreiben