

Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann? Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann? - eBook-Ausgabe
Die große Orientierungslosigkeit nach der Schule
— Das Geschenk zur Abitur 2022Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann? — Inhalt
Fertig mit der Schule - und dann?
Der Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium verläuft heutzutage nicht mehr reibungslos und friedlich. In den Familien spielen sich wahre Dramen ab. Ulrike Bartholomäus erklärt, wie es gelingen kann, hartnäckige Nesthocker, ewige Selbstzweifler und tiefenentspannte Dauerchiller in die Selbstständigkeit zu entlassen.
Ulrike Bartholomäus widmet sich unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert einem echten Gesellschaftsphänomen. Während die einen auf die Straße gehen und für ihre Zukunft demonstrieren, hockt ein anderer Teil auf dem Sofa und bräuchte ein Schild auf der Stirn: „Wegen Umbau geschlossen“.
Eckart von Hirschhausen, Arzt, Autor und Gründer der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN
Dieses Buch ist Nervennahrung für Eltern von Heranwachsenden, die nach der Schule nicht wissen, was sie wollen, was sie können und wer sie sind.
Stefan Klein, Bestseller-Autor
Die große Orientierungslosigkeit nach der Schule ist ein Massenphänomen: Junge Erwachsene, ob mit Einser-Abitur oder weniger glanzvollen Abschlüssen, sind nach der Schule blockiert. Statt mit wehenden Fahnen ins Leben zu starten, fühlen sie sich unfähig zur Entscheidung - für die richtige Ausbildung, den richtigen Beruf. Es wird gelitten, gestritten und viel gechillt. Ulrike Bartholomäus erzählt anschaulich und mitunter nicht ohne Komik von den Dramen, die sich in den Familien abspielen.
Die Wissenschaftsjournalistin recherchiert bei Pädagogen, Ärzten und Wissenschaftlern, um dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Sie hat zahlreiche junge Menschen, die länger für ihre Orientierungsphase gebraucht haben, begleitet. Sie haben für dieses Buch auch Gespräche mit Gleichaltrigen geführt. Die Autorin liefert damit das Porträt einer Generation zwischen Gap year, Sinnsuche, langwieriger Studienfachfindung, Verweigerung und Aufbruch ins Unbekannte.
Eine lebensnotwendige Lektüre für alle Eltern, die nichts sehnlicher wünschen, als ihr Kind in die Selbständigkeit zu entlassen.
Leseprobe zu „Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann?“
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Eine blockierte Generation?
Teil 1 // Die große Orientierungslosigkeit
Viel zu jung
Verkürzte Schulzeiten und ihre Folgen
Das Chaos der Gefühle
Verunsicherung lähmt das Denken
Der Coolnessfaktor
Die perfekte Lebensplanung als Falle
Der digitale Lifestyle
Bindung von Energie und Konzentration
Unendliche Möglichkeiten
Die Vielfalt neuer Studiengänge
Tatenlosigkeit der Kinder
Aktionismus der Eltern
Nicht jede Entscheidung ist die richtige
Ausbildungs- und Studienabbrecher
Teil 2 // Die zweite Pubertät
Im Schneckentempo
Warum sich das menschliche [...]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Eine blockierte Generation?
Teil 1 // Die große Orientierungslosigkeit
Viel zu jung
Verkürzte Schulzeiten und ihre Folgen
Das Chaos der Gefühle
Verunsicherung lähmt das Denken
Der Coolnessfaktor
Die perfekte Lebensplanung als Falle
Der digitale Lifestyle
Bindung von Energie und Konzentration
Unendliche Möglichkeiten
Die Vielfalt neuer Studiengänge
Tatenlosigkeit der Kinder
Aktionismus der Eltern
Nicht jede Entscheidung ist die richtige
Ausbildungs- und Studienabbrecher
Teil 2 // Die zweite Pubertät
Im Schneckentempo
Warum sich das menschliche Gehirn so langsam
entwickelt
Spätzünder Vernunft
Wenn Risikobereitschaft und die Folgenabschätzung
auseinanderklaffen
Übergang
Erwachsenwerden oder Erwachsensein?
Die große Frage
Wer bin ich?
Die iGeneration
Die psychischen Auswirkungen von Smartphone
und Tablet
Teil 3 // Ausweg: Was Eltern tun können –
und was sie lieber lassen sollten
Reifung braucht Zeit
Ein Plädoyer für Auszeiten
Auf dem Prüfstand
Der ehrliche Check der elterlichen Erwartungen
Runter vom Radar
Eigenverantwortung statt Rundumkontrolle
Raus aus der Familiendynamik
Mentoren als neutrale Ansprechpartner
Reality-Check
Einfach jobben gehen
Mit dem Latein am Ende
Wenn Profis ins Boot geholt werden müssen
Ausblick
Den inneren Kompass suchen und finden
Anmerkungen
Literatur
Dank
Einleitung
Eine blockierte Generation?
Ein Grillabend bei Freunden in Hamburg. Das Wetter ist grandios, die Steaks brutzeln neben einem von der Dame des Hauses fein kuratierten Sortiment aus Biowürstchen ihrem optimalen Garpunkt entgegen. Susanne meldet sich zu Wort, will wissen, was denn nun mit der Tochter von Helmstedts ist. „Nina hat doch letztes Jahr Abitur gemacht, oder? Was macht sie denn jetzt?“
Das ist das Stichwort für Rainer. Ninas Vater streckt kurz den Rücken durch und knallt eine Antwort raus, noch bevor seine Frau einatmen kann: „Sie ist arbeitslos.“ Die Worte wirken wie ein Torpedo. Stille in der Runde. Gundula Helmstedt, alarmiert, übernimmt: „Na ja, sie weiß noch nicht so genau, was sie machen will. Sie nimmt sich gerade ihr Gap Year.“
Allgemeines Nicken bei der Grillgemeinde. Thomas weiß zu berichten, dass sein ältester Sohn seit seinem Abitur vor 15 Monaten nicht eine einzige Bewerbung rausgeschickt hat. „Er jobbt jetzt im Schuhgeschäft, spezialisiert auf teure Sneaker.“ Thomas’ Frau ergänzt schulterzuckend: „Er meint, mit Sportschuhen kenne er sich bestens aus. Der Job sei mega.“
Noch ehe sich Ratlosigkeit breitmachen kann, setzt Ninas Vater noch einen drauf: „Na, immerhin arbeitet er. Nina tut den ganzen Tag nichts – außer duschen und ins iPhone starren.“
Die Würstchen und Steaks scheinen fertig, alle greifen zu. Das Fleisch ist von außen perfekt angegrillt, aber innen noch lange nicht durch. Ein bisschen wie der Entwicklungszustand der Kinder, denkt sich Susanne, sagt aber lieber nichts.
Stotternder Start ins Leben
Die große Orientierungslosigkeit nach der Schule ist ein Massenphänomen: Junge Erwachsene sind nach der Schule blockiert. Sie tauchen nicht ein ins Leben, sondern fühlen sich unfähig zur Entscheidung für den richtigen Beruf, die richtige Ausbildung, das richtige Studium. Es wird gelitten, gestritten und viel gechillt. Die Eltern verzweifeln; die Jugendlichen auch – sie fühlen sich schuldig. Natürlich wünschen sich die Eltern, dass ihre Kinder nach dem Schulabschluss und spätestens mit der Volljährigkeit selbstständig sind und sie einen Großteil der Verantwortung abgeben können.
Doch bei vielen Jugendlichen stellt sich diese Autonomie, die Ziel jeder Erziehung ist, nicht ein, da sind sich Universitätsdozenten, Berufsschullehrer und Eltern einig. Ganz im Gegenteil: Ohne die äußere Struktur durch die Schule fallen sehr viele junge Erwachsene erst einmal in ein Loch.
Viele Abgänger wissen nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollen, welche Begabungen sie auszeichnen, und letztlich wissen sie nicht, wer sie sind. Ein Symptom dieser Orientierungslosigkeit ist die hohe Studienabbrecherquote, die das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover verzeichnet. Demnach bricht jeder dritte Student sein Studium ab. Besonders dramatisch sieht es bei den Ingenieurwissenschaften aus: Hier schmeißt jeder Zweite hin.
Bei den Ausbildungen zeigt sich ebenfalls ein Trend zum Abbrechen. Ein Viertel aller Lehren wird vorzeitig beendet. Die Quote bei besonders schlecht bezahlten Ausbildungen wie Friseuren oder Sicherheitspersonal liegt sogar bei 50 Prozent. Einige Auszubildende wechseln allerdings nicht aufgrund ihres unklaren Berufswunsches, sondern weil ihnen bessere Alternativen und viele offene Stellen gegenüberstehen. Warum sich ausbeuten lassen, wenn eine gute und besser bezahlte andere Ausbildungsstelle lockt?
Bei der letzten Inspektion meines Autos sah ich ein Schild am Tresen der Werkstatt prangen: „Mechatroniker gesucht, 300 Euro Belohnung!“
„Wie lange hängt das Schild denn schon?“, will ich vom Werkstattmeister meines Vertrauens wissen.
„Zwei Monate.“
„Und wie viele haben sich gemeldet?“
„Keiner. Kürzlich hat hier der Sohn meiner Freundin mit der Ausbildung angefangen. Aber nach kurzer Zeit wechselte er zu Mercedes. Die Industrie zahlt ihm in seiner Ausbildung deutlich mehr, als wir ihm hier bieten können.“
Zu den Hauptgründen für ein abgebrochenes Studium zählt vor allem die eigene unzulängliche Leistung: Jeder Dritte scheitert an den Anforderungen der ersten Semester. Fast jedem Fünften fehlt es an Selbstmotivation. Knapp jeder Sechste sieht sich an einer Hochschule ohnehin fehl am Platz und möchte lieber eine Ausbildung machen.
Der Shell-Studie „Jugend 2015“ zufolge ist die Orientierungslosigkeit der Schulabgänger der Grund, warum der Übergang in den Beruf heute nicht mehr reibungslos klappt. Ein Viertel der Abgänger ist von vornherein davon überzeugt, den gewünschten Beruf nicht ergreifen zu können. Lustloses Herumsuchen nach Alternativen ist die Folge. Jeder zweite Schulabsolvent hat Angst davor, dass seine Freizeit aufgrund der Berufstätigkeit eingeschränkt wird. „Unsere Generation hat nicht auf dem Schirm, dass es ein Privileg ist, überhaupt studieren zu können“, sagt der 19-jährige Leo aus Trier.
Zur Orientierungslosigkeit trägt auch bei, dass mit dem Eintritt ins Studium oder in den Job Anspruch und Wirklichkeit aufeinanderprallen. So ist es drei Viertel der Jugendlichen beispielsweise wichtig, dass sich ihre Arbeitszeit an ihre Bedürfnisse anpassen lassen sollte. Der Arbeitsmarkt hingegen sucht bislang motivierte Vollzeitkräfte. Das ändert sich allerdings gerade. Denn wer einen hoch motivierten, begabten Vertreter der Generation Z dauerhaft halten will, gibt ihm am besten einen Laptop, ein Smartphone und ein dehnbares Gleitzeitkonto. Dann laufen sie zur Höchstleistung auf. Viele Start-ups haben das schon begriffen.
Ein prominentes Beispiel dieses Übergangsdilemmas ist „Hannah Horvard“, Hauptfigur in der preisgekrönten US-Serie „Girls“ von Lena Dunham. Die Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Schauspielerin spielt sich darin zu großen Teilen selbst. Nach der Schule schlägt sie sich mit unbezahlten Praktika in New York durch, pflegt ihre Neurosen, erkundet ausgiebig ihr Sexleben und versucht sich nebenbei an kreativem Schreiben – natürlich auf Kosten von Mama und Papa. Diese haben, so erzählt Teil eins der 62-teiligen Serie, die langwierige Findungsphase ihrer Tochter zunächst großzügig finanziert. 1500 Dollar im Monat sind in New York schließlich schnell durchgebracht. Der große Schock erreicht Hannah, als ihre Eltern ihr eines Abends in einem Restaurant eröffnen, dass sie ihr ab sofort den Geldhahn zudrehen.
Willkommen im Leben, heißt es für Hannah. „Girls“ machte Lena Dunham, die zum Start der Serie 2012 Mitte zwanzig war, weltweit bekannt und bescherte ihr großen Erfolg. Die ins Leben strauchelnden Twenty-somethings ihrer Drehbücher trafen den Nerv der Zeit: Junge Frauen, die zwar große Ambitionen haben und etwa Schriftstellerin oder Journalistin werden wollen, aber niemanden finden, der sie auch dafür bezahlt. Dazu Eltern, die nicht an das Talent ihres Nachwuchses glauben. Junge Männer, die gern mit diesen Frauen zusammen sind, aber sich auf keinen Fall festlegen wollen auf eine Beziehung, die den Namen verdient.
Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen Jungen und Mädchen dieser Generation. Unter den jungen Frauen lassen sich viele mit einem ungeheuer anspruchsvollen Lebensentwurf ausmachen. Sie wollen alles und damit das Unmögliche: einen hohen Bildungsstand, viele soziale Kontakte, eine sinnvolle Berufstätigkeit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie und viel Geld. Und zwar sofort. Sie träumen von einer App, mit der sie ihr Leben herunterladen können, natürlich individuell konfigurierbar. Man könnte ein Leben ausprobieren, berufliche Laufbahnen einschlagen, Leute treffen und mit allen Optionen herumspielen. Wenn es einem nicht mehr gefällt, drückt man delete. Alles kostenlos, folgenlos.
Bei den jungen Männern geben sich einige eher betont cool und distanziert, wenn sie nach ihren Berufsvorstellungen gefragt werden. „Selbst im Gespräch mit Gleichaltrigen ist es schwer, ein klares Feedback zu bekommen“, sagt Leo, der nach einem Jahr Jobben mit einem Psychologiestudium in Trier begonnen hat. Die Reaktion auf die Frage der Eltern, was sie denn einmal werden wollen, lautet nicht selten „Entspann dich“. In Wahrheit fühlen sie sich verunsichert und überfordert. Folgen sie dem Vorbild von Papa (hart arbeitender Mittelstand), werden sie YouTuber oder gleich Gründer? Welche Start-up-Idee ist der nächste „heiße Scheiß“?
Nun gibt es eine Schwierigkeit, über Jugendliche in der Phase der Orientierung oder der Orientierungslosigkeit zu recherchieren. Man muss zum Naturforscher werden und sich auf eine Expedition mit ungewissem Ausgang einlassen; denn diese Wesen sind wie Schneeleoparden: meist in Deckung und stets auf der Flucht.
Es schien mir unumgänglich, Jugendliche selbst sprechen und an diesem Buch mitarbeiten zu lassen, denn wer erklärt Eltern besser, in welcher Situation sich ihre heranwachsenden Kinder befinden, als Letztere selbst. Das Vorhaben umzusetzen, entpuppte sich jedoch als weitaus schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Denn eines haben diese jungen Menschen gemein: Sie sind nicht greifbar. Man sieht zwar von weitem die Nebelschwaden vorüberziehen; doch kaum nähert man sich, um ihre Zukunftspläne zu erhaschen, verflüchtigen sie sich.
Zunächst einmal hält sich ein nicht unerheblicher Teil dieser Spezies in Australien oder Asien auf. Die anderen sind noch im Lande, aber schwer erreichbar. Schickt man eine E-Mail, antworten sie nicht; oder erst nach Tagen, Wochen, Monaten. Ruft man sie an, gehen sie nicht ans Telefon. Mit etwas Glück produzieren sie mit einem Fingertipp auf ihr Smartphone ein „Ich kann gerade nicht sprechen“.
Überhaupt, telefonieren – für viele dieser Spezies die Höchststrafe. Besser also per WhatsApp. Verabrede ich einen Telefontermin, bekomme ich eine Message: „Mir ist was dazwischengekommen.“ Oder auch ganz beliebt: „Melde mich später.“ Willkommen im Reich der Unverbindlichkeit. „Ja“ kann „ja“ heißen oder „nein“. Und „nein“ kann am nächsten Tag „ja“ heißen oder auch nicht. Ich brauchte also einen Plan B, und der hieß Anton. Der 21-Jährige hatte nach dem Abi erst einmal Zeit zum Chillen, Jobben, Ausgehen. Manchmal auch Nachdenken. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Seine Freiheit, sein Nebenjob und seine Freunde, für die er viel Zeit hatte, ermöglichten ihm ein paradiesisches Leben.
Wären da nicht seine nervigen Eltern gewesen. Sie taten, was alle Eltern tun: Sie produzierten Erwartungen. Sie äußerten keine Forderungen, dass er etwas Bestimmtes tun solle etwa in die Fußstapfen von Vater oder Mutter zu treten –, nein. Es war lediglich die Mindesterwartung von Eltern in dieser Situation, nämlich, dass sich der geliebte Sprössling überhaupt etwas überlegt. Nach sieben Monaten gab Anton dem Druck von zu Hause nach. Er immatrikulierte sich für BWL an einer kleinen, kuscheligen Universität in Bayern. Alle waren begeistert. Anton, seine Freunde, seine Eltern, die Freunde der Eltern. Die Begeisterung hielt jedoch nicht lange an, zumindest nicht bei dem jungen Mann. Nach kurzer Zeit brach er das Studium ab, stand mit ein paar Umzugskisten wieder zu Hause vor der Tür.
In dieser Zeit führte ich die ersten Interviews mit ihm. Es stellte sich heraus, dass er seine Lage äußerst differenziert reflektierte. Er konnte auch zahlreiche Beispiele anführen von Gleichaltrigen, die in ähnlichen Situationen steckten. Er war unglaublich offen. Interessiert lauschte er meinen Erkenntnissen, die ich auf Forschungsseite über das heranreifende Gehirn recherchiert hatte, über die Zahlen der Studienabbrecher etc. Er fand sich in Schilderungen von anderen Experten wieder. Er sah, dass sich bereits ein Heer von Forschern der Frage widmet, was diese Orientierungsphase für die Betroffenen so schwierig macht. Er war kein Exot, der als Einziger Zeit brauchte, um sich im Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Er war wie alle anderen da draußen. Es entwickelte sich ein spannender Dialog.
Plan B reifte heran. Was, wenn Anton und andere wie er Gleichaltrige befragen würden? Vielleicht schreckte sie ein Gleichgesinnter, der ihre Orientierungslosigkeit aus eigener Anschauung kannte, weniger ab – jemand, der so alt war wie sie, dachte wie sie, kommunizierte wie sie; der sich nicht abhalten ließ, wenn sie zweimal einen Termin verschoben; der dies nicht als Desinteresse oder Ungehörigkeit wahrnahm, sondern schlichtweg als Zeichen dafür, dass sie an dem Tag etwas Besseres vorhatten. Na und? Und vor allem: der mir ihre Gedanken und Geschichten übersetzen konnte in meine Sprache, mein Denken, meine Kultur.
Gleichzeitig suchte und fand ich andere Anfang 20-Jährige, die für mich Interviews führen sollten: Katharina, Conrad, Zorah und Timon. Ich erklärte ihnen die Idee. Sie waren sofort begeistert. Zwar hatten sie in ihrem Leben noch kein einziges Interview geführt, doch das schreckte niemanden ab. Alle schienen kommunikative Naturtalente zu sein. Ich erarbeitete einen Fragebogen, gedacht als roter Faden für die Gespräche. Spontan gab ich allen noch mit: „Hört auf euer Bauchgefühl und stochert da, wo ihr glaubt, dass es interessant wird.“ Nicht gerade eine präzise Regieanweisung, aber sie brauchten auch gar keine – sie waren ja bereits voll im Film und wussten intuitiv, wonach sie fragen mussten.
Als ich das erste Interview abhörte, traute ich meinen Ohren nicht. Anton hatte einen Volltreffer gelandet, er förderte geheimste Gedanken des Interviewkandidaten zutage. Ebenso Katharina, Timon, Zorah und Conrad. Timon saß in Hanoi und befragte während seiner Weltreise einen Freund. Conrad sprach mit Mitstudenten in Amsterdam an einer Akademie für Popmusik. Katharina in München war gerade dabei, sich auf den Psychologietest in Wien vorzubereiten, und fand Kandidatinnen im Freundeskreis. Zorah, gerade fertig mit dem Abitur, war umgeben von Gleichaltrigen, die keinen Plan hatten, was sie machen wollten.
Alle fünf schickten mir ihre Audiofiles per WhatsApp, wann immer sie jemanden gesprochen hatten, sowie ein Foto der interviewten Person. Anschließend werteten wir das Interview gemeinsam aus, formulierten Nachfragen. Sie schickten mir Links von YouTubern, denen sie folgten, Infos zu Apps für die Jobsuche, Fotos aus der neuen WG. Sie ließen mich an ihrem Leben teilhaben, wann immer es sich ergab.
Die Gespräche drehen sich um das Chaos der Gefühle, das die jungen Erwachsenen in dieser Phase durchlaufen; um ihre Träume, ihre großen Ambitionen, Ängste, den Jobmarkt, das liebe Geld, um Studienabbrüche und Fächerwechsel, Umzüge in eine andere Stadt oder ein anderes Land, Einsamkeit, Zweifel, Streit mit den Eltern, ums Kiffen, härtere Drogen und um Liebeskummer. Die emotionale Achterbahn reicht von Verunsicherung, manchmal auch mentaler Komplettlähmung bis hin zur Euphorie, wenn schon während des Studiums die ersten Jobangebote kommen. Wir fragten nach dem vielfältigen Angebot, das die jungen Erwachsenen heute nach dem Abitur erwartet – Praktika, neue Studien- und Ausbildungsgänge im In- und Ausland, Berufsbildungsbörsen. Sehen die Anfang 20-Jährigen darin eher die Chancen, oder lähmt sie die Qual der Wahl?
Nach einem Dutzend abgehörter Interviews begann ich selbst auch wieder Gespräche zu führen. Neben Eltern, Berufsschullehrern und Unidozenten sprach ich mit Leo, Luise, Lucas, Sophia, Charlotte und anderen, die anonym bleiben wollten. Die Geschichten derjenigen, die unerkannt bleiben möchten, erscheinen in Absprache mit ihnen mit einem geänderten Namen, manchmal auch mit einem geänderten Wohnort. Mit einigen telefonierte ich regelmäßig. Nicht alle Jugendlichen sind so tatkräftig wie meine Interviewer und Gesprächspartner: Abi, jobben, Praktika, für einen Eignungstest lernen, Weltreise, Studium beginnen. Einige von ihnen haben eine längere Phase des Suchens durchlaufen, haben Pläne geschmiedet und sie wieder verworfen. Die meisten haben mich jedoch verblüfft mit ihren hochfliegenden Plänen, ihrem Mut und ihrer Power, mit der sie das, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hatten, auch umsetzen. Voraussetzung war meist, dass sie sich Zeit für die Orientierungsphase genommen haben.
Bei den Gleichaltrigen sehen sie, dass sich viele durch den digital geprägten Lebensstil ablenken lassen. Er bindet Energie, kostet Konzentration und stellt oft eine Form der Realitätsflucht dar. Erst nach und nach beginnen Experten wie die Psychologin Jean Twenge oder der Professor für Marketing Adam Alter, die suchtartige Beziehung der Benutzer zum Smartphone aufzudecken. In seinem Buch Unwiderstehlich schreibt Alter, dass ausgerechnet die Pioniere der amerikanischen Hightech-Branche wie Apple-Gründer Steve Jobs, Even William, einer der Erfinder von Twitter, oder Lesley Gold, Gründerin einer Web-Controlling-Firma, Smartphones und Tablets von ihren Kindern fernhielten. Sie wussten um das suchterzeugende Potenzial der technischen Geräte oder Plattformen, die sie erfunden hatten. Besonders Kinder und junge Erwachsene können sich dem schwer entziehen. Falls sie ungehinderten Zugang über das W-LAN haben, starren sie jeden Tag stundenlang auf ihre Geräte, statt Hausaufgaben zu machen, zu spielen oder, im Fall der Schulabgänger, Bewerbungen für Praktika oder Ausbildungsstätten in den Orbit zu schicken.
Eltern verzweifeln an der Rat- und Tatenlosigkeit ihrer ewigen Teenager-Kinder, die wochen- und monatelang herumhängen. Je länger diese Phase andauert, desto stärker macht sich bei ihnen Panik breit. Auf die Verzweiflung folgt der Aktionismus. Die Erwachsenen drängen die Heranwachsenden zu einer Entscheidung. Oft übernehmen sie das Handeln. Es wird mitunter europaweit nach einem passenden Praktikum oder Studienplatz gefahndet. Medizin an der Privatuni in Riga oder Psychologie in Maastricht, noch schnell einen Crashkurs Holländisch …
Bumerang-Kid oder Nesthocker?
Manchmal entwickelt sich der Jugendliche zum Bumerang-Kid. Kaum in die Welt hinausgeworfen, kommt er nach ein paar Monaten wieder nach Hause: Studium geschmissen, Ausbildung abgebrochen, Auslandsaufenthalt früher beendet. Zum Umzug rückt Papa mit dem Werkzeugkasten an, schraubt die Ikea-Regale, die er gerade anmontiert hat, wieder ab. Gut, dass Billy das ein paarmal überlebt. Nun soll „Plan B“ greifen, doch der existiert meist nicht. Stattdessen heißt es „Zurück auf Los“. Mama zieht eine Ereigniskarte: „Ihr neues Arbeitszimmer wird wieder von Ihrer Tochter bewohnt. Stellen Sie Ihren Schreibtisch zurück ins Schlafzimmer.“
Wenn sie nicht als Bumerang zurückkommen, sind die Sprösslinge vielleicht gar nicht erst ausgezogen: Im Jahr 2015 wohnten in Deutschland 62 Prozent der 18- bis 24-Jährigen noch im „Hotel Mama“. Laut Statistischem Bundesamt ist ihr Anteil in den letzten zehn Jahren nahezu unverändert geblieben 2005 waren es 64 Prozent. Dabei führen die Männer die Stubenhocker-Statistik mit Abstand an: 68 Prozent der männlichen jungen Erwachsenen leben noch zu Hause, und immerhin 56 Prozent der Frauen. Die Nesthocker sitzen vor allem auf dem Land. In kleinen Gemeinden unter 10 000 Einwohnern blieben 78 Prozent der 18- bis 24-Jährigen bei den Eltern. In Großstädten ab 500 000 Einwohnern zogen 45 Prozent nicht aus.
Neben gut nachvollziehbaren Gründen, zum Beispiel weil sie eine Ausbildung machen und das Geld noch nicht reicht für eine eigene Wohnung, ist es vor allem die Bequemlichkeit, die sie bei den Eltern hält. Und manchmal sind es auch die Mütter und Väter, die ihre großen Kinder um sich haben wollen. Als ich mich unlängst in einer Parfümerie an der Friedrichstraße dafür belohnte, dass unsere 18-jährige Tochter im Begriff war, auszuziehen, und auch ein kleines Geschenk für ihr neues Bad aussuchte, erzählte ich der Verkäuferin stolz von dem neuen Lebensabschnitt für unsere Familie. Entsetzt stellte sie jegliche Geschenkverpackungsaktivitäten ein und presste hervor, sie hätte jetzt schon Angst, dass ihr 16-jähriger Sohn eines Tages ausziehen würde. Sie hoffe, er würde bis zum dreißigsten Lebensjahr bei ihr wohnen bleiben. Es gibt nicht nur Nesthocker oder Bumerang-Kids, sondern auch Pattexmütter und -väter, die am Nachwuchs kleben.
Wenn ich mit Eltern Gespräche führte, deren Anfang 20-jährige Sprösslinge auf der Suche waren, fragten sie meist irgendwann: „Und was sollen wir jetzt machen?“ Aus diesen Gesprächen, gepaart mit den Informationen der Heranwachsenden selbst, ist Teil 3 dieses Buches geworden. Er enthält Auswege und Ideen, was Eltern tun können und was sie lassen sollten. Natürlich gibt es kein Patentrezept. Dennoch zeigen Erfahrungen, dass es in der Orientierungsphase einige Grundprinzipien gibt, die sich bewährt haben. Eine Wahrheit, die Eltern ungern hören, ist: Reifung braucht Zeit. Das Gehirn der meisten 18-Jährigen vermag noch keine strategischen Entscheidungen zu treffen. Nach einem Jahr Auszeit, in der neue Erfahrungen und Kompetenzen erworben werden können, sieht das schon ganz anders aus – jedenfalls wenn die Auszeit entsprechend genutzt wird.
Ob ein Freiwilligendienst in Nepal, wo David Straßenkindern Englischunterricht gab, ein Aufenthalt in Kolumbien mit dem American Field Service, während dessen Charlotte fließend Spanisch lernte, oder ein Werksstudentenjob bei einem angesagten Start-up – viele Wege führen nach Rom. Dabei gilt: Nicht jede Reise trägt automatisch zur Reifung bei. Wer zum Partyurlaub nach Asien jettet, um dort mit zig anderen deutschen Travellern dauerkiffend im Hostel abzuhängen, reift definitiv nicht.
Viele Eltern können beruhigt sein: Ihre heranwachsenden Kinder sind völlig in Ordnung, wenn sie sich Zeit lassen. Anton, mein Interviewer Nummer eins, entwickelte sich innerhalb eines Jahres zum Beispiel vom zerknirschten Studienabbrecher zum hochgeschätzten Mitarbeiter eines Berliner Start-ups. Gerade mal im zweiten Semester BWL an einer Hochschule in der Hauptstadt, die weniger wissenschaftlich ausgerichtet ist, arbeitet er 20 Stunden pro Woche bei einer Firma, die Selbstständigen viel Zeit und Nerven spart, indem sie ihnen die Finanzbuchhaltung in einer App aufbereitet und ihnen die Zettelwirtschaft abnimmt. Schon zweimal haben ihn die Gründer befördert, denn auch sie haben sofort erkannt: Anton ist ein Kommunikationsgenie. Darüber hinaus verfügt er über ein angeborenes Vertriebstalent sowie eine große Neugier für Innovationen. Nach ein paar Monaten als Werksstudent knüpfte er die ersten Pressekontakte für sein Start-up, ganz nebenbei. Er befindet sich im siebten Himmel – glücklich, erfolgreich, geschätzt und gut bezahlt. Sein Studium schmeißt er so nebenbei, da geht es ihm auch nicht so auf die Nerven.
Nicht jeder muss gleich so viele Stunden im Studium arbeiten, um im Leben anzukommen. Nur nichts tun und einfach chillen sollten die Heranwachsenden in der Umbruchsphase möglichst nicht. Wenn sie also keine Ausbildung oder kein Studium anfangen wollen, kann Jobben ein sehr guter Reality-Check sein für den Entscheidungsprozess. Dann sollten die Betroffenen aber zumindest ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Wer ein Endlosstipendium fürs Rumhängen hat, dem fehlt die Motivation, damit aufzuhören.
Kiffen, bis der Arzt kommt
Nicht immer geht es jedoch nur ums Chillen und die Schwierigkeit, sich für eine Laufbahn zu entscheiden. Das beunruhigt zwar die Eltern, aber es ist ja noch nichts passiert. Wann Profis ins Boot geholt werden müssen, wann aus fehlender Motivation eine Depression entstehen kann und was passiert, wenn das Kind zum Dauerkiffer geworden ist, zeigt das letzte Kapitel. Im Laufe meiner zweijährigen Recherche bekam ich mehrere Fälle von ernsten Drogenproblemen bei jungen Menschen mit. Mal alarmierte mich ein Interviewer, einer seiner Gesprächspartner hätte Suizidgedanken, sei verzweifelt und suche einen Psychiater oder eine Klinik, um seine Kokainsucht in den Griff zu bekommen. Ein andermal berichtete mir die Tochter einer Bekannten, sie sei einmal von einem Joint nicht mehr runtergekommen. Das High habe wochenlang angehalten, und sie habe große Ängste entwickelt. „Ich dachte, mein Leben mit dem, was ich mir vorgenommen habe, sei vorbei.“ Zum Glück sei diese psychotische Episode nach drei Monaten abgeklungen.
Vor allem die Cannabis-Epidemie grassiert seit längerem unter Jugendlichen. Ob in Amsterdam, Wien, Maastricht, Zürich, München oder Berlin; ob auf der Reise in Asien, wo der Stoff so billig ist wie nirgendwo (ein Gramm kostet in Vietnam ein Euro statt zehn Euro wie in Deutschland oder in Australien); ob an Schulen oder an der Uni: Überall wird gekifft. Dabei kämpfen Psychiater mit zwei Problemfeldern: „Die Jugendlichen fangen heute früher an, manchmal mit 14 Jahren“, erläutert Torsten Grigoleit, Oberarzt an einer Suchtklinik im Rheinland. Es gibt zahlreiche Dauerkiffer, deren psychologische Entwicklung auf dem Stand des ersten Konsums stehen bleiben kann. Aber auch Kokain, Ecstasy, Alkohol und krude Drogencocktails werden konsumiert.
Die Frage, wann Experten ins Boot geholt werden müssen, ist heikel, denn das Vertrauen zwischen Eltern und ihren heranwachsenden Kindern kann empfindlich gestört werden, wenn Drogen thematisiert werden. Dennoch gilt, lieber einen Arzt zu früh ins Spiel zu bringen als zu spät. Die Folge von Dauerkiffen, die sogenannte Amotivationsstörung, kann irreversibel sein. Ein Joint enthält heute ein Vielfaches an THC, dem Wirkstoff, der „knallt“. Das, was Mama und Papa in den Happy Seventies zur Bewusstseinserweiterung geraucht haben, um sich John Lennon näher zu fühlen, hat nichts mit dem zu tun, was ihr Nachwuchs heute an synthetischem Cannabis konsumiert. „Der Unterschied zwischen einem Joint von früher und einem von heute ist ungefähr so, als wenn ich statt Bier Schnaps trinke“, erklärt Grigoleit. Er muss es wissen, seine Klinik ist voll mit Dauerkiffern, solchen Konsumenten, die mehr als drei Joints pro Woche rauchen; die meisten davon rauchen mehrfach täglich. Viele haben einen bleibenden Gehirnschaden; obwohl sie 30 oder 40 Jahre alt sind, befinden sie sich auf der Entwicklungsstufe eines pubertierenden Teenagers. Dass Cannabis dies bewirken kann, mag bizarr klingen, ist aber äußerst beunruhigend.
Wenn sie nicht gerade mit Drogen ihr Hirn wegpusten, finden die allermeisten Anfang 20-Jährigen einen Weg aus der Orientierungslosigkeit heraus. Wichtig ist, dass Eltern im Gespräch bleiben mit ihren suchenden Kindern; dass sie sich selbst klarmachen, wie langsam diese Entwicklung vonstattengeht und wie sie sie in dieser Phase begleiten können, ohne sie zu bevormunden. Es ist eine der wohl anstrengendsten, aber auch spannendsten Phasen in der Entwicklung eines Menschen.
Zu sehen, wie jemand sein Potenzial entfaltet, wenn er oder sie einmal das Richtige fürs Leben gefunden hat, gehörte zu den großartigsten Momenten dieser Recherche. Zu hören, welch wunderbare Musik Conrad aus Amsterdam nach nur drei Semestern an der Musikakademie komponiert; zu erleben, wie Katharina in Wien aufblüht, als sie nach zwei Jahren Jobben anfängt, Soziologie zu studieren. Zorahs erste Schritte bei ihrem Praktikum in der PR-Agentur zu erleben und mit Timon mitzufiebern, wie er als Ersti den Beginn des Jurastudiums bewältigt; oder für Sophia die Daumen zu drücken, dass sie alle Medizin-Prüfungen an der Semmelweis-Uni in Budapest besteht.
Dies ist die gute Nachricht für alle Eltern von Heranwachsenden, die in einer Phase der Orientierungslosigkeit stecken: Die Phase des Chillens, des Nicht-Wissens-was-kommt und des unmotivierten Stocherns in Berufswegen geht vorbei, sobald der Funke überspringt und sie etwas für sich gefunden haben, das passt. Und dann rasen die Schneeleoparden, die sich gerade noch versteckt hatten, in einem atemberaubenden Tempo ihrem Ziel entgegen.
Teil 1 // Die große Orientierungslosigkeit
Viel zu jung
Verkürzte Schulzeiten und ihre Folgen
Auf dem Papier sehen viele Ideen erst einmal brillant aus. So mag der Gedanke, die Schulzeit in Deutschland um ein Jahr zu verkürzen, weil die Wirtschaft nach jüngeren, dynamischen Absolventen verlangte, vielleicht theoretisch richtig gewesen sein. Doch was passierte, als aus 13 plötzlich 12 Schuljahre wurden, überraschte auch die, die das Turbo-Abitur erfunden hatten: gestresste Kinder, gestresste Eltern. Nach zwei sowohl für die Jugendlichen als auch für ihre Familien erschöpfenden Jahren Oberstufe strömen 18-jährige, manchmal 17-jährige Abiturienten ins Leben. Sie haben zwar 500 Follower auf Instagram und Snapchat, dafür aber keinen Schimmer, wie sie selbstständig ein Zimmer in der Universitätsstadt mieten, ein Konto eröffnen oder einen Studienkredit aufnehmen können. Ein Rekord bei „World of Warcraft“ oder dauerhaftes Seriengucken bereitet nicht auf den Alltag vor. Theorie und Praxis, das zeigt sich hier ganz deutlich, klaffen meilenweit auseinander. Dafür kann diese Generation Papa bei seinen Marketingaktivitäten in Sachen Social Media tatkräftig unter die Arme greifen.
Nun ist jung nicht immer gleich jung. Der eine ist mit 18 Jahren so weit, auf eigenen Füßen zu stehen und sich selbst ein Auslandsstudium zu organisieren. Wer immer schon wusste, dass er Medizin studieren möchte, und die Schule mit einem Einser-Abi abschließt, hat auch kein Problem mit der Orientierung. Die 18-jährige Mona aus Berlin, die für ihr Leben gern backt und kunstvolle Torten herstellt, hat ebenfalls einen ganz klaren Plan vor Augen: Ausbildung zur Konditorin, Gesellenprüfung, Meisterschule, Ladeneröffnung.
Der Regelfall sieht heute jedoch ganz anders aus. Waren früher 18-Jährige schrittweise daran gereift, dass sie Verantwortung in der Familie übernehmen mussten, sind die meisten jungen Leute heute weitaus kindlicher als vor zwanzig Jahren. Sie wachsen behütet im Schatten ihrer Helikopter-Eltern auf. Während ihrer Kindheit räumen ihre Eltern, lebendigen Bulldozern gleich, alle Hürden und Unebenheiten aus dem Weg. „Eine Fünf in Mathe?“, schreit Mama hysterisch, als ihr Töchterchen Lilly, 15, die vermasselte Arbeit hinlegt. „Da gehe ich morgen in die Sprechstunde und beschwere mich. Das muss mindestens eine Vier-minus werden, sonst schalte ich den Anwalt ein.“ Lilly nickt. Sie kennt das schon von Englisch, das mit der Beschwerde hat letztes Jahr schon super geklappt. Pauls Vater macht das auch so.
Lillys Mathe-Note, Hockeytraining, Geburtstagsparty, Friseurtermin, Geschenk für Oma, Nachhilfe in Englisch, Dankeskarte für die Konfirmation: Mama und Papa haben alles im Blick. Mama meist mehr als Papa. Auch wenn sie arbeitet, scheint sie einer Drohne gleich das Tun ihrer Tochter 24 Stunden am Tag zu überwachen. Sie kontrolliert alles, weiß alles, fragt alles; fährt überall mit hin. „Ich habe dir einen neuen Termin beim Kieferorthopäden gemacht, Schatz. Soll ich dich nach der Schule hinfahren?“ Oder: „Oma hat Geburtstag, ich habe dir ein Geschenk für sie mitgebracht. Dieses Jahr schenkst du ihr eine Kinokarte.“
Ihre Eltern wissen immer, wo Lilly ist, können sie jederzeit am Handy erreichen oder per Ortungs-App all ihre Schritte nachvollziehen – selbst wenn Mama nicht versteht, wie das technisch funktioniert. Mama träumt von einer Software, mit der sie Lillys Smartphone aus der Ferne sperren kann, wenn die sie wegdrückt, was in letzter Zeit immer öfter vorkommt. Ihre amerikanische Freundin Wendy aus Orlando hat so etwas auf das Smartphone ihres Sohns gespielt. Seitdem geht der immer ran, wenn Mama-Drohne Wendy in seinem Display aufleuchtet.
Die Kinder werden beobachtet, überwacht und kontrolliert. Sie wissen nicht, wie es ist, ein paar Stunden unbehelligt von Erwachsenen ihr eigenes Leben zu leben. Unangenehme Telefonate müssen sie nicht selber führen, nicht selber mit anderen Menschen ihre Angelegenheiten verhandeln. Doch genau dieses Unbeobachtetsein, das Übernehmen von kleinen Häppchen an Verantwortung für das eigene Leben führt zur Reifung: die Busfahrkarte selber zu kaufen, die vergessene Winterjacke in der Musikschule abzuholen, sich selbstständig bei der Freundin zu entschuldigen, wenn man sie verletzt hat, ohne dass Mama die Mutter der Freundin anruft und alle Probleme abräumt. („Das hat sie nicht so gemeint.“) Mama und Papa agieren als Bulldozer, die ein Problem abräumen, bevor es entsteht.
Neulich besorgten mein Mann und ich Putzzeug für unsere Tochter, die vor einem Monat ausgezogen ist. In ihrem Hausstand fehlten noch Wäscheständer, Eimer, Spülmaschinensalz & Co. Schon planten wir, wann wir es ihr am besten in die neue Wohnung bringen könnten. Dann zögerten wir: Wir hatten das Starter-Equipment besorgt und bezahlt. Wäre es da nicht zumutbar, dass sie es zu Hause abholt? Die Erledigungsreflexe sitzen tief. Die Rundum-sorglos-Software müssen wir erst schrittweise löschen.
Dinge selbst richtig zu entscheiden ist ein klassischer Übungsprozess. Aus kleinen Entscheidungen werden immer größere. Zuerst entscheidet ein Kind – sagen wir, es ist sieben oder acht – nach der Schule beim Bäcker, ob es mit einem Euro ein paar seiner Lieblingslakritzen oder beispielsweise ein Franzbrötchen kaufen möchte. Für diesen Vorgang braucht es ein bisschen Zeit. Also denkt es beim Bäcker konzentriert nach, zum Beispiel so:
Kind steht vor dem Tresen und schaut gebannt auf die Theke.
Verkäuferin: „Was möchtest du denn heute?“
Kind denkt nach. Verkäuferin wartet.
Kind: „Nehme ich die Lakritze, eine Zimtschnecke oder ein Franzbrötchen, hmm …“
Verkäuferin guckt das Kind aufmunternd an.
Kind: „Eine Zimtschnecke, bitte.“
Verkäuferin: „Danke schön. Und 20 Cent zurück.“
Ende des Gesprächs.
Heute meint man, diese Situation habe sich vor gefühlt hundert Jahren zugetragen. Denn inzwischen werden viele Grundschulkinder mit einem strategisch „günstig“ vor der Schuleinfahrt geparkten Auto abgeholt und nach Hause chauffiert. Mama oder Papa gehen beim Bäcker sodann in Manndeckung. Das Drehbuch des Dialogs liest sich nun wie folgt:
Mama, kurz bevor sie drankommen: „Was möchtest du denn, Schatz?“
Kind zögert. Es denkt, es sei noch nicht dran: „Hmm.“
Mama: „Möchtest du eine Zimtschnecke, ein Franzbrötchen oder von den Lakritzen auf der Theke?“
Kind: „Franzbrötchen mag ich nicht.“
Mama: „Seit wann magst du keine Franzbrötchen? Letzte Woche hast du doch … Wir sind gleich dran. Schau mal, Schatz, die Frau zahlt jetzt gleich. Also, was möchtest du?“
Kind: „Ich meine heute. Heute mag ich kein Franzbrötchen.“
Mama guckt streng.
Kind resigniert: „Lieber eine Zimtschnecke.“
Mama im Erklärmodus: „Das ist doch toll. Die isst du gerne. Die hast du Montag doch auch genommen.“
Mama bestellt eine Zimtschnecke, ein Vollkornbrot und fünf Kürbiskernbrötchen.
Verkäufer: „Macht elf Euro achtzig, bitte.“
Mama zahlt.
Mama: „Möchtest du die Zimtschnecke auf die Hand oder ins Auto mitnehmen?“
Kind: „Hmm.“
Mama: „Die Zimtschnecke in eine kleine Tüte, bitte. Danke. Sag auf Wiedersehen.“
Kind: „Wiedersehen.“
Mama und Kind ab zum Auto. Mama drückt dem Kind aufmunternd und energisch die Papiertüte in die Hand: „Das ist deine, die kannst du selber tragen.“
Dies gibt eine erste Ahnung davon, warum 18-Jährige heute unreif sind. Variationen des Zimtschneckendialogs ziehen sich durch die gesamte Kindheit. Überall sind Erwachsene dabei. Die Kinder unternehmen, erleben und entscheiden fast nichts mehr selbstständig oder mit anderen Kindern. Ob man lieber Fußball spielen möchte oder Tennis, Gitarre oder Klavier, ob man sich mit Paul verabreden will oder mit Erik, immer sind Mama oder Papa involviert. Sie beraten, bequatschen, erklären, meinen und wollen.
Paul mögen sie lieber als Erik, weil sie Eriks Eltern, höflich formuliert, nicht so schätzen. Fußball findet Papa besser als Tennis, denn das hat er selber gern gespielt, sogar ziemlich erfolgreich als linker Verteidiger beim TuS Haste in Osnabrück. Bis er sich nach drei Verletzungen (wo gehobelt wird, da fallen Späne) das Sprunggelenk final ruiniert hat. Ihm stand gefühlt eine große Karriere bevor, von der er auch noch eine Zeit lang bei den alten Herren träumte. Bis es nicht mehr ging. Also muss jetzt sein Sohn ran Richtung Liga.
Das Kind möchte nicht in den Religionsunterricht, die Eltern finden Ethik aber ungünstig. Also doch katholische Religion. Das Kind möchte ab einem gewissen Alter nur noch Turnschuhe anziehen, doch Mama weiß es besser. „Nicht immer Sneaker, nimm doch mal die schicken Lederschuhe.“ Das gab es früher auch. Da hatten wir alle ein Paar „gute Halbschuhe“. Die waren alle gleich hässlich.
Wie soll ein Kind, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener lernen, Entscheidungen zu treffen, wenn immer zwei, die es gut meinen und (selbstverständlich) besser wissen, mit am Tisch sitzen? Kinder lernen nun mal aus Erfahrungen, und es gehört dazu, auch einmal falsche Entscheidungen zu treffen und daraus zu lernen.
Jonas, 13, hat keine Lust, mit auf das Reiterwochenende seiner Schwester Lisa, 12, zu fahren. Es heißt, sie übernachten in einem ehemaligen Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, das zu einer Jugendherberge ausgebaut wurde. Sechserzimmer mit Stockbetten, damit kann Jonas nichts anfangen. „Ich will lieber bei Oma bleiben.“ – „Na gut“, sagt seine Mutter, die keine Lust auf Theater hat. „Wenn Oma damit einverstanden ist.“ – „Ist sie, ich habe sie schon gefragt.“ Jonas bleibt zu Hause.
Als seine Eltern mit Lisa von dem Wochenende wiederkommen, erzählen sie begeistert von dem riesigen Schloss, der coolen Gruppe, dem Lagerfeuer, an dem sie Würstchen gegrillt haben, und der Kutschfahrt, die Eltern und Geschwister unternahmen, die den mehrstündigen Ausritt auf einem Pony nicht mitmachen wollten. Lisas, Mamas und Papas Augen leuchten noch wochenlang. Da hatte er leider etwas verpasst. Verdammt. Fehlentscheidung. Beim nächsten Trip wird sich Jonas gut überlegen, ob er leichtfertig absagt.
Es ist wie beim Skifahren. Wenn die Kinder ganz klein sind, nimmt man sie im Lift und bei der Abfahrt zwischen die Beine und hält sie fest. Doch ab dem Alter von rund vier Jahren lässt man sie selber fahren, und siehe da, sie können es. Sie fallen ganz sicher hin, sogar oft. Aber je öfter sie den Abhang hinunterjagen, desto besser lernen sie es. Je öfter sie fallen, desto eher registriert ihr motorisches System, warum sie fallen, und schon nach ein paar Abfahrten fahren sie plötzlich vollkommen sicher. Was passiert, wenn man sie immer nur zwischen den Beinen fahren lässt und festhält, kann sich wohl jeder lebhaft vorstellen: Die Kinder lernen es nicht, egal wie gut es Mama oder Papa meinen. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. So oder ähnlich ist es auch im Leben.
In der Schule läuft es so, wie die Gymnasiallehrerin Lena Heiliger aus Bonn erzählt. Früher hätte ein Kind eine Fünf oder eine Sechs bekommen, wenn es eine Arbeit versemmelt hatte. Heute beschwerten sich die Eltern über schlechte Noten und drohten mit dem Anwalt. Im Zweifelsfall würde geklagt. Das sei keine Ausnahme, sondern komme öfter vor. Diese Kinder würden nicht mehr lernen, für die Konsequenzen ihres Tuns geradezustehen. Sie lernten, wenn sie nicht genug für die Klausur arbeiten, kümmern sich Papa oder Mama darum. Nicht sie seien verantwortlich, sondern der Lehrer. Der hätte es ihnen besser erklären müssen.
Und plötzlich, mit 18 Jahren, sollen die behüteten Kleinen dann erwachsen sein; ihre berufliche Zukunft gestalten, ausziehen, eine Wohnung suchen, mit ihrem Geld auskommen, Krisen mit dem neuen Freund durchstehen, Freunde in einer neuen Stadt finden, ein Bankkonto für das Online-Banking eröffnen und einen Job finden. Sie sollen mit dem Mitbewohner fertigwerden, der in der WG keine Miete zahlt, mit ihren Gefühlen klarkommen, wenn der neue Freund sie betrügt.
Volljährig, aber nicht voll im Film
Volljährig ist man über Nacht. Aber die Konsequenzen zu verstehen, dauert viel länger. Wie reif jemand wirklich ist, hängt von seiner Biografie ab. Es gilt, im Einzelfall zu schauen, welche Verantwortung ein Jugendlicher mit 18 Jahren übernehmen kann, welche Kompetenzen er oder sie erworben und wie sich die Persönlichkeit entwickelt hat.
Dies haben Rechtsexperten schon lange erkannt. Das Jugendstrafrecht, das für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren gilt, können Jugendrichter auch über das siebzehnte Lebensjahr hinaus anwenden, nämlich auf „Heranwachsende“. So nennt das Recht 18- bis 20-Jährige. Zwar sind junge Menschen mit 18, 19 und 20 Jahren voll strafmündig. Der Richter entscheidet jedoch im Einzelfall, ob ein Heranwachsender in seiner geistigen und moralischen Entwicklung noch unreif ist. Zeichen von Unreife können dabei Leichtsinn, Nachahmungstrieb, planloses, impulsives, situationsbedingtes Handeln, Geltungsbedürfnis oder Unbekümmertheit sein. Typische Anzeichen von jugendlichem Handeln, die wir alle kennen.
Die Risikobereitschaft von Teenagern hat in der Evolution einen bestimmten Sinn, denn wer nicht risikobereit ist, wird seine angestammte, sichere Welt nicht verlassen, um das Unbekannte zu erkunden. Die hormonbedingte Unfähigkeit im Teenageralter, die Konsequenzen des eigenen Handelns abzusehen, hat System (siehe Teil II). Das Strafrecht fußt auf der Erkenntnis, dass nicht alle Heranwachsenden mit 18, 19 oder 20 Jahren voll schuldfähig sind.
Nicht nur im Strafrecht gibt es Überlegungen, eigene Regeln für Anfang 20-Jährige einzuführen. Im Frühjahr 2018 brandete eine Debatte über jugendliche Hartz-IV-Empfänger auf, die sich nicht pünktlich bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Dies macht etwa die Hälfte aller Versäumnisse aus. Bei jeglichen Versäumnissen folgt in der Regel eine Kürzung der Bezüge bis hin zur Streichung des Wohngelds. So sollten nach Ansicht von Andrea Nahles, SPD, die Strafen erst ab dem 25. Lebensjahr gelten. Sie will damit verhindern, dass junge Leute aus ihrer Wohnung fliegen, weil sie einen Termin verbummelt haben. In dem Fall seien sie noch schwerer in den Jobmarkt zu vermitteln.
Auch Wissenschaftler sind sich inzwischen einig: Erst mit circa Mitte zwanzig reifen bestimmte Hirnregionen, die für Handlungsplanung und strategisches Denken zuständig sind. Reifung braucht eben Zeit. Zeit für die Nervenzellen im Gehirn, um sich neu zu vernetzen und zu wachsen; Zeit für die Persönlichkeit, um sich zu entwickeln; Zeit für die Jugendlichen, Erfahrungen zu sammeln – Zeit mit Erwachsenen, aber vor allem ohne sie.
Unerwachsene Erwachsene
Eine wichtige Veränderung in der Gesellschaft, die sich massiv auf das Verständnis der heute 18-Jährigen auswirkt, ist die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern. Aus einem autoritären Verhältnis ist ein großenteils freundschaftliches geworden. Mama shoppt die gleichen UGGS wie ihre Tochter, der 20-jährige Sohn geht mit Papa am Wochenende zum Konzert. Der macht seit neuestem auf Daddy Cool mit Hoodie und hängenden Teenie-Hosen, begrüßt seinen Spross mit einem lässigen „Was geht?“ und benimmt sich wie der beste Kumpel seines Sohns. Gefühlt ist er damit im Multimillionen-Kapuzenpulli-Business tätig, dabei hat er gerade mal sein Reihenhaus zur Hälfte abbezahlt. Unerwachsene Erwachsene sind jedoch kein Vorbild.
Was früher undenkbar war, ist heute selbstverständlich. Der Freund der Tochter, die Freundin des Sohns darf über Nacht bleiben. Um seine Beziehung zu leben, muss kaum ein Jugendlicher mehr in eine eigene Wohnung ziehen.
Gleichzeitig haben sich die Schritte ins Erwachsenenleben aufgeweicht und teilweise bis in das vierte Lebensjahrzehnt verschoben. Biografien folgen nicht mehr dem Schema F: Ausziehen, Ausbildung oder Studium, Beruf, Heirat, Kinder, Hauskauf. Das streben viele nicht mehr an, und wenn, dann erst irgendwann. Später. 40 Prozent aller Akademikerinnen sind kinderlos. Die anderen 60 Prozent sind aufgrund ihrer Doppelbelastung viele Jahre ziemlich erschöpft. Diesen stressigen Alltag lehnen die jungen Menschen heute ab. Sie fordern eine Work-Life-Balance ein, die es ihnen ermöglicht, Zeit für eine Familie und sich selbst zu haben. Insofern haben Heranwachsende recht damit, es langsam angehen zu lassen. Dass sie so früh mit der Schule fertig und ins Leben gespült werden, läuft konträr zur sonstigen Entwicklung in der Gesellschaft.
Bis zum Jahr 2011 mussten sich zumindest die Jungen keine Gedanken um ihre unmittelbare Zukunft nach dem Schulabschluss machen. Nur eine Entscheidung stand an: Bund oder Zivildienst. Unvergessen die Zeit, als mein jüngerer Bruder zum Bund ging. Er wunderte sich über das frühe Aufstehen, den Drill, darüber, dass die T-Shirts im Spind alle auf Kante liegen mussten. Wir Schwestern staunten, dass ausgerechnet er, der zu Hause beim Bügeln nicht mithelfen musste, da in sein Ressort die Gartenarbeit fiel, nun Wäsche falten lernte. Er kämpfte mit der Einsamkeit an Wochenenden, wenn er im Bayerischen auf einem Lehrgang war. Er musste damit zurechtkommen, dass er mit den wenigsten Männern etwas anfangen konnte, weil ihr einziges Hobby darin zu bestehen schien, sich erst ordentlich volllaufen zu lassen und dann alles wieder auszukotzen. Dazu gelallte Trinksprüche. Er litt unter Schlafentzug, wenn mal wieder eine Nacht bei einer Übung im Kalten durchgefroren werden sollte. Ich beneidete ihn nicht, denn es war eine harte Zeit. Dennoch brachte sie genau das, was heute vielen 18-Jährigen fehlt: Selbstständigkeit, Lebenserfahrung und Reife.
Ein Freund verweigerte den Wehrdienst und leistete Zivildienst in einer Jugendherberge. Er schmiss die Rezeption, kümmerte sich um die Schülergruppen, teilte Partyräume ein, putzte Toiletten und kochte literweise faden Hagebuttentee. Keine kalten Nächte, keine auf Kante gelegten T-Shirts. Keine kotzenden Kameraden. Sowohl mein Bruder als auch der Freund hatten Zeit, verschiedene Erfahrungen aus einer völlig neuen Perspektive zu sammeln. Richtig viel Zeit, zu überlegen und mit Gleichaltrigen auszuloten, was sie später einmal machen wollten.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 schaffte der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg den Wehrdienst und damit auch den verpflichtenden Zivildienst ab. Das war’s dann mit den netten Zivis im Krankenhaus und im Seniorenheim. Weder vom Minister noch von anderen Politikern gab es ein alternatives Konzept, was die jungen Männer stattdessen machen könnten. Verpflichtender Wehr- und Zivildienst waren Geschichte.
Ersetzt wurde der Zivildienst durch den Bundesfreiwilligendienst, früher das „soziale Jahr“ genannt – ein freiwilliges Jahr, in dem Mädchen wie Jungen im sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen oder ökologischen Bereich Erfahrungen sammeln können. Doch das Jahr ist Kür, nicht Pflicht. Manch eine Familie wünscht sich nun, ihr Sohn würde ein paar Monate Betten im Krankenhaus sterilisieren, statt zu Hause rumzuhängen.
Die frühen Schulabschlüsse bringen aber noch eine andere Besonderheit mit sich. Die Universitäten haben nun mit Minderjährigen zu tun, die sich immatrikulieren. An bestimmten Unis werden diese auch bevorzugt genommen, zum Beispiel in Berlin. Deswegen bieten die Unis nun Einführungsveranstaltungen für Eltern an, die ja rechtlich noch verantwortlich für ihre minderjährigen Kinder sind. Indirekt geht damit die Beschattung von Mama und Papa weiter. Statt „Wir machen ein Referat“, heißt es nun: „Wir gehen zur Ersti-Veranstaltung.“ Fehlt nur noch, dass sie beim „Beer Pong“ mitmischen, einem Trinkspiel, mit dem die Erstis in ihrer ersten Woche feuchtfröhlich ins Uni-Leben eingeführt werden. Mama fühlt sich wieder jung und kramt die Fotos von ihren Studienjahren in Heidelberg raus. Sechs Jahre hat sie studiert, zwei davon im Ausland. 25 Jahre alt war sie beim Abschluss ihres Diploms. Café Sieben mit den Mitstudenten, Sommerball in der Stadthalle, vorher Umtrunk mit zwanzig Mann in ihrer winzigen Wohn- und Duschküche – ein eigenes Bad gab es nicht. Unbeschwertheit. Freiheit. Leichtigkeit. Von ihren Eltern war weit und breit keine Spur.






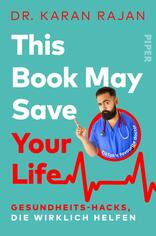

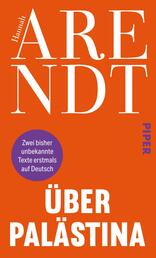

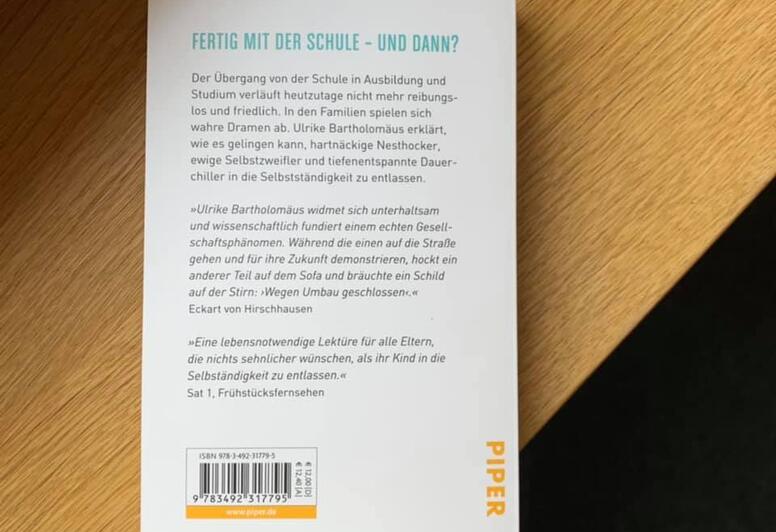



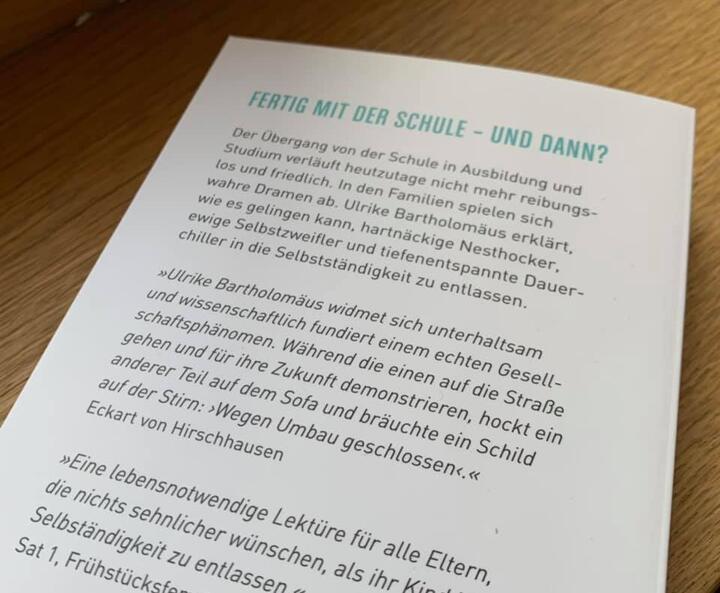





Rein zufällig sah ich das Buch bei meiner Schwester liegen, als ich während ihrem Urlaub die Blumenpflege übernommen hatte. Während sich die Pflanzen voll Wasser sogen, sog ich die ersten Worte des Romans auf. Ein wunderbares Buch, das ich mir inzwischen besorgt habe und das einfach auch Lust auf Rom macht. Doch wird man Massimo dort finden...
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.