
Vier Freundinnen, ein Boot - eBook-Ausgabe
5500 Kilometer im Ruderboot über den Atlantik
„Spannend und berührend.“ - Tina
Vier Freundinnen, ein Boot — Inhalt
Von den Kanaren bis in die Karibik. An einem weinseligen Abend fassen Frances, Helen, Janette und Niki einen verwegenen Plan: Obwohl keine von ihnen je auf offener See gerudert ist, melden sich die Frauen für die „Talisker Whisky Atlantic Challenge“ an. Und im Dezember 2015 lassen sie vier Ehemänner, acht Kinder, fünf Hunde, zwei Katzen, zwei Schlangen und eine Wüstenrennmaus an Land zurück. Für die nächsten 67 Tage wird die Rose ihr zu Hause sein, auf der sie den Ausläufern eines Hurrikans, einem gebrochenen Steißbein und einer kaputten Trinkwasserpumpe trotzen müssen. Mit ansteckendem Humor berichten sie, wie ihnen nach Jahren der Aufopferung für Familie und Beruf noch einmal der Ausbruch gelingt und wie sie sich als ältestes weibliches Team inmitten der Profis schlagen. Ein Loblied auf die Freundschaft und ein Beweis, dass man mit Frauen ab 45 immer noch rechnen muss.
Leseprobe zu „Vier Freundinnen, ein Boot“
Kapitel 1
La Gomera
Du kannst den Ozean nicht überqueren,
wenn du nicht den Mut hast,
die Küste hinter dir zu lassen.
Christoph Kolumbus
30. November 2015, Marina La Gomera, San Sebastián, La Gomera
„Das“, sagte Frances und schüttelte langsam den Kopf, während sie auf die Wellen starrte, die unter uns an die Kaimauer krachten, „ist kein Seegang für Einsteiger.“
Wir – Janette, Helen und Niki –, die neben ihr auf das stürmische Meer vor der Marina in San Sebastián hinaussahen, konnten ihr nur zustimmen. Die Wellen türmten sich haushoch, und die Strecke, die wir [...]
Kapitel 1
La Gomera
Du kannst den Ozean nicht überqueren,
wenn du nicht den Mut hast,
die Küste hinter dir zu lassen.
Christoph Kolumbus
30. November 2015, Marina La Gomera, San Sebastián, La Gomera
„Das“, sagte Frances und schüttelte langsam den Kopf, während sie auf die Wellen starrte, die unter uns an die Kaimauer krachten, „ist kein Seegang für Einsteiger.“
Wir – Janette, Helen und Niki –, die neben ihr auf das stürmische Meer vor der Marina in San Sebastián hinaussahen, konnten ihr nur zustimmen. Die Wellen türmten sich haushoch, und die Strecke, die wir rudern wollten, war beträchtlich. Wer um alles in der Welt war auf diese Schnapsidee gekommen? Gemeinsam würden wir vier Ehemänner, acht Kinder, fünf Hunde, zwei Katzen, zwei Schlangen und eine Rennmaus zurücklassen, um dreitausend Meilen, etwa fünftausendfünfhundert Kilometer, über eines der gefährlichsten Meere der Welt zu rudern. Angeblich haben es mehr Menschen geschafft, ins All zu reisen oder den Mount Everest zu besteigen, als den Atlantik in einem Ruderboot zu überqueren. Und keiner von denen war eine berufstätige Mutter mittleren Alters aus Yorkshire, jenseits der vierzig (oder fünfzig), die kaum – beziehungsweise keinerlei – sportliche Leistungen vorweisen konnte.
Tatsächlich befand sich unter uns vier Frauen nicht eine Olympionikin, Extremsportlerin oder Ausdauerfanatikerin. Keine von uns war zum Pol marschiert, hatte an felsiger Bergflanke biwakiert oder in einer Höhle überlebt, in der es nichts als Regenwasser zu trinken gab und allenfalls ein kleines Nagetier zur Gesellschaft vorbeikam. Allerdings waren wir auch keine völlig untrainierten Fitnessmuffel. Frances war den Küstenmarathon von Nairn nach Glen Coe gelaufen, und Janette hatte einmal an einem Fünf-Kilometer-Volkslauf durch den Park von Castle Howard teilgenommen. Wir waren vier ganz normale Mütter, die sich bei den täglichen Autofahrten zur Schule ihrer Kinder kennengelernt und beschlossen hatten, einen Ozean im Ruderboot zu überqueren.
Als wir jetzt hier standen, erschien uns der Entschluss, uns zu einem der härtesten Ruderrennen der Welt, der Talisker Whisky Atlantic Challenge, anzumelden, wie heller Wahnsinn. Nachdem wir uns nach einigen Gläsern Pinot zu viel an einem kalten Winterabend im Januar 2013 dazu entschieden hatten, hatten wir beinahe drei Jahre lang geschuftet, um diesen Tag zu erreichen, und uns dabei stets versichert, dies sei die Aufgabe, die uns am meisten abverlangen würde, das Schwerste am ganzen Rennen: es überhaupt bis zum Start auf den Kanarischen Inseln zu schaffen. Und wir hatten es geschafft. Wir hatten den schwierigen Teil absolviert. Wir hatten das nötige Geld zusammenbekommen, genug Sponsoren gewonnen und genug Leute davon überzeugt, dass wir ernst zu nehmen waren und ihrer Unterstützung würdig. Aber jetzt sahen wir uns dieser brodelnden Masse von Strömungen und Strudeln gegenüber, die von orkanartigen Winden zu Wellen mit bis zu zwanzig Meter Höhe aufgepeitscht wurde, ganz zu schweigen von den gigantischen Tankern, die unser kleines Ruderboot jederzeit unter sich begraben konnten. Und natürlich kamen wir nicht umhin, an die Haie, Wale und Speerfische zu denken, von denen man wusste, dass sie mitten in der Nacht Bootsrümpfe durchbohren konnten, an die sengende Sonne, den peitschenden Regen, die Verletzungen und den mörderischen Muskelkater, die Erschöpfung und das endlose, endlose Rudern. Wir wollten einen Zwei-Stunden-Takt einhalten – essen, schlafen, rudern und wieder von vorn – und würden das unserer Schätzung nach mindestens fünfzig Tage, vielleicht auch eine Spur länger durchziehen müssen. Unbedingt würden wir da die Notflasche Mango-Gin brauchen, die wir im Boot zu bunkern gedachten.
„Wird schon klappen“, sagte Helen mit einem mühsamen Lachen und einem übertriebenen Schulterzucken in genau dem Moment, als wieder eine Riesenwelle gegen die Felsen unter uns krachte. „Wir wissen, dass wir es nach Antigua schaffen werden.“
„Wir müssen nur alle positiv denken“, sagte Niki.
„Unser Team ist so stark wie jedes seiner Mitglieder. Jedes Mitglied ist so stark wie unser Team“, zitierte Janette aus unseren „Grundregeln an Bord“, die sie uns viele Meilen entfernt, in Yorkshire, zur Lektüre und Zustimmung vorgelegt hatte.
In Wahrheit wussten wir alle, es war leicht möglich, dass wir es nicht auf die andere Seite schafften. Aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, sich im Negativen zu verlieren. Das hier würde uns alle verändern. Wir hatten uns nicht auf dieses Abenteuer eingelassen, um dem Leben den Rücken zu kehren, sondern um es am Schopf zu packen. Und jetzt war es so weit. Die Sonne brannte herab, Salzluft stieg uns in die Nasen; Helen brach schließlich das Schweigen. „Und dass mir keine weint“, sagte sie energisch.
Wir waren am letzten Novembertag 2015 in La Gomera angekommen, zwei Wochen vor dem Start der Talisker Whisky Atlantic Challenge. Zu viert wollten wir von unserem Ausgangspunkt auf den Kanarischen Inseln nach Antigua rudern, einer Insel der Kleinen Antillen. Man hatte uns gesagt, die Vorbereitung sei das Wichtigste am ganzen Rennen, deshalb hatten wir dafür gesorgt, dass wir frühzeitig genug auf den Kanaren eintrafen, um alles Nötige erledigen und organisieren zu können. Außerdem wollten wir sicher sein, dass die wenigen Geschäfte auf der kleinen vulkanischen Insel bei unserer Ankunft nicht schon geplündert waren, sondern noch vorrätig hatten, was wir an Proviant brauchten.
BBC Breakfast wollte unsere Abreise aus England filmen, den Abschied am Flughafen von Manchester von allen, die uns gefördert hatten: Freunde (massenhaft Freunde), Familie (massenhaft Familie) und Unterstützer. Sechsundzwanzig Teams peilten in diesem Jahr die Atlantiküberquerung im Rahmen der Talisker Atlantic Challenge an, und ausgerechnet über uns – die Yorkshire Rows – wollte die BBC berichten. Wir waren natürlich Feuer und Flamme, da wir möglichst viel Aufmerksamkeit und Geld für die Wohltätigkeitsorganisationen herausschlagen wollten, die wir unterstützen: Maggie’s Cancer Caring Trust und Yorkshire Air Ambulance.
Die Fernsehkameras surrten, während wir mit unserem Verabschiedungskomitee am Flugsteig nach Teneriffa neben unzähligen Koffern standen, die bis obenhin voll waren mit zahlreichen Beuteln Brasilnüssen, Schlechtwetterausrüstung, einer Wasserpumpe und Spezialunterhosen, die angeblich nicht scheuerten. Wir konnten nur hoffen, dass man uns kein Übergewicht berechnen würde. Plötzlich kam der ehemalige Olympiasieger im Rudern, James Cracknell, auf uns zu, ein gut gebauter Prachtkerl, der einige Jahre zuvor gemeinsam mit dem Fernsehmoderator Ben Fogle bei diesem härtesten Ozeanrennen der Welt den zweiten Platz belegt hatte.
Die BBC hatte uns diese Sportskanone als Überraschungsgast geschickt, damit er uns zum Abschied ein paar Weisheiten mit auf den Weg gab. Unglücklicherweise hatte uns niemand etwas davon gesagt. Mitten im Abschiedsgetümmel versuchte Janette, ihn zu verscheuchen.
„Pscht“, warnte sie mit erhobenem Zeigefinger. „Hier wird gerade gefilmt.“
„Aber -“, begann James verdutzt.
„Sehen Sie denn die Kameras nicht?“
Janette hielt den gut aussehenden Ruderer, den sie nicht erkannte, für einen Konkurrenten.
„Sie sind mitten in die Aufnahmen hineingeplatzt.“ Sie blinzelte ins Licht. „Könnten Sie einfach still sein, bis wir hier fertig sind.“
„Ich wollte nur -“, versuchte es der knackige Cracknell noch einmal, woraufhin sie ihm mit einem neuerlichen „Pscht“ das Wort abschnitt.
Erst nachdem man ihr den vermeintlichen Störenfried vorgestellt und sie sich mit rotem Kopf tausendmal entschuldigt hatte, konnte James endlich vor die Kamera treten und seine Schlussworte loswerden, die da lauteten, dass wir uns unterwegs einen Tag hassen und den nächsten lieben würden, bis der Ozean schließlich überquert war. Er prophezeite uns Blasen an Körperstellen, an denen wir sie nie für möglich gehalten hätten, und fügte hinzu, er sei überzeugt, dass wir durchhalten würden, da ja jede von uns schon eine weit härtere Prüfung bestanden hatte: Schwangerschaft und Geburt.
Beschwingt von diesen letzten ermutigenden Worten traten wir den Flug an – unsere Spezialunterhosen ohne Zusatzkosten wohlbehalten in der Maschine.
Auf unserem langen Weg zu den Kanaren hatten wir nicht nur große Unterstützung von unseren Familien erhalten, sondern immer wieder auch von vielen anderen unglaublich großzügigen Menschen. Einer von ihnen war der 88-jährige Ron, ein Fuhrunternehmer aus Halifax in Yorkshire, der auf Teneriffa eine Wohnung besaß. Er hatte in der Yorkshire Post von uns gelesen und bot uns über unsere Spendenwebseite seine Dienste als persönlicher Betreuer an. Da wir ihn nie kennengelernt hatten, wussten wir natürlich nicht, was uns erwartete, als der freundliche kleine ältere Herr uns am Flughafen in Empfang nahm. Nicht nur gelang es ihm, unser umfangreiches und schweres Gepäck in seinem Wagen zu verstauen, er lud uns auch zum Mittagessen in Santa Cruz ein, bevor er uns an der Fähre absetzte, die uns nach La Gomera bringen sollte.
Keine Stunde später empfing uns der geschäftige Jachthafen von San Sebastián. Wir meldeten uns bei der Rennzentrale an und erhielten unsere Zugangsausweise für den Hafen. Sobald wir die große Sicherheitsschleuse am Eingang passiert hatten, brach der Lärm über uns herein: Stimmengewirr von allen Seiten, Rufe, Lachen, die durchdringenden Geräusche von Sägen, Schneidbrennern und Hämmern. Überall wurde gearbeitet.
„Flattern außer mir noch jemandem die Nerven?“, fragte Niki.
„Ich kann’s nicht fassen, dass wir tatsächlich hier sind“, sagte Helen.
„Und ich kann’s nicht fassen, dass wir so weit gekommen sind“, fügte Janette hinzu.
„Endlich“, sagte Frances lächelnd.
Auf dem Kai wimmelte es von Ruderern, die Boote lagen dicht an dicht. Die Mannschaften kamen aus der ganzen Welt: Zweierteams, Soloruderer und Viererteams wie wir. Insgesamt waren es sechsundzwanzig Mannschaften, die in Vorbereitung auf das Rennen die Anleger hinauf und hinunter liefen. Berge von Ausrüstungsgegenständen, Taue, Eimer, Taschen voller Krimskrams, Wasserpumpen, Treibanker, Funkgeräte, Leuchtgeschosse und Notfallkoffer warteten auf den Holzplanken in mehr oder weniger geordnetem Chaos auf die Inspektion durch die Rennleitung, von der jedes einzelne Ding ebenso akribisch unter die Lupe genommen werden würde wie die Fertigkeit der Wettbewerbsteilnehmer im Umgang damit. Die Inspektion ist nicht nur eine Bestandsaufnahme, es ist auch eine Prüfung, ob das Boot und seine Insassen wirklich seetüchtig sind. Wer bei dieser Prüfung durchfällt, wird für das Rennen gesperrt.
Irgendwo in diesem ganzen Durcheinander wartete die Rose – unser schönes hochseetaugliches Rennruderboot –, acht Meter lang und anderthalb Meter breit, strahlend weiß. Das Boot war die Fünfte im Bunde. Wir hatten solche Sehnsucht nach ihr, dass wir uns kurzerhand durch das Getümmel drängten und nach ihr suchten. Sie fehlte uns, seit sie vor zwei Monaten auf ein Frachtschiff Richtung Süden verladen worden war.
Endlich entdeckten wir sie, blendend weiß und schnittig, mit einer neuen Glidecoat-Beschichtung versehen, damit sie möglichst ungebremst durch das Wasser des Atlantiks schnellen würde. Sie lag neben dem knallgrünen Boot der einzigen anderen reinen Frauenmannschaft – Row Like a Girl. Wir kletterten sofort hinein und untersuchten sie wie besorgte Eltern von vorn bis hinten nach Stoß- oder Schlagverletzungen, die sie sich auf der Reise zugezogen haben könnte. Zum Glück fehlte ihr nichts, ja, im Vergleich zu vielen anderen Booten im Hafen sah sie fantastisch aus.
„Ich will ja nicht gemein sein“, flüsterte Helen, deren Blick die Reihe der Boote hinauf und hinunter wanderte, „aber mit der Rose kann’s keines der anderen Boote aufnehmen.“
„Da ist was dran“, bestätigte Niki, die auch an Deck war. „Die Rose ist eines der moderneren Boote hier.“
Was die Boote voneinander unterschied, waren nicht nur Größe und Alter, sondern auch die kleinen Extras, mit denen die verschiedenen Mannschaften sie ausgestattet hatten. Während wir die Anleger entlangspazierten und uns mit den anderen Mannschaften bekannt machten, stellten wir fest, dass viele von ihnen ihre Boote aufgepeppt hatten.
„Die Antiguaner haben ein kleines Kochgerät“, sagte Janette. „Sie haben einen der Rollsitze rausgenommen und es dazwischen installiert.“
„Und Angeln haben sie auch“, ergänzte Niki. „Anscheinend wollen sie sich bis drüben mit Fischen durchschlagen.“
„Mit Fischen?“, fragte Helen.
„Sie kommen an, wann immer sie ankommen – haben sie jedenfalls gesagt“, erklärte Niki total perplex.
„Das Beyond-Team hat ganze Kanister voll Olivenöl zum Trinken geladen“, bemerkte Frances.
„Kriegt man davon nicht Durchfall?“, fragte Helen.
„Und die von der Ocean Reunion haben massenhaft Erdnussbutter mit.“
Während wir von Boot zu Boot gingen und uns umhörten, kamen uns allmählich ernste Zweifel an der Art unserer Vorbereitung. Brauchten wir ein kleines Kochgerät? Sollten wir unterwegs angeln? Erdnussbutter essen und mit Olivenöl nachspülen? Was hatten wir hier zu suchen? Wir gehörten nicht hierher, in diese Gruppe von Extremsportlern. Wir waren vier brave Mamas aus Yorkshire, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten.
„Es reicht!“, sagte Frances energisch. „Wir haben unsere Entscheidung getroffen, und jetzt sind wir hier. Packen wir’s an.“
Wegen der außergewöhnlichen Ansammlung von Ruderern, Helfern und Organisatoren waren auf der kleinen Insel die Übernachtungsmöglichkeiten knapp. Zum Glück waren Janette und ihr Mann Ben im Jahr zuvor schon einmal als Spähtrupp vorausgefahren und hatten diverse Restaurants ausprobiert und sogar ein paar Kneipen aufgespürt. Mehr noch, sie hatten ein feudales Fünfsternehotel hoch oben am Berg aufgetan, das sie als Quartier geeignet fanden. Frances hatte jedoch andere Vorstellungen gehabt und uns schließlich in einer weniger vornehmen, dafür aber weit praktischeren kleinen Wohnung untergebracht, in der wir hausen konnten, bis unsere Familien eintrafen, um uns mit ihren guten Wünschen ins Rennen zu schicken.
Ein Immobilienmakler hätte die Wohnung im ersten Stock vermutlich als „originell“ angepriesen. Helen sprach euphemistisch von „spanischem Charme“, aber sie hatte sich ja auch das beste Schlafzimmer gesichert – oder vielleicht sollte man sagen, das einzige Schlafzimmer. Es lag, mit einem Doppelbett und einem großen Kleiderschrank ausgestattet, gleich neben dem Badezimmer. Janette landete auf der Bettcouch im Wohnzimmer, Frances und Niki mussten in der „Mansarde“ nächtigen – einem Zwischengeschoss, das den Elementen ungeschützt preisgegeben war. Sie mussten in Eimer pinkeln (sehr zum Amüsement der Nachbarn), da ein Abstieg über die wacklige Leiter mitten in der Nacht erhebliche Verletzungsgefahr mit sich gebracht hätte. Und Verletzungen konnten wir uns nicht leisten. Gerade jetzt nicht, da wir nach all der Plackerei dem eigentlichen Rennen so nahe waren.
An unserem ersten Abend hielten wir eine Besprechung ab, um zu entscheiden, was wir an Ausrüstung mitnehmen wollten. Je mehr, desto größer die Last im Boot und desto mühsamer das Vorankommen. Es lag in unserem eigenen Interesse, uns auf ein Minimum zu beschränken. Einige wesentliche Dinge wie das Ersatzruder und der handbetriebene Seewasseraufbereiter mussten mit; Helens Haarglätter und die Familienpackung Glitzerduschgel hingegen würden im Koffer ihres Mannes wieder nach Hause reisen müssen. Sie waren allenfalls auf La Gomera unverzichtbar. Wie auch, so schien es, unsere Spezialunterhosen.
„Wir brauchen im Grund jeder nur zwei“, erklärte Janette.
„Zwei?“, fragte Niki.
Janette nickte. „Irgendwo müssen wir anfangen, warum nicht mit den Unterhosen. Wir werden sie sowieso nicht alle tragen.“
„Warum nur zwei?“, fragte Helen.
„Wegen des Gewichts.“
„Unterhosen wiegen kaum was.“
„Ich weiß, aber mit all dem anderen Zeug, das ihr mitnehmen wollt, ist das Boot am Ende so schwer, dass wir’s nicht mehr rudern können.“
„Es gibt weiß Gott größere und schwerere Sachen, über die wir uns unterhalten sollten. Zum Beispiel über die ›kleinen Zwischenmahlzeiten‹.“
Niki zuckte zusammen. Im Lauf der langen Vorbereitung auf das Rennen waren jeder von uns irgendwann bestimmte Rollen oder Aufgaben zugeteilt worden. Niki war für die abgepackten Zwischenmahlzeiten zuständig. Das war eine der vielen Aufgaben, für die sie bestens geeignet war. Sie isst gern, auch wenn sie schlank ist wie eine Tanne, und wenn sie gerade nicht isst, denkt sie häufig darüber nach, was ihr als Nächstes schmecken könnte. Ganz logisch also, dass ihr die Verantwortung für die Ernährung übertragen wurde.
Ausreichende Energiezufuhr ist bei einem so anstrengenden Mammutrennen selbstverständlich lebenswichtig, und Niki hatte sich ihrer Mission mit der Gründlichkeit gewidmet, mit der sie auch alles andere im Leben angeht. Die Rennregeln schrieben Bordvorräte von sechzig Tagesrationen pro Person vor, und wenn wir davon ausgingen, dass jede von uns tausend bis sechstausend Kalorien am Tag verbrannte, brauchten wir natürlich regelmäßig energiereiche Mahlzeiten und reichlich kleine Imbisse zwischendurch. Da uns nach allgemeiner Aussage die hochkalorische Kost bald derart anöden würde, dass uns alle Lust zu essen verginge, waren die Zwischenmahlzeiten mehr als reiner Gaumenkitzel: Sie würden uns in einer besonders langen Nacht draußen auf See oder in einem Moment der Niedergeschlagenheit und Verzweiflung bei Kräften und so letztendlich am Leben halten. Niki hatte alle Eventualitäten und Szenarien recherchiert. Sie war durchgegangen, was wir mitnehmen sollten und was sich unter den Einwirkungen von Hitze, Salz und Feuchtigkeit am besten halten würde. Sie hatte sich nach unseren Lieblingsspeisen erkundigt und gefragt, was wir bei einem Sturm von Stärke 8 unserer Meinung nach noch hinunterbringen würden. Leider hatte sich keine von uns wirklich mit den Fragen beschäftigt, die Niki uns per E-Mail zugesandt hatte.
„Wir haben keine besonderen Wünsche“, hatten wir höflich erklärt. „Entscheide du.“ Eine Haltung, die wir noch bereuen sollten.
Janettes gnadenlose Ausmusterung der Unterhosen führte fast zur Meuterei und schließlich zu dem Plan, eine Tasche voll Unterhosen aufs Boot zu schmuggeln. Aus diesen ersten Tagen, in denen wir an unserem Boot herumbastelten, den Rumpf der Rose mit Aufklebern bepflasterten, auf denen die Namen unserer Sponsoren zu lesen waren, und immer wieder unsere Liste der Dinge durchkauten, die unbedingt mit aufs Boot mussten, würde uns am lebhaftesten die absolute „Geht nicht gibt’s nicht“-Einstellung der anderen Teilnehmer in Erinnerung bleiben. Damals lebten wir wirklich noch in einer anderen Welt.
Die Rose lag direkt neben der Row Like a Girl. Es war das Boot einer tollen Truppe bildschöner Frauen, die – es muss gesagt werden – dem Alter nach unsere Töchter hätten sein können. Sie waren blitzgescheit, kompetent und verfügten über jahrelange Erfahrung in allen möglichen Abenteuersportarten.
„Nicht mal, wenn ich zehn Kilo abnähme, würde ich so aussehen“, sagte Janette, die die jungen Frauen dabei beobachtete, wie sie sich gegenseitig eincremten, was die anerkennenden Pfiffe einiger anderer Crews zur Folge hatte. „Ich glaub nicht, dass die auf uns auch so reagieren würden.“
„Bestimmt nicht“, sagte Frances. „Im Gegenteil.“
In diesen ersten Tagen rannten wir hauptsächlich im Ort herum und suchten einen Schiffsausrüster, bei dem wir Taue und Sitzbezüge kaufen konnten, oder wir fachsimpelten mit den jungen Frauen vom Nachbarboot – Olivia, Gee, Bella und Lauren.
„Yogamatten sind die beste Polsterung“, rief Lauren hilfsbereit herüber.
„Echt?“, fragte Helen.
„Sie sind schön weich – angenehm für den Hintern“, fügte Lauren hinzu.
Während wir unsere Boote auf Vordermann brachten, erfuhren wir, dass Lauren schon vor zwei Jahren zusammen mit ihrer Freundin Hannah Lawton einen Anlauf genommen hatte, den Atlantik zu überqueren, der Versuch jedoch gescheitert war. Nach einer Fahrt unter den widrigsten Bedingungen in der Geschichte des Rennens waren sie schließlich gekentert und mit ihrem Boot, über das sie keinerlei Kontrolle mehr hatten, vierzig Tage im Ozean getrieben. Erst nach insgesamt sechsundneunzig Tagen auf See wurde Lauren mit ihrer Freundin von einem kanadischen Frachtschiff gerettet und kehrte nach England zurück. Dass sie es nun noch einmal wagen wollte, sozusagen um die Dämonen auszutreiben, war schier unglaublich. Ihre Geschichte holte uns aus unserem draufgängerischem Überschwang auf den Boden der Tatsachen zurück und veranlasste uns, in aller Stille darüber nachzudenken, worauf genau wir uns hier einließen. Was fiel uns ein, acht Kinder zwischen neun und achtzehn Jahren in Yorkshire zurückzulassen? War das Egoismus? Wahnsinn? Können Frauen eines gewissen Alters, die einen Beruf und familiäre Pflichten haben, so einfach auf und davon laufen, um etwas zu erleben? Dürfen wir das? Was bildeten wir uns eigentlich ein?
Erstaunlicherweise stellte uns hier niemand diese Fragen. Niemand fragte je, was uns einfiel. Niemand zog unsere Motive in Zweifel. Man akzeptierte uns so, wie wir waren. Und natürlich dachten wir manchmal angesichts dieser außergewöhnlichen Leute mit ihrer unerschütterlich positiven Einstellung, die uns nur Mut machten, statt ihn uns zu nehmen, dass es mehr solche Menschen auf der Welt geben sollte. Es gibt einer Frau ein selten empfundenes Gefühl der Stärke, nicht bewertet zu werden.
Allerdings, von der Crew mit dem zuversichtlichen Namen Row2Recovery – vier ehemalige Soldaten, Cayle, Lee, Paddy und Nigel, alle entweder einseitig oder beidseitig beinamputiert – mussten wir einmal Blicke einstecken, als wären wir nicht ganz bei Sinnen. Zu ihrer Entschuldigung muss gesagt werden, dass wir da gerade beim Bootputzen mit voller Lautstärke die erhebende Hymne „Let It Go“ aus Disneys „Die Eiskönigin“, einem Lieblingsfilm unserer Kinder, abspielten. Sie hielten sich stöhnend die Ohren zu und baten uns, die Musik abzustellen, und in genau diesem Moment kam Greg Maud vorbei, ein Soloruderer, der Everest und Kilimandscharo bezwungen und den Marathon des Sables vollendet hatte, und stimmte lauthals in den Refrain ein.
„Let it go-o-o! Go-o-o!“ Er hielt inne. „Was soll ich sagen?“, wandte er sich an das entsetzte Row2Recovery-Team. „Ich hab eine Tochter.“
Mit jedem Tag, den das Rennen näher rückte, wurde die Atmosphäre im Ort ein wenig fiebriger. Und proportional zur Spannung wuchs die Anzahl der Gins, die im Blue Marlin gekippt wurden.
Das Blue Marlin, eine in einer Seitenstraße gelegene kleine Kneipe, deren Wände die letzten Worte einstiger Abenteurer zierten, war der inoffizielle Regattatreff, in dem sich nach einem langen, harten Tag des Packens und Umpackens die Ruderer und ihre Helfer zusammensetzten. Alles kreiste hier ums Hochseerudern und den Atlantik, es roch nach Salz und verschüttetem Bier, hier wurde der Grundstein zu Freundschaften und morgendlichem Katzenjammer gelegt. Im Verlauf der Tage wandten sich die Gespräche, die sich bisher um vergangene Abenteuer und haarsträubende Erlebnisse gedreht hatten, der Gegenwart zu. Wir diskutierten intensiv über die richtige Gewichtsverteilung im Boot, wann man einen Treibanker einsetzen sollte (eine fallschirmartige Konstruktion, die bei Stürmen verwendet wird, um das Boot gegen den Wind zu halten) und wann ein Seeanker vorzuziehen wäre (bei stürmischer See und starken Strömungen offenbar). Später am Abend, nach einigen weiteren Gläsern Rum, wurden Gesang und Gitarrenspiel lauter. Nicht selten saßen wir bis zwei, drei Uhr morgens zusammen.
Frances war in ihrem Element. Sie hatte in Southampton studiert und fühlte sich dorthin zurückversetzt, genoss jede Minute wie damals zu ihren Studentenzeiten. Sie, die sonst eher zurückhaltend war, redete und lachte mit allen, ganz offensichtlich angetan von der allgemein positiven Haltung. Natürlich würden wir es alle bis nach drüben schaffen. Natürlich! Natürlich!
Allerdings mussten wir vorher noch die Abschlussüberprüfung bestehen. Wir wussten, dass die Rennleitung kein Boot zulassen würde, das dieser letzten genauen Kontrolle nicht standhielt. Die gesamte Ausrüstung, vom Überlebensanzug über die Sicherheitsleinen bis hinunter zu den Heftpflastern im Erste-Hilfe-Kasten, musste in vorgeschriebener Anordnung neben dem Boot ausgelegt und dann auf einer elf Seiten umfassenden Liste abgehakt werden. Der Tag unserer Abschlussüberprüfung war nervenaufreibend. Wir brauchten fast den ganzen Tag, um sämtliche Gegenstände neben der Rose auszulegen. Hatten wir auch wirklich alles Erforderliche dabei? Hatten die Taue den richtigen Durchmesser? Lag die vorgeschriebene Schiene im Erste-Hilfe-Kasten? Enthielten unsere Tagesrationen hinreichend Kalorien? Den anderen Mannschaften ging es natürlich genau wie uns, und alle hielten sie zusammen. Wenn irgendwo wirklich etwas fehlte, wurde großzügig geholfen – die verschiedensten Dinge flogen von einem Boot zum anderen, der Gemeinschaftsgeist war großartig. Jeder war für den anderen da.
Die Prüfung selbst war allerdings ein Albtraum. Wie sich ablenken, während Lee von der Atlantic Campaigns Organisation langsam und methodisch die Ausrüstung inspizierte?
„Sollen wir so lange einfach auf dem Kai auf und ab spazieren?“, meinte Helen.
„Einen Kaffee trinken gehen?“, fragte Frances.
„Ich bin viel zu nervös“, erklärte Niki. „Stellt euch vor, es fehlt was.“
Schließlich wechselten wir uns bei der Beantwortung von Lees Fragen ab, sonst wären die zwei Stunden, während er unsere Sache durchsah, unerträglich gewesen. Wir warteten mit Herzklopfen und trockenen Mündern. Aber dann, schließlich, endlich. Wir hatten bestanden. Niemals sind vier berufstätige Mütter so glücklich darüber gewesen, fünfunddreißig Heftpflaster vorweisen zu können. Wir waren startbereit und konnten die Rose zu Wasser lassen. Wir buchten einen Termin für den folgenden Morgen.
Wir waren in Hochstimmung. Nichts konnte uns mehr aufhalten.
Doch unsere erste Probefahrt ernüchterte uns. Den Rennvorschriften zufolge musste man mindestens vierundzwanzig Stunden Hochseeerfahrung mit dem Boot mitbringen, bevor man starten durfte, aber obwohl wir dieses Kästchen schon angekreuzt hatten, mussten wir erst einmal herausfinden, wie sich unsere Rose im Atlantik verhalten würde. Wie würden wir mit ihr zurechtkommen? Außerdem konnte es nicht schaden, ein paar Dinge zu üben – zum Beispiel die Inbetriebnahme des Seewasseraufbereiters –, solange wir eventuelle Korrekturen noch auf festem Boden vornehmen konnten. Wenn nach dem Start irgendetwas nicht klappte, würden wir es auf See in Ordnung bringen müssen. Und wir wussten alle, wie schwierig das werden würde. Jedes Problem, das sich schon jetzt zeigte, war gewissermaßen ein Geschenk.
Kaum eine Stunde außerhalb des Hafens unterwegs, stießen wir auf das erste Haar in unserer Suppe: Helen. Die See war stürmisch, die Wellen waren kabbelig und trafen uns von allen Seiten. Man hatte uns vorgewarnt, dass die See vor La Gomera in den ersten Wochen wild und gefährlich sein würde, doch wir hatten gerade erst den Hafen hinter uns gelassen, da wurde unser Boot schon herumgeworfen wie ein Pingpongball in einem Jacuzzi, und damit hatten wir nicht gerechnet.
„Ich glaube, ich muss mich übergeben“, verkündete Helen und opferte prompt ihr Frühstück den Wellen.
„Und noch mal!“, schrie sie.
Helen litt chronisch an Seekrankheit, nicht ideal für eine Hochseeruderin. Wir wussten alle, dass sie kein Wasserfahrzeug betreten konnte, ohne seekrank zu werden, und wir hatten unzählige Male darüber gesprochen. Sie war im Übrigen nicht die einzige Anfällige, auch Frances war gegen gelegentliche Anwandlungen von Übelkeit auf dem Wasser nicht gefeit. Es gab allerdings einen Unterschied zwischen den beiden: Wenn Frances schlecht wurde, warf sie das Ruder hin, fütterte schnell die Fische und ruderte dann weiter. Helen hingegen wurde völlig apathisch, war keiner Bewegung mehr fähig, konnte nicht rudern, die Kajüte nicht verlassen. Sie lag nur da, unfähig zu sprechen oder zu schlucken, und gab Laute von sich, die wie das Muhen einer Kuh klangen.
Dabei hatte sie wirklich alles versucht – Tabletten, Tropfen, Ingwerkekse. Sie hatte für den Notfall sogar ein starkes Antiemetikum dabei, das eine befreundete Medizinerin, Caroline Lennox, ihr empfohlen hatte. Der schneidige Rennarzt Thor Munsch, dem sie es gezeigt hatte, riet allerdings von der Einnahme ab und empfahl ihr schlicht und einfach, sie solle den Dingen ihren Lauf lassen, sobald sie Übelkeit verspüre, und abwarten, bis sie sich wieder legte. Doch Helen wollte unbedingt ein Gegenmittel finden. Bei unserem ersten Ausflug auf den Atlantik probierte sie es deshalb mit den sogenannten TravelShades, einer Spezialbrille, bei der auf einem Auge die Sicht blockiert wird und die der Herstellerfirma zufolge eigentlich wirken musste.
„Sie wirkt überhaupt nicht“, protestierte Helen, gekrümmt an die Reling geklammert. „Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt auf einem Auge blind bin.“
Sie drehte sich nach Janette um, die am Steuer saß, während Frances und Niki ruderten. Es war beinahe zum Lachen, sie da mit flatternden braunen Haaren und ihrer einäugigen Brille an der Reling hängen zu sehen.
„Ich nehme wieder meine Stugeron-Tabletten“, verkündete sie, nachdem sie sich noch einmal übergeben hatte, und verschwand unten in der Kajüte.
Wenn ein Mannschaftsmitglied wegen Seekrankheit ausfällt, stellen sich zwei Probleme. Nicht nur müssen die übrigen Crewmitglieder seine Aufgaben übernehmen, was auf einem so kleinen Boot, zumal auf einer Atlantiküberquerung, praktisch unmöglich ist; auch die Möglichkeiten, in einer Gefahrensituation, in der jeder Mann beziehungsweise jede Frau gebraucht wird, adäquat zu reagieren, sind erheblich eingeschränkt.
Und es dauerte nicht lange, da erwischte es uns. Wir waren vielleicht anderthalb Stunden auf unserer Probefahrt unterwegs, als der Wind und die Strömung plötzlich umschlugen und uns den Felsen vor dem Hafen entgegentrieben.
„Eins! Zwei!“ Janette feuerte Niki und Frances an, rudernd dagegenzuhalten und das Boot von den Felsen wegzusteuern. Die Wellen, die von allen Seiten heranstürmten, durchnässten uns bis auf die Haut. „Mehr Zug!“, schrie sie und riss am Steuerruder, um zu verhindern, dass das Boot den schwarzen Felszacken entgegenraste, die über den Schaumkronen gerade noch sichtbar waren.
„Helen!“, schrie Janette. „Helen! Wir brauchen dich. Wir fahren direkt auf die Felsen zu.“
Dann: „Helen, los jetzt, an die Ruder, sonst schleudert’s uns an die Felsen.“
Und: „Helen, wenn du jetzt nicht kommst und uns hilfst, sterben wir alle. Rudern oder sterben!“
Ihr Ton war todernst. Was für eine absurde Vorstellung, dass wir diesen langen Weg zurückgelegt hatten und dann nicht verhindern konnten, dass das Boot noch vor Beginn des Rennens an den Hafenfelsen zerschellte oder mindestens schweren Schaden nahm.
„Helen!“
Helen kroch aus der Kajüte, blickte, immer noch mit ihrer einäugigen Brille auf der Nase, vom Heck über die Wellen zu den schwarzen Felsen, schluckte, kaum fähig zu sprechen.
„Alles gut“, stieß sie mühsam hervor. „Suicide Steve ist da drüben, und er ist viel näher dran als wir. Wir sind meilenweit weg.“
„Er ist viel dichter an der Hafenmauer, da ist der Wind lang nicht so stark. Wenn du mal die verdammte Brille abnehmen würdest, könntest du vielleicht was sehen.“
Als wir uns zum Hafen zurückkämpften, sahen Helen und Janette einander an. Obwohl Helen wusste, wie leicht sie seekrank wurde, hatte sie stets darauf beharrt, dass sie durchhalten würde. Sie würde uns nicht im Stich lassen. Sie würde eisern weiterrudern, komme, was da wolle. In diesem Moment jedoch lag Zweifel in ihrem Blick. Angst sogar. Würde sie das wirklich schaffen? Es gab reichlich Geschichten von strammen Ruderern, die wegen starker Dehydrierung von ihren Booten geborgen werden mussten. Ein paar Tage starken Erbrechens reichten, um aus einem kräftigen, wohlgenährten Profiruderer ein zitterndes Häufchen Elend zu machen. Konnte Helen das wirklich durchziehen? Und wie sollte das gehen, wenn sie nicht einmal einen Nachmittag im Atlantik durchgehalten hatte? Wir hatten dreitausend Meilen vor uns.
„Ich nehme das Stugeron“, versicherte sie uns, als wir neben der Row2Recovery anlegten. „Ich esse die Ingwerkekse. Ich schaff das.“
Während wir zusahen, wie sie, immer noch wacklig, aus dem Boot kletterte, beteten wir, dass sie recht haben möge.
Wenige Tage später kamen unsere Familien mit allen acht Kindern zusammen. Nachdem der liebenswürdige Ron aus Halifax sie abgeholt und zur Fähre gebracht hatte, trafen sie aufgeregt und zu bedingungsloser Unterstützung bereit auf La Gomera ein. Es war wunderbar, sie bei uns zu haben; sie ließen uns die wachsende Nervosität und Anspannung rund um die Regatta fast vergessen, und wir genossen es, ihnen alles zu zeigen.
Wir hofften, etwas von unserem Enthusiasmus über unser Vorhaben werde sich auf sie übertragen. In einer Welt, die bestimmt wird von Snapchat und Instagram, in der einem vorgeführt wird, dass man nie genügen kann, wollten wir ihnen die Macht der positiven Gedanken zeigen; dass man alles erreichen kann, wenn nur der Wille da ist und die Bereitschaft, hart für sein Ziel zu arbeiten. Und nichts wirkt positiver, als mit einem Haufen Ruderer abzuhängen, die entschlossen sind, den Atlantik zu überqueren. Alle, ohne Rücksicht auf Glauben, Hautfarbe, Lebensgeschichte und persönliches Schicksal, hatten das gleiche Ziel. Es gibt einen Spruch, den wir auf unserem Weg zu den Kanaren ein paarmal zu hören bekamen. „Wenn du fragen musst: ›Warum den Atlantik überqueren?‹, dann wirst du die Antwort nie verstehen.“ Die Antwort lautet natürlich: „Weil er da ist.“ Und alle, die abends im Blue Marlin bei ihrem Bier saßen, verstanden das. Genauso wie die Crews, die ihre Fertigmahlzeiten packten, an ihrer Ausrüstung herumbastelten und sich in ihrer Nervosität vor dem Rennen immer etwas Neues zur eigenen Beschäftigung einfielen ließen.
Unsere Familien waren uns eine große Hilfe. Ben und Pete, Nikis Vater, nahmen uns kraftraubende Schleppereien ab, hievten das Steuerruder herum, verstauten den riesigen Seeanker und weihten uns in den Umgang mit den Elektrowerkzeugen und dem Seewasseraufbereiter ein. Unvergesslich, wie Ben eines Abends, als wir im Blue Marlin unsere Gin Tonics tranken, uns mit Engelszungen auseinandersetzte, wie der Aufbereiter funktionierte. Er erklärte genau, wie oft der Filter gewechselt werden musste und wie genau wir vorgehen sollten. („Prüft ihn einmal die Woche und wechselt ihn, sobald er sich gelb verfärbt.“)
„Aber natürlich“, versicherte Janette und trank einen Schluck aus ihrem Glas.
„Unbedingt“, sagte Helen nickend.
„Ganz klar“, bestätigten Frances und Niki.
Später sollten wir erkennen, dass es vielleicht hilfreich gewesen wäre, wenn wenigstens eine von uns an dem Abend zugehört hätte.
Die anderen Ehemänner, Richard, Gareth und Mark, mussten sich große Mühe geben, um unsere ganze Sippe zusammenzuhalten – Helens zwei Kinder, Henry (13) und Lucy (16); Nikis Aiden (9) und Corby (12); Janettes Safiya (14) und James (18); und Frances’ Jack (13) und Jay (14). Die älteren Kinder waren natürlich eine größere Hilfe als die jüngeren und ließen sich gern losschicken, um in letzter Minute noch eine Schere oder eine Rolle Seil zu besorgen. Dafür taten die Kleineren genau das, was wir gehofft hatten – sie mischten sich unter die Mannschaften, ließen sich deren Geschichten erzählen und kamen mit leuchtenden Augen zurück. Am meisten faszinierten sie verständlicherweise die Jungs von der Row2Recovery. Sie fanden es unglaublich, dass vier Männer mit so schweren körperlichen Handicaps tatsächlich die Überquerung eines Ozeans wagten. Sie waren die Verkörperung des positiven Denkens.
Aber so glücklich wir darüber waren, unsere Familien um uns zu haben, es gab auch sehr viele Momente, in denen wir uns zerrissen fühlten. Ursprünglich war geplant gewesen, dass unsere Leute am Mittwoch und Donnerstag kommen und am Sonntag vor dem für Dienstag angesetzten Start wieder abreisen würden. Da es noch so viel zu überprüfen und zu regeln gab, verbrachten wir den größten Teil der Tage mit der Rose und kamen nur abends dazu, unsere Kinder wirklich zu genießen.
„Spannend und berührend.“
„Der Erlebnisbericht ist zugleich persönlich als auch fesselnd geschrieben, ein modernes Abenteuer“
„Vier Frauen, ein Boot und die stürmische See - diese Powerladys beweisen, dass nichts unmöglich ist.“
„Ein Buch, über 4 Frauen, die zeigen, dass man nie zu alt ist um einen Traum zu leben- mit dem Ruderboot über den Atlantik- sie haben es geschafft.“


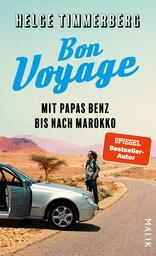











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.