
Unglaubliche Reisen: Vom inneren Kompass der Tiere
„Das Buch richtet sich an alle, die mehr über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere erfahren wollen und weckt gleichzeitig die Neugier, sich intensiver mit den Geheimnissen hinter dem Sichtbaren zu befassen.“ - Bücherrundschau
Unglaubliche Reisen: Vom inneren Kompass der Tiere — Inhalt
Wie Tiere reisen
Wie finden Fische, Vögel, Insekten und Meeressäuger auf ihren unvorstellbar langen Wanderungen zum Ziel? David Barrie geht den Rätseln der Tiernavigation auf den Grund. Er erzählt erstaunliche Anekdoten aus dem Tierreich, besucht Forscher bei ihren Experimenten und entschlüsselt mithilfe der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse die navigatorischen Meisterleistungen der Tiere. Ob sie sich anhand von Lichtmustern, Gerüchen, Schallwellen oder dem Erdmagnetfeld orientieren, David Barrie versetzt uns mit seiner fundierten und unterhaltsamen Untersuchung ins Staunen.
Leseprobe zu „Unglaubliche Reisen: Vom inneren Kompass der Tiere“
Vorwort
Draußen vor meinem Fenster fliegt eine Krähe vorüber. Scheinbar zielstrebig verfolgt sie eine Mission, die nur ihr selbst bekannt ist. Eine Hummel sucht systematisch Blüten im Garten auf. Ein Schmetterling flattert flink über die Mauer, segelt wild umher, lässt sich kurz nieder und fliegt dann weiter. Eine Katze schleicht den Weg entlang und verschwindet im Gestrüpp, während hoch oben ein Flugzeug voller Passagiere zur Landung in Heathrow ansetzt.
Man muss sich nur umsehen. Überall sind Lebewesen aller Arten und Größen unterwegs, menschliche und [...]
Vorwort
Draußen vor meinem Fenster fliegt eine Krähe vorüber. Scheinbar zielstrebig verfolgt sie eine Mission, die nur ihr selbst bekannt ist. Eine Hummel sucht systematisch Blüten im Garten auf. Ein Schmetterling flattert flink über die Mauer, segelt wild umher, lässt sich kurz nieder und fliegt dann weiter. Eine Katze schleicht den Weg entlang und verschwindet im Gestrüpp, während hoch oben ein Flugzeug voller Passagiere zur Landung in Heathrow ansetzt.
Man muss sich nur umsehen. Überall sind Lebewesen aller Arten und Größen unterwegs, menschliche und tierische. Sie suchen vielleicht Nahrung oder einen Paarungspartner; möglicherweise wandern sie, um der Kälte des Winters oder der Hitze des Sommers zu entgehen; oder sie sind einfach auf dem Weg nach Hause. Einige unternehmen Reisen um den gesamten Erdball, andere hingegen ziehen lediglich in ihrer näheren Umgebung herum. Aber jedes einzelne Lebewesen – sei es die Küstenseeschwalbe, die von einem Ende der Welt zum anderen fliegt, oder die Wüstenameise, die mit einer toten Fliege zwischen den Kiefern zu ihrem Nest zurückeilt – muss seinen Weg finden können. Es ist schlichtweg eine Frage des Überlebens.
Wie peilt eine Wespe nach einem Jagdausflug ihr Nest an? Wie bringt es ein Mistkäfer fertig, seine Kugel in einer geraden Linie zu rollen? Welcher geheimnisvolle Sinn führt eine Meeresschildkröte nach dem Durchkreisen eines ganzen Ozeans an die Küste zurück, an der sie zur Welt kam, um dort ihre Eier abzulegen? Wie meistert eine Taube ihren Heimweg, wenn sie Hunderte Kilometer von ihrem Schlag entfernt – an einem ihr unbekannten Ort – freigelassen wird? Und wie steht es mit den Naturvölkern, die in einigen Teilen der Welt immer noch lange und schwierige Reisen zu Wasser wie zu Land bewältigen, ohne Karte oder Kompass, ganz zu schweigen von GPS?
Die erste Frage, mit der ich mich in diesem Buch befassen möchte, ist ganz einfach: Wie finden sich Lebewesen – Tiere wie auch der Mensch – überhaupt zurecht? Wie wir feststellen werden, sind die Antworten für sich gesehen faszinierend, doch sie werfen weitere Fragen auf, die unser sich wandelndes Verhältnis zur Umwelt berühren.
Wir Menschen werfen die grundlegenden Orientierungsfähigkeiten über Bord, auf die wir uns so lange verlassen konnten. Heutzutage können wir unseren Standort überall auf der Erde mühelos und präzise bestimmen, ohne überhaupt nachzudenken, einfach per Knopfdruck. Doch ist diese Tatsache überhaupt der Rede wert? Das lässt sich noch nicht eindeutig beantworten, aber in den Schlusskapiteln werde ich die wichtigen Punkte erörtern, die auf dem Spiel stehen.
Einleitend sollen ein paar Worte über Orientierungsprobleme im Alltag näher an das Thema heranführen. Überlegen wir für einen Moment, wie wir vorgehen, wenn wir in einer fremden Stadt ankommen.
Die erste Orientierungsaufgabe besteht darin, den Weg vom Flugzeug durch die Passkontrolle zur Gepäckausgabe zu finden. Selbst diese Art von Orientierung in Innenräumen kann Probleme bereiten, besonders wenn die Sehfähigkeit eingeschränkt ist, doch für gewöhnlich lassen sich diese Hindernisse überwinden, indem man Schildern und Zeichen folgt. Sobald man im Taxi oder Bus sitzt, kann man sich entspannen und die Entscheidungen dem Fahrer überlassen.
Bei der Ankunft im Hotel muss man die Rezeption und das Zimmer finden; auch hier sind Schilder und Zeichen eine große Hilfe. Am nächsten Morgen wollen Sie die nähere Umgebung vielleicht zu Fuß erkunden. Die verführerische Stimme der GPS-App Ihres Smartphones könnte Ihnen eine genaue Wegbeschreibung liefern, doch das ist keine echte Navigation; man befolgt bloß Anweisungen.
Wer eigenständig denkt und handelt und sich lieber selbst orientiert, greift vermutlich zu einem gedruckten Stadtplan. Als erste praktische Aufgabe gilt es, den Standort des Hotels und somit die eigene Position auf der Karte zu bestimmen. Als Nächstes muss man die Sehenswürdigkeiten einkreisen, die man besichtigen will, und herausfinden, wie man dorthin gelangt und wie lange es dauert. Das heißt, Sie müssen Entfernungen berechnen und Ihre voraussichtliche Schrittgeschwindigkeit schätzen, wodurch die Messung von Zeit ins Spiel kommt. Auch wenn es anfangs nicht offensichtlich scheinen mag: Navigation hat ebenso viel mit Zeit zu tun wie mit Raum.
Damit ist die Vorausplanung abgeschlossen. Nun stehen Sie vor einem weiteren Problem: Müssen Sie, wenn Sie vom Hotel aufbrechen, nach rechts oder nach links gehen? Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie die richtige Richtung kennen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses zentrale Problem zu lösen. Sie können den Kompass in Ihrem Smartphone nutzen, aber Sie könnten sich auch orientieren, indem Sie herausfinden, auf welcher Straße Sie stehen. Es mag auch hilfreich sein, nach dem Fall der Schatten den Stand der Sonne zu ermitteln. Und wenn Sie dann losmarschiert sind, müssen Sie sich immer wieder Ihrer Route versichern, indem Sie markante Punkte und Straßennamen mit dem Stadtplan abgleichen.
Mit jedem weiteren Ausflug gewinnen Sie ein klareres Bild vom Grundriss der Stadt und erkennen, wie die jeweiligen Viertel miteinander verbunden sind; und zwar, indem Sie sich markante Punkte
einprägen und sie geometrisch miteinander in Beziehung setzen. Natürlich können sich manche Menschen viel besser orientieren als andere, aber wer in dieser Art von Wegfindung geübt ist, entwickelt schon bald das Selbstvertrauen, längere und kompliziertere Ausflüge zu unternehmen, ohne überhaupt auf den Stadtplan zu schauen. Und anstatt sich nur im näheren Umkreis des Hotels zu bewegen, wählen Sie bald schon Routen durch ganz verschiedene Teile der Stadt. Mittlerweile haben Sie sich einen mentalen Plan der Stadt angeeignet.
Vielleicht wenden Sie aber auch eine ganz andere Methode der Orientierung an. Anstatt eine Karte zu Hilfe zu nehmen, könnten Sie einfach Ihrer Nase folgen, bis Sie auf etwas Interessantes stoßen, wobei Sie stets darauf achten, welchen Weg Sie gehen und wie weit Sie gegangen sind, um auch bestimmt wieder zum Hotel zurückzufinden.
Dieser Ansatz wurde mit dem Verfahren verglichen, das der griechische Sagenheld Theseus nutzte. Als er das Labyrinth des Minotaurus betrat, wickelte er ein Garnknäuel ab, das Ariadne ihm gegeben hatte, und dank dieses Fadens fand Theseus wieder aus dem Labyrinth heraus, nachdem er das Ungeheuer getötet hatte. Ein Garnknäuel ist in einer belebten modernen Großstadt natürlich kein besonders zweckmäßiges Hilfsmittel, daher sind bei der Orientierung ohne Karte in der Praxis genaues Beobachten und Erinnern ausschlaggebend.
Die Unterscheidung zwischen Orientierung mit und Orientierung ohne Zuhilfenahme
einer Karte ist essenziell und betrifft auch nicht menschliche Wesen. Karten und Pläne (ob nun materiell oder mental) bieten große Vorteile, nicht zuletzt die Möglichkeit, Abkürzungen zu finden, die wertvolle Zeit und Energie sparen, oder Umwege zu machen, um Gefahren und Hindernisse zu umgehen. Einige Tiere scheinen tatsächlich gewisse Karten zu verwenden (auch wenn diese natürlich nicht auf Papier gedruckt sind), doch das lässt sich nur schwer nachweisen; noch kniffliger ist die Frage, wie diese Karten funktionieren. Solche Themen gehören zu den komplexesten, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen, die das Orientierungsvermögen von Tieren erforschen.
Die Gliederung dieses Buches gibt die Unterscheidung zwischen Orientierung mit und Orientierung ohne Karten wieder. Im ersten Teil richte ich das Augenmerk darauf, wie sich Tiere ohne Karten zurechtfinden können; im zweiten Teil erörtere ich den möglichen Einsatz von Karten unterschiedlicher Art und durch unterschiedliche Spezies sowie die Hinweise auf die Existenz kartenähnlicher Abbildungen der Welt in ihren Gehirnen. Im letzten Teil beleuchte ich die Frage, was die Erforschung der Tiernavigation für den Menschen bedeutet.
Den einzelnen Kapiteln folgt jeweils ein kurzer Abschnitt in einer anderen Schrift, in dem ein verblüffendes Beispiel für Tiernavigation genannt wird, das im Haupttext nicht leicht unterzubringen wäre. Diese Geschichten tragen hoffentlich dazu bei, den Leser zu unterhalten, und verdeutlichen gleichzeitig, wie viele Rätsel noch zu lösen sind.
Die Orientierung von Tieren ist ein großes, komplexes Forschungsgebiet; daher können in einem vergleichsweise schmalen Buch wie diesem nur die wichtigsten Aspekte herausgestellt werden. Unglaubliche Reisen. Vom inneren Kompass der Tiere deckt das Thema keineswegs erschöpfend ab. Und weil ich kein Fachpublikum, sondern den allgemeinen Leser anspreche, habe ich so weit wie möglich auf die Verwendung von Fachbegriffen verzichtet.
Der Inhalt dieses Buches spiegelt nicht nur meine persönlichen Interessen wider, sondern geht teilweise auch auf den Austausch mit Wissenschaftlern zurück, der den Kurs meiner Recherchen geprägt hat. Ich habe mich in erster Linie darauf konzentriert zu beschreiben, was Tiere tun und wie; das Warum bleibt dabei ausgeklammert. Der Versuch, letztere Frage zu beantworten, würde genügend Material für etliche weitere Bände liefern.
Zum Schluss möchte ich kurz auf das Thema Tierwohl eingehen. Strenge ethische Regeln bestimmen die Arbeit von Forschern, die sich mit Tiernavigation (wie auch mit anderen Feldern) beschäftigen. Alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, nehmen ihre Verantwortung dafür, den Tieren kein Leid zuzufügen, sehr ernst. Dennoch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Tiere bei manchen Experimenten verletzt werden, aber jede Darstellung des Forschungsgegenstandes, die die Ergebnisse dieser Arbeiten ausklammern würde, wäre nicht nur unvollständig, sondern auch vollkommen irreführend.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unseren Mitgeschöpfen Respekt schulden und folglich unsere Interessen nicht bedenkenlos über ihre Bedürfnisse stellen dürfen. Die Frage, welche Experimente mit Tieren gerechtfertigt sind, ist nicht leicht zu beantworten, doch zumindest sollten wir alles daransetzen, den Tieren keinen Schmerz zuzufügen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht einmal sicher, ob wir bereits genügend über Lebewesen wie Krebstiere und Insekten wissen, um uns unserer Urteile und Einschätzungen in dieser Frage sicher sein zu können.
Einige Leser sind vielleicht der Überzeugung, dass es niemals und unter keinen Umständen gerechtfertigt sein kann, Tieren um der Wissenschaft willen Leid zuzufügen. Aus ethischer Sicht kann man gewiss dafür plädieren, alle schädlichen oder tödlichen Tierversuche zu verbieten, allerdings vermute ich, dass die wenigsten Menschen bereit wären, mit den Konsequenzen zu leben – besonders wenn es um medizinische Forschung geht. Es ist jedoch tröstlich zu wissen, dass die Zahl von Tieren, die für Experimente herangezogen werden, in den vergangenen Jahren (zumindest in Großbritannien) zurückgegangen ist.
Die ethischen Aspekte wissenschaftlicher Experimente an und mit Tieren sind längst nicht ausdiskutiert, und ich gebe keineswegs vor, alle Antworten parat zu haben. Es wäre aber sicherlich falsch, für Forscher höhere Standards anzulegen als für alle anderen Menschen.
TEIL I
Navigieren ohne Karten
1. KAPITEL
Mr. Steadman und der Monarchfalter
Als ich sieben Jahre alt war, trat ein bemerkenswerter Lehrer in mein Leben. Er unterrichtete Mathematik, hielt sich aber kaum an den Lehrplan und achtete auch nicht auf das Alter seiner Schüler. Eine Unterrichtsstunde bei Mr. Steadman, die mit dem Satz des Pythagoras begann, konnte leicht zur Topologie abschweifen und schließlich ins Kaninchenloch der nicht euklidischen Geometrie abtauchen. Diese Themen faszinierten ihn, und zweifellos glaubte er, es sei gut, unseren Horizont zu erweitern.
Mr. Steadman war nicht nur Mathematiker; er kannte sich auch mit Insekten aus. Während der Sommermonate hing in meiner Schule eine Mottenfalle, die er angebracht hatte. Ich freute mich damals auf jeden neuen Schultag, denn ich durfte dabei sein, wenn er vor Beginn des Unterrichts die Beute der Nacht begutachtete.
Meine Schule befand sich am Rand des New-Forest-Nationalparks im Süden Englands, eines der besten Habitate für Insekten in Großbritannien. Oft ruhten fünfzig oder sogar hundert Falter in der Box, in die sie nachts durch ein helles Licht gelockt worden waren. Einige Motten und Schmetterlinge, so lernte ich, waren nicht heimisch, sondern lediglich Sommergäste. Ein häufiger Fang war ein Nachtfalter namens Gammaeule. Wie wir heute wissen, wandert eine große Anzahl dieser Eulenfalter jeden Sommer vom Mittelmeerraum zur Brut nach Nordeuropa. Warum diese Insekten solch lange Reisen unternehmen und wie sie ihren Weg finden, war damals ein absolutes Rätsel.
Schon bald war ich von Schmetterlingen besessen. Zum Leidwesen meiner Mutter füllte sich mein Zimmer mit Netzen, Sammelboxen, Schaurahmen und großen Kästen, in denen ich Raupen züchtete. Manchmal lag ich nachts wach und hörte, wie meine unentwegt fressenden Gefangenen vor sich hin knabberten und ihre winzigen Exkremente leise auf die Blätter ihrer Futterpflanzen platschten. Wenn sie satt waren, verwandelten sie sich in Puppen beziehungsweise Larven; ihre fetten Körper lösten sich auf und wurden zu einer alchemischen Suppe, aus der sich wie durch Magie die ausgewachsenen Falter zusammenfügten. Wenn man zusah, wie sie aus ihren harten, trockenen Kokons ausbrachen, langsam ihre feuchten, zerknitterten Flügel ausbreiteten und schließlich zum Flug ansetzten, wurde man Zeuge eines Naturwunders, das trotz des bescheidenen Maßstabs nicht minder erstaunlich war.
Meine leidgeprüfte Mutter fuhr mit mir nach London zum Naturhistorischen Museum, wo uns ein freundlicher junger Kurator einen Blick hinter die Kulissen gewährte. Er schloss eine nicht gekennzeichnete Tür auf, führte uns in einen riesigen Raum voller Mahagonivitrinen mit Millionen von Nachtfaltern und Schmetterlingen aus aller Welt und zeigte uns schließlich einen großen exotischen Schmetterling, der ganz vereinzelt auch in England auftauchte. Er stammte nicht aus Europa oder gar Afrika, sondern aus Nordamerika. Selbst wenn ihm auf seinem Weg über den Nordatlantik die vorherrschenden Westwinde zu Hilfe kamen oder sich eine Mitfahrgelegenheit auf einem Schiff anbot, war dies eine außergewöhnliche Leistung.
Die Flügel dieses Schmetterlings können eine Spannweite von bis zu zwölf Zentimetern aufweisen und gleichen einem modernistischen Buntglasfenster. Zarte schwarze Adern breiten sich über einen hellen orangefarbenen Grund aus, der leuchtet, als würde die Sonne durchscheinen. Die dunklen Linien münden in einen breiteren schwarzen Rand, der wie der Kopf des Tieres mit schneeweißen Punkten getüpfelt ist. Das Gewand dieses Schmetterlings mag farbenfroh anmuten, doch die knallige Farbgebung ist ein Warnsignal an Fressfeinde – es könnte ein Fehler sein, voreilig zuzuschnappen. Das Tier steckt möglicherweise voller Gifte, die es in der Raupenphase über das Futter, die Seidenpflanze, aufnimmt. Jeder Nordamerikaner kennt diesen Schmetterling: den Monarchfalter.
Ich erzählte Mr. Steadman von meiner Begeisterung für diese Spezies, woraufhin er ohne großes Aufheben bei einem Lieferanten eine Monarchfalterlarve bestellte. Als ich das Päckchen öffnete, erkannte ich sofort, was sich darin verbarg: mein ureigener Danaus plexippus.
Die Puppe, die vielleicht nur zwei oder drei Zentimeter lang war, glich dem Kunstwerk eines Juweliers. Umhüllt von einem glänzenden jadegrünen Panzer lag sie in ihrem Nest aus Baumwollwatte, wie ein miniaturhafter chinesischer Kaiser, der auf seine Wiedergeburt wartete. Vage konnte ich die Form der Flügel und die Teile dessen erkennen, was später einmal den Körper des ausgewachsenen Insekts bilden sollte. Eine Linie winziger, goldglänzender Punkte schimmerte in einem Halbkreis um den dicksten Teil der Puppe, die hier und da mit weiteren Goldflecken gesprenkelt war. Ich bewunderte diese Larve, die mir sogar noch schöner erschien als das prächtige ausgewachsene Tier; aber sie wirkte auch verstörend, irgendwie fremdartig. Wie konnten die Tiefen des Weltalls größere Wunder bergen, wenn doch unsere eigene Welt von solch herrlichen Kuriositäten erfüllt war?
Den Schmetterling habe ich nicht schlüpfen sehen; die Puppe ging ein, bevor sie ausreifte. Doch der Monarchfalter und seine ungewöhnliche Lebensgeschichte hatten mich längst in ihren Bann gezogen.
Viele Jahre später sah ich zum ersten Mal einen lebenden Monarchfalter – in den Sanddünen von Amagansett, unweit von Montauk an der östlichen Spitze von Long Island. Es war Ende August, und dieser Schmetterling flatterte, zusammen mit Millionen Artgenossen, langsam nach Südwesten. Sein Flug glich einem unbeschwerten Tanz. Ein paar lässige Flügelschläge verliehen ihm Auftrieb, dann segelte er – während er langsam an Höhe verlor – ein paar Sekunden lang durch die Luft, um schließlich wieder emporzusteigen. Aber wohin war er unterwegs und wie um alles in der Welt fand er seinen Weg?
Meine Suche nach Antworten auf diese Fragen brachte mich letztlich dazu, dieses Buch zu schreiben. Ich wusste, dass ich unterwegs Überraschungen erleben würde, aber ich ahnte nicht, wie zahlreich und vielfältig diese sein sollten.
Die frühesten Wegfinder
Als ich mit meinen Recherchen begann, dachte ich nur an Lebewesen, die ich sehen konnte – etwa Insekten, Vögel, Reptilien, Ratten, Menschen –, doch die ersten Lebensformen, die sich auf unserem Planeten entwickelten, waren winzig klein und Pioniere der Tiernavigation.
Die Erde entstand vor ungefähr 4,56 Milliarden Jahren als Zufallsprodukt bei der Verdichtung von Asteroiden, Gas und Staub; diese Einzelteile wurden durch die eigene Schwerkraft zusammengepresst. Damals war die Erde ein äußerst ungemütlicher Ort: Ihre gesamte Oberfläche war von heißem, flüssigem Gestein bedeckt. Die ersten Kontinente bildeten sich, als dieses Meer aus Magma vor circa 4,5 Milliarden Jahren langsam abkühlte und erstarrte, doch es gab noch keine Ozeane und auch keine Luft.
Über Hunderte Millionen Jahre hinweg wurde der junge Planet von weiteren Asteroiden bombardiert, aber diese Einschläge waren nicht nur zerstörerisch. Sie lieferten die chemischen Zutaten, welche die allerersten Lebensformen und auch Wasser entstehen ließen. Vor etwa 3,9 Milliarden Jahren beruhigte sich die Erde, und in den Tiefen der ersten Ozeane entwickelten sich einfache Lebensformen um hydrothermale Spalten im Meeresboden, aus denen extrem heißes, stark mineralisiertes Wasser strömte. Zu diesen Lebensformen gehörten die allerersten Bakterien.
Heute bringen wir diese einzelligen Organismen zwar meist mit Krankheiten in Verbindung, doch die Mehrzahl der Bakterien ist harmlos; viele tragen sogar maßgeblich zu unserer körperlichen und selbst geistigen Gesundheit bei. Um zu überleben, können sie gezielt Nahrungsquellen aufsuchen und Gefahren wie übermäßige Hitze, Acidität und Alkalität meiden. Einige verfügen über ganz spezielle Antriebsmittel, etwa mikroskopisch kleine Motoren, die rotierende Fäden – sogenannte Flagellen – antreiben. Diese einfachste Form der zielgerichteten Orientierungsreaktion wird als Taxis bezeichnet, nach dem griechischen Wort für „Ordnung“ oder „Ausrichtung“.
Manche Bakterien bedienen sich einer besonders verwunderlichen Form der Taxis. Magnetotaktische Bakterien enthalten winzige magnetische Partikel, die – wenn sie zu Ketten aneinandergereiht sind – wie mikroskopische Kompassnadeln fungieren. Mithilfe dieser „Kompassnadeln“ können sich die Bakterien am Magnetfeld der Erde ausrichten und dadurch den Weg hinunter zu den sauerstoffarmen Wasserschichten und Sedimenten finden, in denen sie gedeihen. Die Nadeln in Bakterien auf der nördlichen Halbkugel haben die entgegengesetzte Polarität derer auf der südlichen Hemisphäre; ein einfaches Beispiel für die Wirkkraft der natürlichen Selektion.
Versteinerte Bakterien sind ausgesprochen schwer auszumachen; dennoch entdeckte man die Reste von magnetotaktischen Bakterien in Gestein, das Hunderte Millionen, vielleicht sogar Milliarden Jahre alt ist. Obwohl diese Bakterien als die frühesten magnetbasierten Navigatoren in der Geschichte unseres Planeten gelten, wurden die ersten lebenden Exemplare erst 1975 entdeckt. Seltsamerweise fiel ihre Entdeckung zeitlich mit den ersten Nachweisen magnetbasierter Orientierung bei viel komplexeren Organismen wie etwa Vögeln zusammen.
Der Name unserer nächsten Verwandten unter den einzelligen Organismen ist ein wahrer Zungenbrecher: Choanoflagellaten (oder Kragengeißeltierchen). Sie sind geringfügig komplexer als Bakterien, leben im Wasser und bilden manchmal Kolonien. Wie der Mensch sind sie auf Sauerstoff angewiesen; sie können nicht nur kleinste Unterschiede in dessen Konzentration ausmachen, sondern auch gezielt zu einer sauerstoffreicheren Quelle schwimmen, ebenfalls dank ihrer Flagellen.
Noch beeindruckender sind gewisse hirnlose Ansammlungen von Einzellern, bekannt unter der eher abstoßenden Bezeichnung „Schleimpilze“. Diese einfachen Organismen können sich langsam, aber zielsicher auf einen Vorrat an Glukose zubewegen, der im unteren Teil eines u-förmigen Siphons verborgen ist. Dabei nutzen sie eine simple Form von Gedächtnis, das sie davon abhält, bereits erkundete Stellen erneut abzusuchen. Sie können außerdem ein Problem lösen, das selbst Verkehrsplaner und Ingenieure vor große Herausforderungen stellt: die Konstruktion eines effizienten Bahnnetzes.
Wissenschaftler haben Folgendes herausgefunden: Wenn einem bestimmten Schleimpilz große Mengen von Haferflocken in einem Muster dargeboten werden, das den Grundriss von Städten rings um Tokio nachahmt, beginnt er, ein Netzwerk von „Tunneln“ zu bauen, um die aus den Flocken gewonnenen Nährstoffe zu verteilen. Erstaunlicherweise gleicht das Netzwerk schließlich dem tatsächlichen Bahnsystem rund um Tokio. Der Schleimpilz vollbringt eine Meisterleistung, indem er zunächst Tunnel anlegt, die in alle Richtungen führen, und diese dann allmählich reduziert, sodass letztendlich nur jene übrig bleiben, in denen die größten Mengen an Nährstoffen (sprich „Passagieren“) befördert werden können.
Weiter oben auf der Skala der Komplexität stoßen wir auf viel größere, aber immer noch winzige mehrzellige Organismen namens Plankton. Die Ozeane, besonders um die Arktis und die Antarktis, wimmeln nur so davon. Viele dieser Pflanzen und Tiere sind für das bloße Auge unsichtbar, doch sie sind häufig so zahlreich, dass sie das Meer wie eine kräftige Misosuppe aussehen lassen. Planktonblüten können sogar ganze Seegebiete rostrot färben.
Lebewesen wie diese müssen nicht wissen, wo genau sie sich befinden, zumal sie ohnehin weitgehend den Meeresströmungen ausgeliefert sind; dennoch sind sie keineswegs nur passiv. Um Nahrung zu finden oder nicht selbst gefressen zu werden, steigt ein Großteil des tierischen Planktons (darunter Fischrogen, kleine Krebstiere und Mollusken) in der Wassersäule auf und ab, von den dunklen Tiefen an die Oberfläche und wieder hinunter, jeden Morgen und jeden Abend. Und das pflanzliche Plankton, das sich meist nah an der Oberfläche aufhält, um von der größeren Lichtmenge zu profitieren, taucht nötigenfalls ab, damit es nicht durch ein Übermaß an ultraviolettem Licht geschädigt wird.
Das Timing dieser Abläufe beruht auf der Fähigkeit des Planktons, Veränderungen in der Stärke des Sonnenlichts wahrzunehmen; in der monatelangen arktischen Nacht schaltet das tierische Plankton allerdings auf einen Rhythmus um, der sich nach dem Mondlicht richtet. In einigen Fällen sind diese Prozesse nicht nur eine simple Reaktion auf variierende Helligkeitsgrade. Bestimmte Planktonarten steigen auf oder ab, noch bevor sie irgendwelche Veränderungen wahrnehmen können; und selbst wenn sie in ein dunkles Aquarium verlegt werden, behalten sie ihre vertikalen Wanderungen für mehrere Tage bei. Dieses rätselhafte Verhalten scheint von einer Art innerer Uhr abhängig zu sein, die ihre Standortveränderungen reguliert. Die gesamte Nahrungskette der Ozeane stützt sich letztlich auf das Plankton, und dessen gigantische tägliche Wanderzüge spielen eine entscheidende Rolle für alles Leben auf der Erde.
Selbst einfache Würmer müssen sich zurechtfinden. Eine Wurmart namens Caenorhabditis elegans scheint sich am Erdmagnetfeld zu orientieren, wenn sie sich im Untergrund vergraben hat. Und Wassermolche, von denen einige bis zu zwölf Kilometer weit zum heimischen Tümpel zurückfinden, setzen einen Magnetkompass ein.
Würfelquallen – kleine, durchsichtige Tiere, die im tropischen Australien berüchtigt sind, weil sie mit ihren Nesselkapseln ein tödliches Nervengift freisetzen können – haben kein Gehirn, aber Augen, und sie bewegen sich nicht nur mit der Strömung. Sie schwimmen aktiv und mit einem regelrechten Zielbewusstsein, wenn sie beispielsweise ihrer Beute nachjagen. Kurioserweise verfügen sie über nicht weniger als vierundzwanzig Augen, die sich in vier unterschiedliche Typen unterteilen lassen.
Noch überraschender ist es, dass einige Würfelquallen navigieren können, indem sie sich an markanten Punkten über der Wasseroberfläche orientieren. Eine spezielle Art, die in den Mangrovensümpfen der Karibik vorkommt, besitzt eine Gruppe von Augen, die stets nach oben gerichtet sind, unabhängig davon, wie der Körper des Tieres ausgerichtet ist. Schwere Gipskristalle im Gewebe um jedes einzelne spezialisierte Auge dienen dazu, diese Orientierung beizubehalten.
Dan-Eric Nilsson, ein Biologe an der Universität Lund in Schweden (einem der führenden Forschungszentren für Tiernavigation), wollte herausfinden, was diese nach oben gerichteten Augen leisten. Er und sein Team platzierten Würfelquallen in durchsichtige Becken, die sie in der Nähe eines Mangrovenhains ins Meer setzten, und beobachteten dann mithilfe einer Videokamera das Verhalten der Tiere. Wenn der Rand der Mangrovenwipfel vom Bassin aus sichtbar und nur wenige Meter von diesem entfernt war, stießen die Quallen wiederholt gegen jene Seite des Beckens, die den Bäumen am nächsten war – so als versuchten sie, ihnen näher zu kommen. Wurde der Behälter jedoch so weit weggezogen, dass die Bäume von unterhalb der Wasseroberfläche nicht mehr zu sehen waren, schwammen die Quallen ziellos umher.
Es scheint so, als nutzten die Quallen ihre nach oben gerichteten Augen, um die Silhouette der Mangrovenbäume auszumachen. Dadurch bleiben sie im seichten Gewässer, in dem sich das winzige tierische Plankton – ihre Nahrung – tummelt; das ist jedoch nur dann möglich, wenn sie sich nicht zu weit vom Rand des Mangrovenhains entfernen.
Dies sind nur ein paar Beispiele für die außergewöhnlichen Orientierungsfähigkeiten von Organismen, die auf den ersten Blick recht einfach erscheinen mögen.
Ein alter Walt-Disney-Film mit dem Titel The Incredible Journey (Die unglaubliche Reise) erzählt die Geschichte zweier Hunde – eines Labrador Retrievers und einer Bullterrierhündin – sowie eines Siamkaters, die von ihrem Herrchen bei einem Freund in Pflege gegeben werden. Die unglücklichen Tiere verstehen nicht, dass es sich nur um einen vorübergehenden Aufenthalt in der Fremde handelt, und beschließen, nach Hause zurückzukehren. Dazu müssen sie aber 400 Kilometer kanadische Wildnis durchqueren, wobei sie haarsträubende Abenteuer erleben: Sie begegnen einem Bären und einem Luchs, er trinken einmal beinahe und machen die schmerzliche Bekanntschaft mit einem Stachelschwein. Zu guter Letzt kommen sie jedoch wohlbehalten zu Hause an.
Skeptiker mögen diese Geschichte als unglaublich im wörtlichen Sinne abtun, aber vielleicht ist das zu schnell geurteilt. Im Jahr 2016 büxte ein Hirtenhund namens Pero aus und machte sich auf den Weg zu seinen alten Herrchen. In nur zwölf Tagen legte er eine Entfernung von 385 Kilometern zurück – von seinem neuen Zuhause im englischen Lake District bis nach Wales – und kam in guter Verfassung an, völlig unerwartet. Pero war gechippt, an seiner Identität konnte also keinerlei Zweifel bestehen.
Niemand weiß, wie Pero dieses Meisterstück gelang. Es ist wohl denkbar, dass er dank einer ungewöhnlichen Folge günstiger Entscheidungen nach Hause zurückfand, doch das ist schwer zu glauben. Die Orientierungsfähigkeiten von Hunden und Katzen fanden bisher überraschend wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Eine neuere Studie ergab jedoch, dass sich Hunde bevorzugt nach Norden oder Süden wenden, wenn sie ihr Häufchen machen. Vielleicht verfügen sie also über eine Art inneren Kompass, mit dessen Hilfe sie zumindest die Richtung ausmachen können. Wenn das zutrifft, erweitern sie eine rasch länger werdende Liste von Lebewesen, die das Magnetfeld der Erde spüren können. Aber nur mithilfe eines Kompasses hätte Pero nicht nach Hause zurückfinden können.
Es ist möglich, dass Pero es irgendwie schaffte, sich den Weg zu seinem neuen Heim im Lake District einzuprägen. Konnte er dann diese Route rekonstruieren und zurückverfolgen? Vielleicht spielte dabei auch sein scharfer Geruchssinn eine Rolle.
2. KAPITEL
Jim Lovells magischer Teppich
Charles Darwin (1809–1882) schrieb, „dass der Mensch mit allen seinen hohen Eigenschaften noch immer in seinem Körper den unauslöschlichen Stempel seines niederen Ursprungs trägt“. Doch sogar Darwin würde darüber staunen, dass unsere Augen derselben uralten Abstammung sind wie die der Würfelqualle, des Tintenfischs, der Spinnen und Insekten.
Das unerbittliche Versuchsfeld der natürlichen Selektion hat über Hunderte Millionen Jahre jene Augen und Gehirne entstehen lassen, die es uns (und anderen Spezies) ermöglichen, mühelos diejenigen Dinge wahrzunehmen, die wir wirklich sehen müssen – und uns an sie zu erinnern. Dank ihrer Augen können Lebewesen nicht nur Nahrung und Partner finden sowie Gefahren umgehen; anders als die übrigen Sinnesorgane liefern sie zudem außergewöhnlich detaillierte Informationen über nahe wie ferne Gegenstände. Für viele Tiere sind die Augen das wichtigste Orientierungshilfsmittel, und wir Menschen benutzen sie ständig, um uns zurechtzufinden.
Verglichen mit vielen anderen Lebewesen ist der typische urbane Mensch kein besonders begabter Navigator, doch mit ein wenig Übung können sich die meisten Stadtbewohner anhand von markanten Punkten ziemlich gut orientieren. Unser visuelles Gedächtnis funktioniert im Grunde einwandfrei – wenn wir uns Mühe geben. Wir können uns beispielsweise an mindestens zehntausend Bilder erinnern, die wir nur ein Mal kurz gesehen haben.
Selbst leistungsstarke Computer können da kaum mithalten. Sie so zu programmieren, dass sie recht einfache Aufgaben der visuellen Erkennung ausführen können, hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Ein Computer, der zwei Fotos von Ihrem Haus miteinander vergleichen soll – eines zeigt es an einem sonnigen Morgen, das andere in einer verregneten Nacht –, wird sich schwertun, Übereinstimmungen zu finden. Bereits die veränderte Position eines Schattens oder eine unvermittelte, helle Reflexion eines Fensters reicht aus, um ihn heillos zu verwirren. Reine Rechenleistung ist nicht die Antwort, zumindest nicht die ganze. Ein Supercomputer hat Probleme mit visueller Erkennung, es sei denn, er lernt – wie der Mensch –, sich auf konstante und relevante Merkmale zu konzentrieren und jegliches optische „Rauschen“ auszuklammern. „Maschinelles Sehen“ ist immer noch für einfache Fehler anfällig, die dem Menschen nie unterlaufen würden; Unfälle mit fahrerlosen Autos haben das nur allzu deutlich gezeigt.
Wir wissen alle, wie markante Orientierungspunkte typischerweise aussehen – zum Beispiel der Eiffelturm oder der Hollywood-Schriftzug in Los Angeles. Aber manchmal haben sie ganz unterschiedliche und sogar überraschende Formen. Sie können so groß sein wie der Lake Michigan und die Cheopspyramide oder auch so klein wie ein einzelner Fußabdruck. Eine Route mag absichtlich markiert sein, indem etwa Kieselsteine ausgestreut (wie in Der kleine Däumling) oder mit einem Beil Wegmarkierungen in die Rinde von Bäumen geschlagen wurden. Das Garnknäuel, das Theseus von Ariadne bekam, kann man als eine Art erweitertes Orientierungszeichen betrachten, das den Helden sicher aus dem Labyrinth hinausführte.
Visuelle Orientierungspunkte können nicht nur ein Ziel kennzeichnen oder als Wegmarken entlang einer Route dienen, sondern auch wertvolle Informationen bezüglich Richtungen liefern. Nehmen wir als Beispiel die Freiheitsstatue im Hafen von New York: Weil ihre Figur nicht symmetrisch ist, lässt sich nach der Form ihrer Silhouette die Richtung bestimmen, aus der man sie sieht.
Ein guter Orientierungspunkt zeichnet sich offenkundig vor allem dadurch aus, dass er deutlich hervorsticht und lang genug an Ort und Stelle bleibt, um seinen Zweck zu erfüllen. Doch kurioserweise muss es sich nicht unbedingt um einen massiven Gegenstand handeln.
In dem Film Apollo 13 befindet sich der Astronaut Jim Lovell, gespielt von Tom Hanks, auf seiner Raumfahrtmission zum Mond in großer Gefahr. Zu Hause auf der Erde tröstet sich seine besorgte Frau mit einem alten Fersehinterview, in dem Lovell erzählt, wie er in den 1950er-Jahren als junger Marineflieger von einem Flugzeugträger zu einem Lufteinsatz über dem Japanischen Meer gestartet war. Es war Nacht, und er hatte fast keinen Kraftstoff mehr; wenn er nicht bald sein Mutterschiff ortete, blieb ihm nichts anderes übrig, als auf dem „großen schwarzen Ozean“ notzulanden. Von dem Flugzeugträger waren jedoch keine Lichter zu sehen, Lovells Radar war ausgefallen, und das Anflugfunkfeuer des Schiffs wurde unglücklicherweise von einem Lokalsender gestört.
Als Lovell die Cockpitbeleuchtung anschalten wollte, um eine Karte zurate zu ziehen, gab es in der Stromanlage einen Kurzschluss, und alle Instrumente fielen aus. Er befand sich nun in vollkommener Dunkelheit und fing an, über eine Notwasserung nachzudenken – ein riskantes Unterfangen, selbst bei Tageslicht. Es muss ein sehr beängstigender Moment gewesen sein. Als er auf das Meer hinabschaute, sah er plötzlich einen langen, leuchtenden „grünen Teppich“ aus biolumineszierendem Plankton, der das aufgewühlte Kielwasser jenes Schiffes markierte, das er suchte: „Er führte mich geradewegs nach Hause.“ Wenn Lovells Cockpitbeleuchtung nicht ausgefallen wäre, hätte er den Teppich überhaupt nicht entdeckt.
Ein paar indigene Völker haben ihre traditionellen Orientierungsmethoden noch nicht aufgegeben. Während die Seefahrer der pazifischen Inseln stets die Sonne und die Sterne nutzen, verlassen sich die Inuit im hohen Norden hauptsächlich auf Landmarken, um sich zu orientieren – aus dem einfachen Grund, dass sie nicht mit einem klaren Himmel rechnen können. In einigen Gebieten, etwa an den Küsten Grönlands, mangelt es nicht an imposanten natürlichen Gebilden, die aus großer Entfernung zu erkennen sind: Berge, Felsklippen, Gletscher und Fjorde. In Gegenden mit einem einheitlicheren Landschaftsbild errichten die Inuit jedoch eigene Wegweiser, sogenannte Inuksuk. Diese Steingebilde, die menschlichen Figuren ähneln, stehen normalerweise auf Erhebungen und geben die Richtung zu bestimmten wichtigen Orten an.
Laut Claudio Aporta, einem Kenner der Inuit-Kultur, der lange Überlandreisen in der Arktis unternommen hat, sind erfahrene Wegfinder der Inuit mit Tausenden Kilometern angelegter Pfade vertraut und können zahllose Orientierungspunkte entlang dieser Routen wiedererkennen. Vielleicht haben die Inuit ein ungewöhnlich gutes visuelles Gedächtnis, aber sie greifen auch intensiv auf ein Hilfsmittel zurück, das uns allen zur Verfügung steht – das gesprochene Wort:
Da die Inuit auf ihren Reisen oder zur Darstellung geografischer Information keine Karten verwendeten, wurde ihr riesiger Wissensschatz seit undenklichen Zeiten mündlich überliefert und durch Reisen weitergegeben.
Diese mündlichen Schilderungen stützen sich auf „genaue Begriffe zur Beschreibung besonderer Merkmale von Land und Eis, Windrichtungen, Zuständen von Schnee und Eis sowie Ortsnamen“.
Die Reisen der Inuit können extrem beschwerlich sein. Langes Ausharren bei Nebel und Whiteouts sind nicht ungewöhnlich, doch für die ältere Generation, die vor dem Aufkommen des GPS zu navigieren lernte, war „die Vorstellung, sich zu verirren oder sich nicht zurechtzufinden, ohne jede Grundlage, denn in ihrer Erfahrung, Sprache und ihrem Verständnis gab es sie schlichtweg nicht“. Diese Menschen sind vollkommen eins mit ihrer Umgebung und ziehen den größtmöglichen Nutzen aus jedem Orientierungshinweis, der ihnen zur Verfügung steht.
Das Gleiche gilt auch für die Aborigines im heutigen Australien. Sie kamen vor ungefähr 50 000 Jahren auf dem Seeweg dorthin und entwickelten, wie die Inuit, ein feines Orientierungsgeschick, das sich hauptsächlich auf Landmarken stützt. Anhand langer, komplexer Gesänge können sie weitläufigen Routen durch das Outback folgen.
Diese Gesänge helfen den Aborigines dabei, Naturmerkmale entlang ihrer Pfade wiederzuerkennen, indem sie mythologische Bilder aus der „Traumzeit“ wachrufen. Ein kompetenter (europäischer) Beobachter hat das gekonnt umschrieben: Die Orientierungsmethoden der Aborigines beruhen auf dem „Glauben an eine spirituelle Kraft, die materielle Gegenstände erfasst und ihnen eine zeitlose Bestimmung verleiht, die dem Menschen das Gefühl gibt, irgendwo hinzugehören“.
Die engen Beziehungen der Aborigines und der Inuit zu ihren heimischen Landschaften werden Stadtbewohner der westlichen Welt wohl nie begreifen können. Doch unsere eigenen entfernten Vorfahren dürften ähnliche Orientierungsmethoden angewandt haben, und es ist ein trauriger Gedanke, dass diese ein für alle Mal in Vergessenheit geraten sind. Daher ist es umso wichtiger, das Wissen jener, die noch über solch außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen, zu bewahren.
Einige Menschen sprechen Sprachen, die sie dazu zwingen, ständig zu überdenken, in welche Richtung sie gehen oder sehen. Die australischen Ureinwohner des Stammes Guugu Yimithirr in Queensland – von denen James Cook (1728–1799) offenbar das Wort „Känguru“ lernte – benutzen niemals Begriffe wie „links“ oder „rechts“. Sie verweisen ausschließlich auf die Himmelsrichtungen. Der Linguist Guy Deutscher beschreibt ihre Sprache wie folgt:
Wenn Sprecher des Guugu Yimithirr möchten, dass jemand in einem Auto zur Seite rückt, um Platz zu machen, dann sagen sie naga-naga manaayi, was „rück ein bisschen nach Osten“ bedeutet. […] Als man älteren Stammesmitgliedern auf einem Fernseher einen kurzen Stummfilm zeigte und sie dann aufforderte, die Bewegungen der Protagonisten zu beschreiben, hingen ihre Antworten davon ab, wie der Fernseher gestanden hatte, als sie den Film sahen. Wenn er nach Norden gerichtet war und ein Mann auf dem Bildschirm näher zu kommen schien, sagten die älteren Männer, der Mann „geht nach Norden“. […] Wenn Sie ein Buch lesen und dabei nach Norden blicken und ein Guugu-Yimithirr-Sprecher Sie auffordert vorzublättern, dann wird er sagen „geh weiter nach Osten“; denn die Seiten werden von Osten nach Westen umgeblättert.
Der Sprachwissenschaftler erklärt weiter:
Wenn Sie Ihre Position kennen müssen, um auch nur die einfachsten Dinge zu verstehen, welche die Leute in Ihrer Umgebung sagen, dann werden Sie die Gewohnheit entwickeln, in jeder einzelnen Sekunde Ihres Lebens die Himmelsrichtungen zu berechnen und sich an sie zu erinnern. Und da diese geistige Gewohnheit schon fast vom Säuglingsalter eingeprägt wird, wird sie dann bald zu einer zweiten Natur werden, mühelos und unbewusst.
Diese sprachlichen Eigenheiten spiegeln wohl die zentrale Rolle wider, die Orientierung im Alltag der Guugu Yimithirr einnimmt. Für ihr Überleben war es wahrscheinlich unerlässlich, sich ständig der eigenen räumlichen Ausrichtung bewusst zu sein, denn dieses Bewusstsein war und ist in der Struktur ihrer Sprache verankert.
Die sechsbeinigen Geheimnisse eines provenzalischen Gartens
Ich hege ein Faible für den französischen Insektenforscher Jean-Henri Fabre (1823–1915), seit ich seine Bücher entdeckte. Sein Hauptwerk, Souvenirs Entomologiques (Entomologische Erinnerungen, auch Erinnerungen eines Insektenforschers), dessen erster Teil 1879 erschien, wurde ein höchst ungewöhnliches verlegerisches Phänomen – ein Bestseller ausschließlich über Gliederfüßer. Fabre verfasste nicht nur einige der lyrischsten und kurzweiligsten Schilderungen des Insektenlebens, die je geschrieben wurden, sondern leitete auch bahnbrechende Studien zur Tiernavigation.
Fabre war alles andere als ein konventioneller Gelehrter, aber seine bemerkenswerte Beobachtungsgabe war gepaart mit der Neugier, Geduld und Findigkeit, die einen wahren Wissenschaftler kennzeichnen. Den Großteil seines Lebens mühte er sich damit ab, eine vielköpfige Familie mit seinem Lehrergehalt durchzubringen, während er auf Korsika und in verschiedenen Gegenden der Provence arbeitete. Es heißt zwar oft, Fabre sei Autodidakt gewesen, doch in Wahrheit unterhielt er enge Verbindungen zur Gelehrtenwelt und schloss sein Studium sogar mit einer Promotion ab. Schließlich verlegte er sich darauf, Schul- und Lehrbücher zu schreiben, um sein Einkommen aufzubessern – ein Unterfangen, das sich als einträglich erwies und es ihm erlaubte, die Lehrtätigkeit aufzugeben und sich ganz seinen Forschungsarbeiten zu widmen.
Fabre war fasziniert von den Insekten und Spinnen, die damals auf den Feldern und Hügeln der Provence bestimmt noch viel zahlreicher vertreten waren als heute. Ganz besonders begeisterte er sich für Grabwespen. Diese Parasiten legen ihre Eier in Erdlöchern ab und versorgen die daraus schlüpfenden Larven, indem sie gelähmte Beutetiere mit einlagern, von denen sich der Nachwuchs nach Belieben ernähren kann – eine makabre lebende Speisekammer. Fabre beobachtete, dass die Wespen oft überraschend lange Strecken zurücklegten, wenn sie ihre Nester mit Proviant ausstatteten; erstaunlicherweise fanden sie immer wieder zurück, auch wenn er sie etliche Kilometer weit entfernt aussetzte.
Aufgrund anderer Beobachtungen wusste Fabre, dass die beiden Fühler der Wespe eine wichtige Rolle bei ihrer Nahrungssuche spielten. Also fragte er sich, ob sich ihr Orientierungsgeschick ebenfalls auf diese Sinnesorgane stützte. Und so trennte Fabre kurzerhand die Fühler einiger Wespen ab, um zu sehen, was nun passieren würde. Überrascht stellte er fest, dass die drastische Maßnahme keinerlei Auswirkung auf die Zielfindungsfähigkeit der Wespen hatte; allerdings dürften die bedauerlichen Kreaturen hungrig geblieben sein.
Fabre konnte sich darauf keinen Reim machen, und so verlagerte er das Hauptaugenmerk seiner Forschungen auf die aggressiven Roten Gartenameisen, die auf seinem großen Grundstück lebten; diese Spezies raubt die Nester ihrer schwarzen Verwandten aus und stiehlt deren Nachwuchs. Die Roten Gartenameisen waren viel folgsamere Probanden und konnten auf den Streifzügen außerhalb ihrer Nester leichter beobachtet werden. Mit der Hilfe seiner sechsjährigen Enkelin Lucie führte Fabre eine Reihe einfacher, aber bahnbrechender Experimente durch.
Zunächst stand Lucie mit bewundernswertem Pflichteifer Wache am Nest der Roten Gartenameisen und wartete geduldig darauf, bis ein Überfallkommando ausrückte. Dann verfolgte sie die Kolonne und markierte deren Weg mit kleinen weißen Kieselsteinen, genau wie der kleine Däumling im gleichnamigen Märchen, wie Fabre bemerkte. Sobald die roten Ameisen ein Nest der schwarzen Ameisen zum Plündern gefunden hatten, lief Lucie zu ihrem Großvater und alarmierte ihn.
Fabre wusste, dass Rote Gartenameisen nach ihren Streifzügen – wenn sie ihre Beute heimbrachten – immer auf demselben Weg zurückkehrten, und er vermutete, sie ließen sich dabei von irgendeiner Art Duftspur leiten. Um diese These zu überprüfen, versuchte er mit verschiedenen Mitteln, den Geruch, dem die Ameisen möglicherweise folgten, zu tilgen oder zu überdecken. Zuerst fegte er den Boden gründlich ab. Die zielstrebigen Ameisen wurden jedoch nur kurzzeitig aufgehalten und fanden ihren Weg wieder, entweder indem sie über die abgefegten Flächen vorrückten oder diese umgingen.
Fabre vermutete, dass gewisse Spuren dem Fegen standgehalten hatten, und so richtete er einen Wasserschlauch auf den Pfad, in der Hoffnung, jeden eventuell noch verbliebenen Geruch wegzuspülen. Aber auch dieses Mal schafften es die Ameisen, an ihr Ziel zu gelangen. Das Gleiche geschah, als Fabre auf einen Teil des Weges Menthol träufelte, um die hypothetische Duftspur zu überdecken.
Nun kam Fabre der Gedanke, dass sich die Roten Gartenameisen – obwohl sie offenkundig kurzsichtig waren – vielleicht auf visuelle Hinweise stützten, anstatt ihren Weg anhand von Gerüchen zurückzuverfolgen. Möglicherweise prägten sie sich irgendwelche markanten Punkte ein. Um diese Vermutung zu prüfen, veränderte Fabre das Aussehen des Ameisenpfades, indem er zunächst Zeitungsblätter und später eine Schicht gelben Sandes darüberlegte – was sich farblich von der umgebenden grauen Erde klar unterschied. Diese Hindernisse bereiteten den Ameisen weitaus größere Schwierigkeiten, doch sie fanden trotzdem zu ihrem Nest zurück.
Fabre stellte fest, dass die Ameisen ihren Weg zu einer Beutequelle selbst nach zwei oder drei Tagen erneut verfolgen konnten, aber wenn er die Ameisen in Teile des Gartens versetzte, die sie noch nie aufgesucht hatten, waren sie orientierungslos. Von Bereichen, die sie bereits kannten, fanden sie hingegen problemlos wieder zurück.
Auf Grundlage dieser Beobachtungen kam Fabre zu dem Schluss, dass sich die Ameisen auf ihr Sehvermögen stützten und nicht auf den Geruchssinn. Fabre staunte zwar darüber, dass ein derart kleines Tier klug genug war, so vorzugehen, aber er war davon überzeugt, dass sich Ameisen an visuellen Wegmarken orientierten – wie Menschen. Seine schlichten Methoden mochten modernen Standards wissenschaftlicher Genauigkeit nicht unbedingt genügt haben, doch er war durchaus auf der richtigen Spur.
Wie Jean-Henri Fabre war auch der große holländische Feldbiologe Nikolaas Tinbergen (1907–1988) fasziniert von der Ar t und Weise, wie Grabwespen nach ihren ausgedehnten Streifzügen zielsicher zu ihren Erdlöchern zurückfanden. Zumindest in Tinbergens Augen schienen die kleinen Höhleneingänge recht unauffällig zu sein. Wie konnten die Wespen sie ausfindig machen? Er hielt es für denkbar, dass sie sich markante Punkte in der Landschaft einprägten, und so platzierte er einen Kreis von Kiefernzapfen um den Nesteingang. Als er die Zapfen heimlich woanders hinlegte, stellte er erfreut fest, dass die heimkehrenden Wespen an der neuen Stelle nach dem Nesteingang suchten.
Wurden die Wespen etwa von Zeichen jeder Größe und Form angezogen, oder wurde ihre Aufmerksamkeit von besonderen visuellen Merkmalen stärker erregt als von anderen? Um diese Frage zu beantworten, deponierte Tinbergen Markierungen unterschiedlicher Art um die Erdlöcher. Nachdem die Wespen ausgeflogen waren, schuf er zwei künstliche Eingänge, die von jeweils unterschiedlichen Markierungen gekennzeichnet waren.
Es wurde deutlich, dass dunkle, dreidimensionale Markierungen die Wespen stärker anzogen als helle und flache. Ähnliche Experimente mit Honigbienen zeigten, dass sie sich beim Wegflug von einer nektarreichen Blüte die Umgebung sorgfältig einprägen und dabei besonders auf dreidimensionale Orientierungspunkte achten. Die Bienen können sich sogar die geometrischen Beziehungen zwischen diesen Punkten zunutze machen, vor allem deren Entfernung zu einer üppigen Blüte, um wieder dorthin zurückzufinden.
„Das Buch richtet sich an alle, die mehr über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere erfahren wollen und weckt gleichzeitig die Neugier, sich intensiver mit den Geheimnissen hinter dem Sichtbaren zu befassen.“
„Ungemein unterhaltsam ... [Barrie] ist ein bewundernswert seriöser und gewissenhafter Führer durch das, was wir wissen und noch nicht wissen.“
„Eine fesselnde Untersuchung der Navigation im Tierreich“
„Eine wunderbar erfrischende Lektüre“
„Barrie vermittelt in dieser beeindruckenden populärwissenschaftlichen Arbeit meisterhaft neue Entdeckungen der Tiernavigation ... Ein Muss für jeden, der von den Wundern der Natur fasziniert ist“
„Eine wunderbare Kombination aus Wissenschaft und Reiseliteratur“
„Nur ein Segler könnte die navigatorischen Fähigkeiten von Menschen und Tieren mit einer solchen Wertschätzung, Begeisterung und Genauigkeit nachvollziehen.“
„In David Barries Buch wird die Erde zu einem ständigen Abenteuer, dem jedes Lebewesen auf seine eigene, stets verblüffende Weise gerecht wird.“
„Fundiert, erzählerisch und kurzweilig verknüpft David Barrie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Anekdoten aus eigenen Erfahrungen und Begegnungen mit Tieren und Wissenschaftlern.“
„David Barrie, der selbst mithilfe eines Sextanten über die Ozeane gesegelt ist, begeistert sich für Navigation und erzählt wunderbar detailreich von den unzähligen Weisen, in denen Tiere sich in der Welt bewegen ... ein Buch, das einem die Augen öffnet“







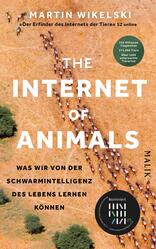







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.