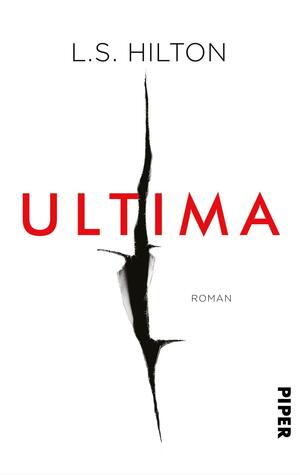
Ultima (Maestra 3) — Inhalt
Inspektor Romero da Silva ist der einzige noch lebende Mensch, der von Judith Rashleighs Taten weiß. Die Ermittlungen um ihr erstes Opfer, Cameron Fitzpatrick, sind im Sande verlaufen – doch da Silva hat sich geschworen, Judith irgendwann zu überführen. Und tatsächlich gelingt es ihm, sie aufzuspüren. Zwar kann er seine Anschuldigungen nicht beweisen, aber er hat dennoch die Macht, Judith zu zerstören. Und das wird er tun – es sei denn, Judith lässt sich auf einen gefährlichen und verruchten Deal ein …
Leseprobe zu „Ultima (Maestra 3)“
Prolog
In der Nacht vor dem Verkauf waren wir Hand in Hand durch die Stadt gegangen. London kam mir vor wie neu erstanden. Es war eine ungewöhnlich laue Nacht. Die Lichter am Embankment bildeten einen phosphoreszierenden Strom, der dem Verlauf des Flusses folgte, und die sommerschweren Bäume im St. James’s Park warfen reglose Schattenflecken, violett wie Amethyste.
Später im Schlafzimmer hing immer noch eine geisterhafte Spur von meinem Geruch an seinem Mund, als er mich küsste. Ich machte das Licht nicht an, öffnete nur das Fenster. Ich wollte die [...]
Prolog
In der Nacht vor dem Verkauf waren wir Hand in Hand durch die Stadt gegangen. London kam mir vor wie neu erstanden. Es war eine ungewöhnlich laue Nacht. Die Lichter am Embankment bildeten einen phosphoreszierenden Strom, der dem Verlauf des Flusses folgte, und die sommerschweren Bäume im St. James’s Park warfen reglose Schattenflecken, violett wie Amethyste.
Später im Schlafzimmer hing immer noch eine geisterhafte Spur von meinem Geruch an seinem Mund, als er mich küsste. Ich machte das Licht nicht an, öffnete nur das Fenster. Ich wollte die schmutzige Londoner Luft deutlich spüren, wenn sie auf die Hitze meiner Haut traf. Ich setzte mich auf sein Gesicht und spürte, wie sich die Lippen meiner Pussy über seiner Zungenspitze teilten. Langsam lehnte ich mich zurück, der Spitze seines Schwanzes entgegen. Seine Hand umfasste meinen Hals, während mein Körper sich erwartungsvoll bog, und so verharrten wir einen Moment in vollkommener Spannung, bevor er mich seitlich auf die Hüften drehte, bis meine Beine an seinem Brustkorb lagen. Er küsste die Innenseite meiner Knöchel, als er in mich hineinglitt, und begann sich dann träge zu bewegen. Seine gespreizten Finger lagen auf meinem Bauch.
„Ti amo, Judith.“ Ich liebe dich.
„Zeig es mir.“
„Wo willst du es hin haben?“
Ich wollte es überall.
„Ich will es in meiner Pussy. Ich will es in meinen Haaren, in meiner Kehle, auf meiner Haut, in meinem Arsch. Ich will jeden Tropfen davon. Ich will dich trinken. Ich will dein Sperma trinken.“
Er drehte mich noch einmal um. Ich kniete auf allen vieren und stützte die Handflächen am Kopfende ab. Dann packte er mein Handgelenk und drehte mir den Arm auf den Rücken, schob mich vorwärts in die Kissen, rammte mich mit seinem ganzen Gewicht, mit einem einzigen, schonungslosen Stoß.
Ich spreizte die Beine noch weiter und bot ihm den nassen Spalt dar, der dazwischen klaffte.
„Noch mal?“
Noch ein Stoß.
„Noch mal?“
Er setzte sich auf die Fersen und führte erst einen Finger in mich ein, dann zwei, dann drei.
„Ich möchte hören, wie du darum bettelst. Na los. Bettel um meinen Schwanz.“
„Bitte, nicht aufhören. Fick mich weiter. Bitte.“
„Braves Mädchen.“
Ich war so nass, dass ich spürte, wie sein Schwanz beim Stoßen in mich hineinglitt. Ich griff zwischen meine Schenkel, um seine festen Eier zu umfassen, während er schneller wurde, immer schneller und in mein rotes Inneres stieß, bis ich mit einem einzigen heftigen Aufkeuchen kam.
„Jetzt. Dreh dich um und mach den Mund auf.“
Später tastete ich im Dunkeln nach seinem Gesicht, küsste seine Lider, seine Mundwinkel, die süße Grube unter seinem Ohr.
„Darf ich dich was fragen?“ Mein Gesicht lag an seinem Hals, meine Lippen spürten das gleichmäßige, vertraute Pochen seines Pulsschlags.
„Alles, mein Schatz.“
„Wann genau wolltest du mich eigentlich umbringen?“
Sein Herz blieb still. Keine Anspannung, keine Reaktion. Er stützte sich auf den Ellbogen und drückte seinen Mund auf meinen. Ein Kuss mit dem warmen Versprechen eines Blutergusses.
„Morgen, meine Süße. Oder vielleicht übermorgen.“
1. Vorbereitung
1. Kapitel
Sechs Monate zuvor
Ich war noch nie in Süditalien gewesen, und wie es aussah, sollte mein Besuch nicht nur ein kurzer sein, sondern auch mein letzter. In erster Linie deswegen, weil Inspektor Romero da Silva von der Guardia di Finanza mit seiner Waffe auf mein Herz zielte. Wir standen an einem Strand irgendwo in Kalabrien, genauer gesagt auf einer Betonplattform, die in die aufgewühlte, schweflige See hinausragte. Ein rostiges Containerschiff ankerte ungefähr hundert Meter entfernt und war über einen dicken Gummischlauch mit dem niedrigen Betonbau einer Kläranlage neben uns verbunden. Ich hatte kurz überlegt, zum Schiff hinauszuschwimmen, aber da Silva hatte mir bereits erklärt, dass mich die Strömung drankriegen würde, wenn ich ihm entkam. Und ich glaubte ihm, obwohl ich in den letzten paar Stunden dahintergekommen war, dass da Silvas Fähigkeit, ein Doppelleben zu führen, mich dastehen ließ wie eine Amateurin.
Andererseits kann mich Risiko schon ganz schön reizen. Und ich sah etwas, was da Silva nicht sehen konnte. Über seiner Schulter bewegte sich ein Mann langsam und zielstrebig über den Strand auf uns zu. Ich bezweifelte, dass er ein zufälliger Passant war, denn er hatte ein Sturmgewehr in der Hand.
„Entweder machen wir hier ein Ende – oder Sie kommen mit mir zurück in die Stadt, und wir schauen, ob wir nicht eine Weile zusammenarbeiten könnten.“
Da Silvas Stimme war so ruhig wie seine Hand an der Waffe.
„Zusammenarbeiten?“, zischte ich.
In dem Moment hätte ich an alles denken können, was ich getan hatte, alles, was passiert war, was mich letztlich hierher geführt hatte, an alles, was ich gewesen, und alles, was aus mir geworden war. Tat ich aber nicht.
„Na, dann los“, sagte ich. „Tun Sie’s. Machen Sie’s einfach.“
Als der Schuss kam, sah da Silva noch überraschter aus als ich, aber es war ja auch schon das zweite Mal diese Woche, dass jemand versuchte, mich umzubringen. Allerdings kam die Kugel nicht aus da Silvas Caracal, die er immer noch auf meine Brust gerichtet hatte, sondern von hinten, vom Strand. Ohne seine Position zu verändern, wandte da Silva den Kopf, bis er die Gestalt am Fuß der Klippe sah. Der Mann hatte einen Warnschuss in die Luft abgegeben. Ich war in Versuchung, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es zumindest einer hier ernst meinte, aber es war wohl nicht der rechte Augenblick. Ich konnte ganz schwach das Schießpulver riechen, das in den stahlgrauen Dezemberhimmel stieg.
„Das Mädchen! Lassen Sie das Mädchen!“, rief der Mann.
„Können Sie schwimmen?“, zischte ich da Silva zu.
„Aber die Strömung“, antwortete er langsam. „Das mit der Strömung war kein Witz.“
„Packen Sie mich“, sagte ich. „Und stellen Sie mich vor sich. Und im Wasser halten Sie sich am Schlauch fest.“
„Und wenn er Sie erschießt?“
„Sie wollten mich doch eben auch erschießen.“
„Das Mädchen!“ Die Waffe war jetzt direkt auf uns gerichtet. Da Silva machte einen Satz nach vorn, packte mich an der Schulter und riss mich an sich, während er herumwirbelte, als würden wir tanzen. Am Ende hatten wir die Plätze getauscht, und er stand mit dem Rücken zu den heranbrandenden Wellen. Das Gewehr zielte jetzt definitiv auf mich. Immerhin eine kleine Abwechslung.
„Ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen sie loslassen!“ Der Mann mit der Waffe kam jetzt über den müllübersäten groben Kies auf uns zu. Da Silva ging hinter meinem Körper in Deckung und schlang seinen Arm um meinen Hals. Er trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Nach einem weiteren merkte ich, wie sich sein Griff lockerte. Ein zweiter Schuss krachte über meinen Kopf hinweg, und ich warf mich flach auf den Beton. Ein Platschen, dann Stille. Ich wandte den Kopf. Da Silva hatte mir eben noch erzählt, dass die Strömung mich binnen Minuten erledigen würde, wenn ich einen Fluchtversuch unternahm, aber er hatte es bis zum Schlauch geschafft. Ich konnte in der Brandung gerade noch seine Arme sehen, die den Schlauch umklammerten, während er sich daran entlanghangelte. Der Mann am Strand hatte jetzt angefangen zu rennen. Ich hatte vielleicht zwanzig Sekunden, bis er bei mir war, was für eine wohlüberlegte Entscheidung nicht ausreichte. Der Schlauch war links, und ich konnte ihn mit wenigen Schwimmzügen erreichen. Also rollte ich über die Plattform, hielt die Luft an und ließ mich ins Wasser fallen.
Da Silva hatte nicht gelogen. Die Unterströmung war so stark, dass ich sie hören konnte, ein massives, aufdringliches Glucksen in der Dünung, das sich unter die Pumpgeräusche des unter Druck stehenden Schlauchs mischte. Schon die Kälte hätte mir normalerweise den Atem verschlagen, aber die Strömung kam ihr zuvor. Meine schwere Daunenjacke, bereits zu einem durchgeweichten Leichentuch mutiert, verfing sich über meinem Kopf. Ich schlug um mich und griff ins Leere, geblendet von Meersalz und meinem panischen Zittern. Gerade noch rechtzeitig schoss ich durch die Wasseroberfläche nach oben, als die nächste Kugel angeflogen kam. Verzweifelt versuchte ich, die Biegung des Schlauchs zu fassen zu bekommen, und schaffte es, mein Bein halb darüberzuschwingen. Schleimiges Gummi presste sich gegen mein Gesicht und pulsierte im Rhythmus des darin fließenden Wassers. Ich benutzte meine Zähne, um mir die Jacke von der Schulter zu zerren und meinen rechten Arm zu befreien. Dann griff ich wieder unter den Schlauch, um mich festzuhalten, und ließ mit der Linken los, doch da traf mich eine Welle voll ins Gesicht, und das trübe Wasser riss mir das Scheißding aus den Händen.
Ich war kleiner als da Silva, und der Schlauch war zu breit, als dass auch ich mich darunter hätte entlanghangeln und gleichzeitig auch noch Luft holen können. Also musste ich mich halb nach oben ziehen und auf der Oberseite des Schlauchs entlangrobben. Immerhin konnte ich auf die Art noch etwas erkennen, doch als ich aufblickte und sah, wie der Mann vom Strand sich rittlings auf den Schlauch setzte, wo er auf die Plattform traf, und für den nächsten Schuss anlegte, wünschte ich mir, ich hätte lieber nichts gesehen. Er feuerte noch einmal, aber er hatte nicht auf mich gezielt. Wenn er so tief zielte, bedeutete dies, dass da Silva irgendwo dort hinten auf dem Wasser sein musste. Der Mann bewegte sich zögerlich vorwärts und umklammerte den dicken Schlauch mit den Oberschenkeln wie der Komantsche sein Pferd. Vom schaukelnden Schiff war nichts mehr zu sehen. Würden wir die Sache zu dritt an Deck austragen, wenn wir es bis dorthin schafften? Ich hatte nichts dabei, womit ich mich hätte verteidigen können, außer der Haarspange in der Gesäßtasche meiner Jeans, die ich gestern Nacht in Venedig angezogen hatte, als ich noch sicher war, dass da Silva mich wegen Mordes verhaften wollte. Damals, als das Leben noch entspannt gewesen war. Wenn ich genug Zeit gehabt hätte, wäre ich wehmütig geworden.
Es war eine Concorde-Spange, ungefähr zehn Zentimeter lang und leicht gebogen, damit man mit ihr einen Haarknoten feststecken konnte. Ich krümmte meine eiskalten Finger und zog sie aus der Tasche. Denk nach, Judith. Die Spange war wirklich keine Waffe, selbst wenn der Mann mit dem Sturmgewehr mich nahe genug an sich herangelassen hätte. Er hatte seinen Höflichkeitsbeitrag schon geleistet, und ich bezweifelte, dass er sich allzu viele Gedanken um Kollateralschäden machte. Ich schob mir das Ding zwischen die Zähne und robbte noch ein paar verzweifelte Meter vorwärts, dann ließ ich mich seitlich ins Wasser gleiten. Meine Beine umklammerten den Schlauch, während ich die Spange ergriff und ganz tief einatmete. Ich kniff meine vom Salz schmerzenden Augen zu, tastete mit der linken Hand nach den starren Kanten des Schlauchs, dann rammte ich die Spange in die dicke Gummiwand. Sie drang problemlos ein. Ich packte sie, so fest ich konnte, und riss sie wieder heraus.
Der Schlauch schlug heftig nach rechts aus wie der Schwanz einer riesigen Klapperschlange, als das Wasser unter Hochdruck herausschoss. Ich wurde für einen Moment an die Oberfläche geschleudert, bevor mich die nächste Welle wieder nach unten wirbelte. Ich versuchte, meine Arme um den Schlauch zu schlingen, aber er war zu dick und ich rutschte überall ab. Noch einmal peitschte er zur Seite und warf mich ganz ab. Mit ein paar Schwimmzügen arbeitete ich mich wieder an die Oberfläche, um Luft zu holen, aber ich spürte die ganze Zeit diesen hartnäckigen Sog unter mir, der mich zum tobenden Schlauch hinzog.
Der Mann mit der Waffe war nirgends zu sehen. Keuchend trat ich Wasser und hustete brennendes Salzwasser aus. Das Containerschiff war immer noch um die fünfzig Meter entfernt, aber die Strömung zog mich bereits mit besorgniserregender Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung. Ich schaukelte hilflos auf dem Wasser. Jeder Schwimmversuch war müßig, ich war so erschöpft und durch meine nasse Kleidung zusätzlich so eingeschränkt, dass ich mich nur noch treiben lassen konnte. Mich einfach eine Weile mittreiben lassen. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie seltsam es war, dass mir gar nicht mehr kalt war, als ich meinen Kopf ins tiefe, gleichgültige Wasser sinken ließ.
„Hier! Hier drüben!“
Ich wunderte mich, warum ich den Motor des Dingis nicht gehört hatte, aber da Silvas Stimme wurde von dem rauschenden Muschelschalengesang in meinem Kopf fast verschluckt. Seine Schreie drangen durch die seltsam sanfte Stille. Warum konnte er nicht einfach aufgeben, mich einfach allein lassen? Zumindest diese Genugtuung konnte ich ihm nehmen. Ich hörte auf, meine Beine zu bewegen, und ließ mich hinabgleiten in die wiegende Umarmung der See.
Es war dunkel, als ich die Augen wieder aufschlug. Offenbar war es inzwischen Nacht – die Wolken waren dunkelgrau und gaben immer wieder einen kurzen Blick auf den Halbmond frei. Die Kälte hatte mich aufgeweckt. Mein ganzer Körper zitterte in meinen pitschnassen, vom Salzwasser steifen Sachen, meine Zähne klapperten wie ein aufziehbares Kinderspielzeug. Ich schien auf den Holzplanken des Dingis zu liegen, das jedes Mal, wenn es über eine Welle hüpfte, schmerzhaft gegen meinen Rücken schlug. Das Brummen des Motors bohrte mir Eiszapfen in die pulsierenden Ohren. Eine Reihe von LED-Lichtern im Heck beleuchteten da Silva, der seelenruhig am Ruder saß. Einen Augenblick überlegte ich, ob das vielleicht schon die Hölle sein mochte – war ich etwa dazu verurteilt, in Gesellschaft von da Silva für immer und ewig auf dem Styx zu kreuzen? –, aber der Schmerz in meinen Oberschenkeln und der heftige Durst in meiner Kehle legten die enttäuschende Vermutung nahe, dass ich immer noch im Reich der Lebenden weilte. Ich versuchte mich aufzusetzen und schlug mir den Kopf an der Sitzbank an. Da Silva drehte sich um, als er das Geräusch hörte.
„Es geht Ihnen also gut.“
Mein nackter rechter Arm war ungemütlich über meinem Kopf ausgestreckt. Als ich versuchte, ihn zu bewegen, spürte ich, dass mein Handgelenk von Metall umklammert wurde, das über meine nasse Haut schürfte. Da Silva hatte mich mit Handschellen an der Unterseite der Bank befestigt.
„Neben Ihnen steht was zu trinken.“
Meine tastende Linke fand eine Plastikflasche. Das Evian schmeckte mir besser als ein 73er Lafitte.
„Arschloch“, bemerkte ich im Konversationston.
„Warum?“
„Ich hab Ihnen vorhin das Leben gerettet. Der hätte Sie erschießen können. Und er hätte mich an Ihrer Stelle umlegen können!“
„Immerhin hab ich Sie gerettet, oder?“
Ich musste zugeben, dass das eine gewisse Logik hatte.
„Wo fahren wir hin?“
„Halten Sie den Mund.“
„Mir ist kalt.“
„Halten Sie den Mund.“
Ich streckte meine schmerzenden Beine aus, so weit es ging, aber zwischen da Silva und meinen Füßen blieb immer noch ein solider Abstand. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, ihn über Bord zu kicken, konnte ich mit diesen Handschellen auf keinen Fall die Ruderpinne erreichen. Und dann? Dann hatte ich kein Geld, kein Telefon, keinen Ausweis. Wenn ich Land erreichte, wo immer das auch sein mochte, durfte ich wahrscheinlich die gut tausend Kilometer zurück in meine Wohnung in Venedig trampen. In der momentan noch eine Leiche lag. Nicht gerade der verlockendste Gedanke. Außerdem fühlte ich mich schrecklich: Mir war übel, weil ich so viel Salzwasser geschluckt hatte, meine Glieder taten weh, und bei der Dezemberkälte fror ich in meiner nassen Kleidung. Hier saß ich also mitten im Nirgendwo mit einem korrupten italienischen Polizisten, der mich vor ein paar Stunden noch hatte erschießen wollen und der überdies selbst mit einer Schusswaffe gejagt wurde, wie es aussah. Nette kleine Verschnaufpause.
„Was ist das für ein Boot?“
„Hab ich mir geliehen. Von dem Containerschiff. Ich hatte keine Zeit, um Erlaubnis zu fragen, ich hab es einfach losgemacht.“
„Haben Sie gesehen, was mit unserem Freund passiert ist?“
„Ich hab Ihnen doch von der Strömung erzählt. Der stellt jetzt kein Problem mehr dar. Und im Übrigen – ich glaube, ich hatte Sie gebeten, die Klappe zu halten, oder?“
„Ich muss pinkeln“, jammerte ich.
„Dann pinkeln Sie sich in die Hose, ich werd Sie ganz sicher nicht losmachen.“
„Sehr charmant.“
„Ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen den Mund halten.“
Mir schien nicht viel anderes übrig zu bleiben, als die dahinjagenden Wolken zu beobachten, die sich über die Schwärze erstreckten wie ein Spinnennetz. Als ich das satthatte, beobachtete ich da Silva. Und als ich das satthatte, schlief ich wieder ein.
Das zweite Mal erwachte ich vom Knirschen des Bootes, das auf den Strandboden gezogen wurde. Da Silva beugte sich über mich, wobei er sich netterweise mit seinem ganzen Gewicht auf meinen Bauch kniete, während er die Handschellen aufmachte. Schritte auf dem Kies verrieten mir, dass wir nicht allein waren, obwohl mir da Silvas Brust die Sicht versperrte.
„Sie können das Boot ins Wasser schieben.“ Er klang ganz ruhig, aber ich roch das Salz auf seiner Haut und den Schweiß darunter. Er hatte Angst.
„Aufstehen.“
Vorsichtig richtete ich mich auf. Das Heck des Dingis schwankte immer noch auf den Wellen. Hände griffen unter meine Achseln und hoben mich hoch, während ich in die Dunkelheit spähte und versuchte, ein Gesicht zu erkennen, doch sowie meine Füße den Kies berührten, band man mir ein Tuch um die Augen, so schnell und professionell, dass ich gleich wusste: Schreien war zwecklos.
„Ihr beiden führt sie. Ich geh hinterher.“ Da Silva sprach kein Hochitalienisch, sondern einen südlichen Dialekt, den ich kaum verstand.
Man fasste mich rechts und links am Ellbogen.
„Hier entlang, Signorina.“ Fisch und Zwiebeln im Atem des Sprechers. Meine erfrorenen Beine protestierten, als ich den steilen Strand hochstolperte.
„Einen Moment. So.“ Die Stimme von Fischatem war nüchtern und pragmatisch, als hätte er das schon oft gemacht. „So, und jetzt ins Auto steigen. Genau. Attenzione alla testa.“
Weiches Leder gab unter meinem zerschlagenen Rücken nach. Fischatem beugte sich herüber und schnallte mich an, während sich das Auto unter dem Gewicht der anderen Männer bewegte. Wärme – wonnige, tiefe, luxuriöse Wärme. Wenn sie es jetzt über die Bühne bringen würden, dachte ich, könnte ich geradezu glücklich sterben.
Anfangs versuchte ich noch, die Sekunden zu zählen, als wir losfuhren, um abschätzen zu können, wie weit wir uns vom Meer entfernten, aber ich gab bald auf. Anti-Kidnapping-Strategien waren hier definitiv fehl am Platz – es gab ja doch niemanden, dem ich wirklich wichtig war und dem sie mein abgeschnittenes Ohr hätten schicken können. Wahrscheinlich brachten sie mich an irgendeinen stillen Ort auf dem Land, wo sie mich erschießen und meine Leiche in einen Graben werfen würden.
„So, raus mit Ihnen.“ Da Silvas Stimme, als der Motor ausging. Wir wiederholten die umständliche Prozedur mit dem geduckten Ein- und Aussteigen. Fischatem hatte dabei die ganze Zeit die Hand auf meinem Kopf.
„Hier rüber.“
Angst tobte in meiner Brust. Ich musste all meine verbliebenen Kräfte aufbieten, um den wilden Impuls zu unterdrücken, einfach wegzurennen. Dann hörte ich, wie eine Tür aufgeschlossen wurde, und er schob mich ein paar Schritte vorwärts. Deutliches Klicken. Ich fuhr unwillkürlich zusammen, aber sie hatten nur das Licht angeschaltet, ich merkte es an der leichten Veränderung der Schwärze unter meiner Augenbinde.
„Bleiben Sie da stehen“, befahl da Silva. „Wenn Sie hören, dass die Tür zugeht, können Sie die Augenbinde abnehmen – aber nicht vorher, okay?“
Ich brachte ein Nicken zustande. Wieder Schritte, quietschende Angeln, das Zuknallen einer Tür, Aufflammen einer nackten Glühbirne.
Der Raum sah aus wie eine Garage oder ein Schuppen – Sichtbetonwände, staubiger Zementboden, keine Fenster. In einer Ecke ein versiffter blauer Schlafsack, daneben standen ein Eimer und ein Plastikgartenstuhl, auf dem ein verblüffend ordentlich gefaltetes Handtuch und ein Herrenhemd lagen. Auf dem Boden neben dem Stuhl befand sich ein geblümter Porzellanteller mit einem belegten Brot und einer Orange. Eine Zweiliterflasche Wasser. Sonst absolut nichts. Ein paar Minuten stand ich schlotternd an der Wand und lauschte angestrengt nach Geräuschen, die ihre Rückkehr angekündigt hätten. Als ich zu guter Letzt sicher war, allein zu sein, kauerte ich mich hin, schlang das Sandwich in gierigen Bissen hinunter und trank dazu große Schlucke Wasser, um die Brot- und Schinkenbrocken durch meine salzzerkratzte Kehle zu spülen. Ich wusste nicht mehr, wann ich zum letzten Mal gegessen hatte – vor zwei Tagen? Als ich aufgegessen hatte, nahm ich eine Handvoll Wasser, um die brennenden Salzkrusten von meinem Gesicht zu waschen. Dann zerrte ich mir die nasse Jeans von den Beinen und zog das Hemd über. Die Orange wollte ich mir für später aufheben. War doch immer schön, wenn man sich auf etwas Leckeres freuen konnte.
Ich lief ein paar Runden auf dem Zementboden, um die Müdigkeit aus meinen Knochen zu verjagen, aber damit war das Unterhaltungsprogramm für diesen Abend wohl durch. Als ich an der verschlossenen Tür lauschte, hörte ich gar nichts, weder das Klicken eines Feuerzeugs noch eine gedämpfte Unterhaltung oder das ungeduldige Hin- und Herschlurfen wartender Füße. Die Tür hatte auf der Innenseite keine Klinke. Ich schlug mit den Handflächen gegen die Tür und lauschte dem Geräusch des strapazierten Schlosses. Wo immer ich gerade sein mochte – sie hatten mich erst mal allein gelassen.
Langsam schälte ich mir die Orange, zerteilte sie und setzte mich auf den Boden. Würden sie sich überhaupt die Mühe machen, mir zu essen zu geben, wenn sie vorhatten, mich zu töten? Wer waren „sie“ überhaupt? Schätzungsweise da Silvas Kollegen, aber sicher nicht die mit der Uniform der Guardia di Finanza. Ich war nicht allzu angetan von dem Schlafsack, kuschelte mich aber trotzdem in seine muffige Wärme und rollte mich in einer Ecke zusammen wie eine Larve. Die nackte Glühbirne verbrannte die staubigen Schatten in den Zimmerecken.
Mein Gehirn schwankte zwischen Erschöpfung und Aufmerksamkeit, taumelte zwischen Schlaf und Wachen hin und her. Während ich döste, gönnte mir mein Unterbewusstsein eine Montage der letzten Tage – Alvin Spencers Skelett, das in meiner Wohnung in Venedig auf den Boden fiel, da Silvas Fragen auf der Polizeistation, die lange, schweigende Autofahrt am Rückgrat Italiens entlang nach Süden. Beim Aufwachen versuchte ich, meine Gedanken sinnvoll zu ordnen, aber als Cameron Fitzpatrick mit einem Bündel blutgetränktem Leinen in der Hand durch die Tür spaziert kam, wurde mir klar, dass ich immer noch mitten in einem fiebrigen Traum steckte. Fitzpatrick war tot. Das wusste ich, weil ich ihn umgebracht hatte, vor Jahren, in Rom. Und da Silva war auch dort gewesen. Ich sah ihn in seinem Dingi, wie er unter einem schwarzen Traumhimmel dahinnavigierte, dessen Wellen ins schwappende Wasser einer Badewanne übergingen, das zart nach Mandeln roch und mich sanft, ganz sanft nach unten zog …
Mein eigenes heiseres Keuchen weckte mich. Ich lag stocksteif auf dem Zementboden im monoton gleißenden Schein der Glühbirne. Im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, ob Minuten oder Tage vergangen waren. Eine ganz schwache Linie aus Licht war unter der Tür zu sehen. Ich rutschte in Raupenmanier im Schlafsack hinüber, holte mir das Wasser und hievte mich in eine sitzende Position.
Ich hatte geglaubt, ein Spiel zu spielen, dessen Regeln ich selbst gemacht hatte. Doch dieses Spiel war in ein anderes verwoben, das schon lange vorher gestrickt worden war und dessen Fäden zwar unsichtbar sein mochten, deswegen aber nicht weniger bindend waren.
Ich schälte mich aus dem Schlafsack, schüttelte meine Gliedmaßen, versuchte meinen benebelten Kopf zur Konzentration zu zwingen. Ein leises trippelndes Geräusch ließ mich zusammenfahren. Eine Ratte? Oder war es am Ende ein Skorpion? Aber es war nur ein Käfer mit einem fetten, ölig glänzenden Panzer, so groß wie mein Daumen, der mit den Flügeln ohne Sinn und Verstand gegen die Betonwände schlug. Ich beobachtete ihn so lang, dass es mir vorkam wie Stunden, bis er zu Boden fiel, in einer schwächlichen Komödienvorstellung mit den Beinen zappelte und zu sterben schien. Vorsichtig schnipste ich gegen den spröden Panzer. Nichts. Irgendwie belebte mich das wieder. Ich riss ein Stück von dem Papier ab, in dem mein Brot eingewickelt gewesen war, nahm das Insekt auf und legte es in die Zimmermitte. Dann zupfte ich die Orangenschale in kleine Stückchen. Mein Haar war eine einzige meerwasserverfilzte Matte. Ich riss an einer Haarklette, bis sie sich löste, und band sie um ein Stück Schale. Judith. Dann legte ich sie neben den Käfer, der da Silva darstellen sollte. Romero da Silva. Der die ganze Zeit da gewesen war. Da Silva war ein Bulle. Da Silva war ein Ganove. Er hatte mich hierher nach Kalabrien gebracht. Warum? Ich arrangierte weitere Stückchen Orangenschale um den Käfer wie die Zahlen auf einer Uhr. In jedes Stück ritzte ich mit dem Fingernagel einen Anfangsbuchstaben. Hier war Rupert, mein alter Chef, Leiter der Abteilung für Britische Malerei im Auktionshaus in London, in dem ich als junge Kunsthistorikerin meine berufliche Laufbahn begonnen hatte. Und hier – ich kratzte den nächsten Buchstaben ins nächste Stück Orangenschale – war Cameron Fitzpatrick, der Kunsthändler. Rupert und Fitzpatrick hatten einen Plan geschmiedet, wie sie das Auktionshaus durch den Verkauf eines gefälschten Gemäldes betrügen konnten, das ich wiederum gestohlen hatte, nachdem Rupert mich gefeuert und ich Fitzpatrick umgebracht hatte. Ich nahm das F aus dem Kreis heraus. Fitzpatrick hatte mit einem Mann zusammengearbeitet, den ich unter dem Namen Moncada kennengelernt hatte und der mithilfe einer italienischen Bank Fälschungen vertrieb. Eifrig legte ich neben das M noch ein Stück Schale und ritzte ein C hinein. C wie Cleret. Renaud Cleret. Da Silvas Kollege bei der Polizei. Ich hatte Cleret umgebracht. Mit einem Fingerschnipsen schoss ich ihn aus dem Kreis heraus.
Und dann? Jetzt war ich hellwach, zielstrebig. Ich war nach Venedig gezogen und hatte mir eine neue Identität zugelegt. Judith Rashleigh verschwand. Ich wurde Elisabeth Teerlinc, Kuratorin und Inhaberin der Gentileschi Gallery. Vorsichtig zog ich einen Faden aus meinem in Auflösung begriffenen T-Shirt und band es um das Judith-Schalenstück. Dann die nächste, K wie Kazbich. Moncada hatte Geschäfte mit Kazbich und seinem Mitverschwörer Balensky gemacht. Noch ein Stück. Die beiden hatten auf dem Kunstmarkt Geld aus Waffengeschäften gewaschen. Ich schnipste Moncada und Balensky aus dem Kreis. Beide waren mittlerweile tot. Wirklich schade. Wer war jetzt noch übrig?
Eine Feder aus dem Schlafsack gab ein kleines Fähnchen für einen Neuzugang ab: Yermolov. Pavel Yermolov, ein wohlhabender russischer Kunstsammler. Kazbich hatte versucht, ihm einen Caravaggio zu verkaufen. Zumindest behauptete er, dass es ein Caravaggio war. Yermolov und ich hatten die Verbindung zwischen Kazbich, Moncada und Balensky aufgedeckt. Danach hatte ich Yermolov den Ring überlassen. Allerdings war ich völlig blind für die Gegenwart von da Silva gewesen, der in der Dunkelheit neben mir hergeschlichen war. Er hatte mich die ganze Zeit beobachtet.
Murmelnd wie eine Voodoo-Priesterin saß ich vor meinem kleinen Abfallhäufchen. A für Alvin Spencer. Alvin war … im Weg gewesen. Ein Bummler in der Kunstwelt, mit Verbindungen zum Auktionshaus. Ein bisschen zu neugierig, was meine Person betraf. Also musste er abtreten, nur hatte ich irgendwie die Beweise nicht so richtig vernichten können. Ich hob die Schale auf und legte sie neben den toten Käfer. Da Silva hatte die Sache mit Alvin herausgefunden und so getan, als würde er mich dafür verhaften. Allerdings hatte er mich dann doch nicht verhaftet. Ich legte mich hin und musterte das Mosaik aus den vielen kleinen Fetischen.
Da Silva wollte, dass ich für ihn arbeitete. Das hatte er am Strand gesagt. Und wenn ich mich weigerte? Wahrscheinlich wäre es hier einfacher als in Venedig, mich verschwinden zu lassen. Offensichtlich hatte da Silva Verbindungen, denen er vertrauen konnte – die Männer, die mich hergebracht hatten, wo auch immer dieses „hier“ sein mochte. Mafia. Da meine Beine nicht in Bestform waren, stand ich nicht auf, sondern rutschte über den Boden zu den Orangenschalen und ordnete sie noch einmal rund um den Käfer an. Moncada war Mafioso gewesen, Kazbich und Balensky waren ebenfalls mit der Mafia verbunden. Da Silva war der Missing Link gewesen. Ich ließ mein Orangenschalenvolk näher an den Käfer heranwatscheln, albern wie ein kleines Kind, das mit Lego spielt.
So oder so hatte ich einiges über die Mafia gelernt. Obwohl es immer noch viele mächtige Leute in Italien gab, die ihre Existenz leugneten. Vor etwa zwanzig Jahren war der Erzbischof von Palermo in einem Mafia-Prozess verhört worden. Als man ihn danach fragte, was die Mafia sei, erwiderte er, das sei doch der Name eines Waschmittels. Wie sich später herausstellte, hatte die Kirche in Sizilien enge Verbindungen zu den Cosa-Nostra-Bossen. Ein solch offizielles Leugnen des organisierten Verbrechens zeigte nur das Ausmaß, in dem es den italienischen Staat selbst durchdrungen hatte. Wenn ein Bischof so beeinflusst werden konnte, warum dann nicht auch ein Polizist? Das würde die Leichtigkeit und Unauffälligkeit erklären, mit der da Silva mich hierher bringen konnte – aber wenn er so mächtige Verbindungen hatte, wer war dann der Mann am Strand, der Mörder, dessen Leiche gerade in langsamen Spiralen auf die apulische Küste zutrieb?
In dem Moment ging mein eingeweichter Verstand in die Knie, und ich schlief wieder ein, diesmal richtig tief. Als ich aufwachte, war das Licht unter der Tür verschwunden.
Ich lag auf der Seite, den Kopf auf den Schlafsack gebettet. Ich musste wieder weggetreten sein. Es war noch kälter als zuvor. Nacht. Das Gefühl einer dickeren, weicheren Stille in der unsichtbaren Welt jenseits meiner Zelle. Mein Blick wanderte über mein provisorisches Modell, dessen Umrisse nur für meine Augen sinnvoll waren. Ein Brotbröckchen lag neben dem Kreis. Ich drückte es zusammen und rollte es zwischen den Fingern, bis es formbar war. Ich machte einen Kopf, deutete einen winzigen runden Körper an. Katherine. Meine Schwester Katherine.
Auf dem Polizeirevier in Venedig hatte ich gestanden, Alvin Spencer getötet zu haben – was blieb mir auch anderes übrig, nachdem seine Leiche auf einem Sessel in meiner Wohnung saß? Ich hatte ihn nicht verschwinden lassen und die Spuren verwischen können. Und als da Silva mich nach dem Grund gefragt hatte, konnte ich nur an meine kleine Schwester Katherine denken, die gestorben war. In einer Badewanne, die nach Mandeln duftete.
Ich dachte nie an Katherine. Das konnte ich mir nicht erlauben. Denn wenn ich das tat, wirbelten meine Erinnerungen durcheinander und trübten sich, milchig wie das Mandelöl, als es aufs Wasser traf. Du weißt, was du getan hast. Aber es war nicht deine Schuld. Es war nicht deine Schuld, oder? Deine Mutter war schuld.
Hastig sammelte ich die vielen Teilchen zusammen, stolperte durchs Zimmer und warf sie in den Pisseimer, wo sie hingehörten. Der Käfer schaukelte träge auf dem ganzen Dreck.
Ich kann nicht sagen, wie viel Zeit verging, während ich in diesem Raum saß, aber ich glaube, es waren drei Tage. Als ich das zweite Mal wach wurde, hörte ich ein Klopfen an der Tür hinter mir. Eine Stimme, in der ich Fischatems starken Akzent erkannte, forderte mich laut auf, mich in die Ecke zu stellen, das Gesicht zur Wand zu drehen und die Augenbinde wieder anzulegen. Hastig gehorchte ich. Drei Riegel öffneten sich quietschend, bevor er eintrat. Er sprach kein Wort, aber ich hörte, wie er das Zimmer durchquerte und etwas abstellte, dann das leichte Platschen, als er den Eimer hochhob. Ich freute mich, dass er das machen musste, es war eine Demütigung für ihn. Die Tür ging auf und wieder zu, und in diesem kurzen Augenblick versuchte ich, Abgase oder Olivenblätter zu riechen, Dünger oder den Duft von Brot – irgendeinen Geruch, der mir verraten würde, wo ich sein könnte. Aber alles, was ich roch, war Staub. Wieder klickten die Schlösser, dann ließ mich seine Stimme wissen, dass ich die Augenbinde wieder abnehmen konnte. Ich rannte zur Tür und lauschte, hörte seine sich entfernenden Schritte und dann ganz leise das Geräusch eines anspringenden Autos.
Meine Verpflegung bestand aus der nächsten Flasche Wasser, einer Packung Feuchttüchern, wieder einem Schinkenbrot, einer Packung Schokoladenkekse, einem kleinen zerfransten Handtuch, einer Banane und einem Erdbeerjoghurt. Kein Löffel. Ich versuchte, mich zu waschen, und zog wieder meine feuchte Jeans an, die mittlerweile einen leicht modrigen Geruch annahm. Dann wickelte ich mich in den Schlafsack und verzehrte langsam das Essen, wobei ich jeden Bissen bewusst genoss. Eine Kippe wäre ganz nett gewesen, aber ein bisschen Entgiftung konnte mir sicher auch nicht schaden. Ich säuberte meine Zähne mit einem Feuchttuch und der körnigen Innenseite der Bananenschale.
Die Prozedur wiederholte sich am folgenden Tag. Ich vertrieb mir einige Zeit, indem ich im Zimmer im Kreis ging und Liegestütze und Strecksprünge machte, um mich warm zu halten. Den Rest verbrachte ich mit der minutiösen Planung meiner Flucht. Das Plastik des Joghurtbechers war zu dünn, um eine provisorische Klinge daraus zu basteln, aber vielleicht könnte ich ja hinter der Tür warten, Fischatem den Eimer über den Kopf ziehen und hinausflitzen, während er sich meine Pisse aus den Augen wischte. Seine Schritte hatten sich so angehört, als würde er zu seinem Auto bergab nach links gehen, also könnte ich nach rechts rennen – aber wohin genau? Selbst wenn Fischatem unbewaffnet war, konnte ich nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass er allein war. Außerdem hatte ich nicht mal Schuhe, denn die Sneakers, in die ich in Venedig geschlüpft war, hatte ich im Meer verloren.
Angenommen, dieser Schuppen, oder was auch immer das sein mochte, stand an irgendeinem entlegenen Ort, was relativ wahrscheinlich war, da es rundherum so still war – wie weit würde ich dann kommen, wenn mich ein oder mehrere Männer über unebenes Terrain verfolgten, von denen einer nach einem Bad in meiner Scheiße gerade ziemlich wütend sein dürfte? Konnte ich Fischatem mit meiner Augenbinde erwürgen? Es wäre nicht mein erster Versuch, aber ich hätte weder die Kraft noch den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Und im Vergleich zu Alvin Spencer, der in meiner Badewanne in Venedig das Zeitliche gesegnet hatte, war Fischatem definitiv ein Profi.
Die andere Option bestand darin, Fischatem nackt zu begrüßen und mir meine Freiheit mit Sex zu erkaufen. Selbst ohne Spiegel war mir klar, dass ich nicht besonders sexy aussah, aber auch ein stinkender Fick ist immer noch ein Fick, und Fischatem selbst schien sich ja auch nicht allzu viele Gedanken um seine persönliche Hygiene zu machen. Doch selbst wenn ich alle Register zog, bezweifelte ich, dass ich ihm mit meiner Pussy so das Hirn vernebeln konnte, dass er da Silva verriet und mich freiließ. So unterhaltsam diese Vorstellung auch sein mochte – der Plan war scheiße. Wenn da Silva mich tot sehen wollte, hätte er mich längst umbringen lassen. Hatte er nicht erwähnt, dass ich für ihn arbeiten sollte? Offenbar verfügte ich über etwas, was er immer noch wollte, etwas, was ich konnte, obwohl der Wert bis jetzt nur mit belegten Broten und Bananen bemessen wurde.
Aber ich war schon immer der Meinung gewesen, wenn man beschlossen hat, unglücklich zu sein, gibt es keinen Grund, warum man sich dabei nicht nach Kräften amüsieren sollte. Deswegen machten mir diese Tage in Gefangenschaft sehr viel weniger aus, als man hätte erwarten können. Da ich nichts zu befürchten hatte, tat ich mir mit Furcht auch keinen Gefallen. Ich beschloss einfach, keine zu haben. Die Stunden zogen sich, aber da es keine Notfälle gab, auf die ich reagieren musste, hatte die Zeit eine geradezu hypnotische Qualität, die noch wuchs, während die Stunden verstrichen – eine angenehme Dumpfheit, wenn nicht gar Frieden. Ich schlief, machte Gymnastik und konjugierte russische Verben, und wenn ich das nicht tat, dachte ich über Gemälde nach. Ich hatte von Gefangenen gehört, die Gedichte oder Bibelpassagen aufsagten, um sich ihre geistige Gesundheit zu bewahren. Ich schritt im Geiste durch die National Gallery in London, den Ort, an dem ich zum ersten Mal richtige Gemälde gesehen hatte.
Am häufigsten kehrte ich in meiner Erinnerung zu Cézannes Avenue at Chantilly zurück. Ich hatte es oft angeschaut, die Komposition ganz in Grün, nur ein Pfad in einem Wald, zweigeteilt durch eine Holzschranke, am Boden staubige Erde, im Hintergrund niedrige weiße Gebäude und der reine orange Ball einer aufgehenden oder untergehenden Sonne. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein stilles, vielleicht sogar phlegmatisches Gemälde, aber dann merkt man, wie keck das Spiel des Lichts eingefangen ist, dass die Blätter von den Atemzügen des Betrachters zu flattern scheinen. So still und zugleich so lebendig.







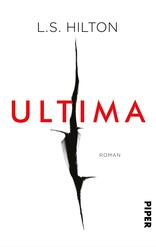



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.