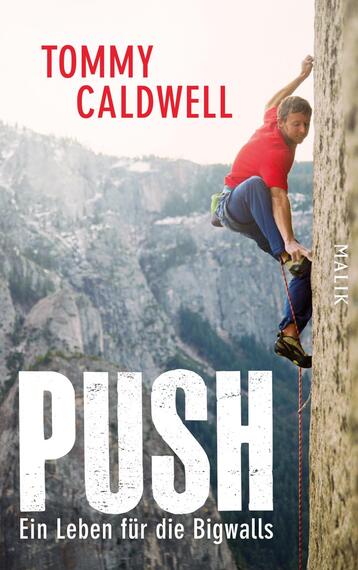
Push - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Seinen Weg beschreibt Caldwell detailreich und offen.“
Frankfurter allgemeine Zeitung - MagazinBeschreibung
Er zählt zur Weltspitze im Sportklettern und ist einer der besten Allrounder der Szene. 2015 gelang es Tommy Caldwell zusammen mit Kevin Jorgeson, die „Dawn Wall“, die mit 1000 Metern wohl härteste Steilwand überhaupt, in 19 Tagen frei zu klettern – eine sensationelle Leistung, zu der selbst Präsident Obama gratulierte. Im Jahr zuvor wurde er für die mit Alex Honnold gelungene „Fitz Traverse“ mit dem Piolet d’Or ausgezeichnet. Mitreißend berichtet der 39-Jährige im vorliegenden New-York-Times-Bestseller von der Faszination des Freikletterns. Er schildert die traumatische Geiselnahme, in die er…
Er zählt zur Weltspitze im Sportklettern und ist einer der besten Allrounder der Szene. 2015 gelang es Tommy Caldwell zusammen mit Kevin Jorgeson, die „Dawn Wall“, die mit 1000 Metern wohl härteste Steilwand überhaupt, in 19 Tagen frei zu klettern – eine sensationelle Leistung, zu der selbst Präsident Obama gratulierte. Im Jahr zuvor wurde er für die mit Alex Honnold gelungene „Fitz Traverse“ mit dem Piolet d’Or ausgezeichnet. Mitreißend berichtet der 39-Jährige im vorliegenden New-York-Times-Bestseller von der Faszination des Freikletterns. Er schildert die traumatische Geiselnahme, in die er im Jahr 2000 in Kirgisistan verwickelt wurde, und gewährt persönliche Einblicke: wie sein Vater ihn mit Fanatismus an den Extremsport heranführte, wie er den Verlust seines linken Zeigefingers verkraftete und wie die Geburt seines ersten Kindes sein Verständnis von Verantwortung und Risikobereitschaft verändert hat.
Über Tommy Caldwell
Aus „Push“
Wind
30. Dezember 2014. Tag vier des siebten Jahres in der „Dawn Wall“. 350 senkrechte Meter Freikletterei liegen unter uns, 550 haben wir noch vor uns.
Aus einem Kilometer Entfernung hören wir den Wind heranrasen – ein Dröhnen in der Dunkelheit, gemischt mit einem schrillen Heulen. Das Geräusch schwillt an, übertönt alles andere. Wir kauern an der Wand wie Wasserspeier, die Beine in den Schlafsäcken, den Rücken an den Fels gepresst. Kevin, mein Kletterpartner, klammert sich an einen der Gurte unseres Hängezelts und lächelt gezwungen. Ich kann von seinen Lippen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Caldwell erzählt unterhaltsam und spannend. (…) Für Anhänger des Klettersports und solche, die es werden wollen.“
Donaukurier„Es ist sicher eines der besten Bergbücher der letzten Jahre. (...) Ein Highlight des Lesesommers.“
DAV-Magazin "Panorama"„So packend er die Fortschritte in der ›Dawn Wall‹ schildert, sind sie doch vor allem ein Rahmen, um sein ganzes Leben zu erzählen.“
Allmountain„Seinen Weg beschreibt Caldwell detailreich und offen.“
Frankfurter allgemeine Zeitung - Magazin








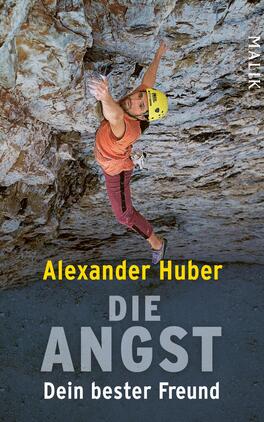
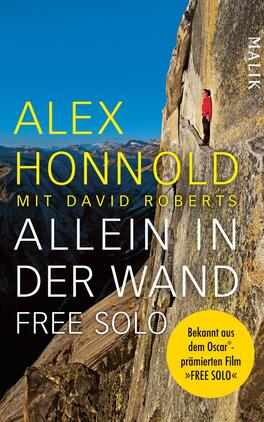


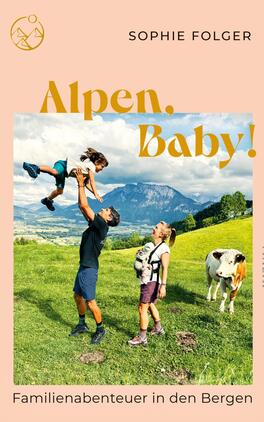





Die erste Bewertung schreiben