
Phantom (Solveigh-Lang-Reihe 4) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Sie verwenden kein Telefon, kein Internet, keine Banktransaktionen. Niemand weiß, wer sie sind, sie hinterlassen keine Spuren. Sie sind ein Phantom. Solveigh Lang von der Europapolizei ECSB und Kriminalhauptkommissar Paul Regen sind auf der Jagd nach einer Gruppe gewaltbereiter Terroristen, die sich allen modernen Ermittlungstechniken entzieht. Sie müssen ihre Arbeit vollkommen neu erfinden. Und dabei dürfen sie keine Zeit verlieren, denn der nächste Anschlag steht unmittelbar bevor …
Weitere Titel der Serie „Solveigh-Lang-Reihe“
Über Jenk Saborowski
Aus „Phantom (Solveigh-Lang-Reihe 4)“
Prolog
Frankfurt, Deutschland
18.01.2014, 17.22 Uhr
Hadi Farhan wischte mit dem Tuch aus der blau gekennzeichneten Verpackung über die blanke Edelstahlfläche und beobachtete den roten Streifen am Horizont mit Sorge. Das Ambulanzzimmer war klein, aber es gab viele Flächen unter den Schränken und immer die Gefahr, dass jemand hereinplatzte. Hadi beeilte sich mit den Schranktüren und widmete sich danach dem Boden. Der Feudel schwang fröhlich über das graue Linoleum. Er machte seine Arbeit gerne, obwohl ihnen der Schichtleiter fast monatlich neue Zeitvorgaben machte, die [...]



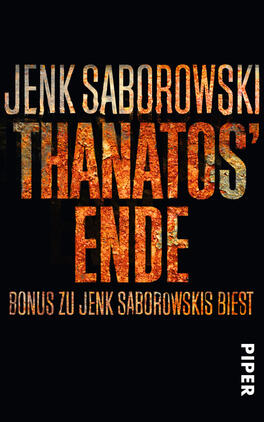

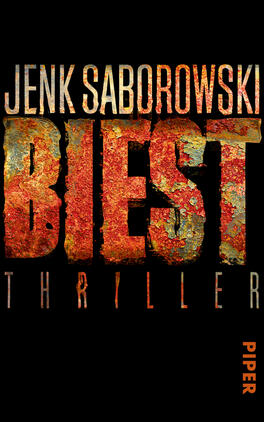
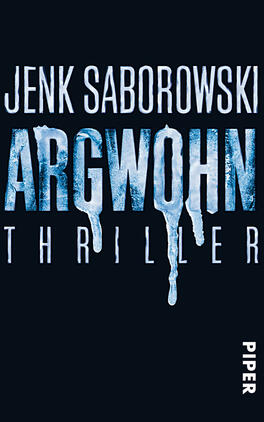


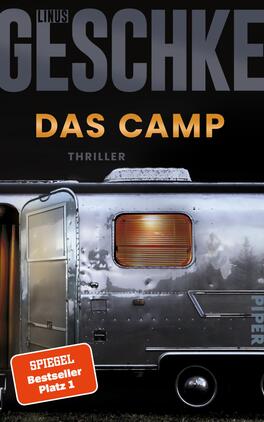


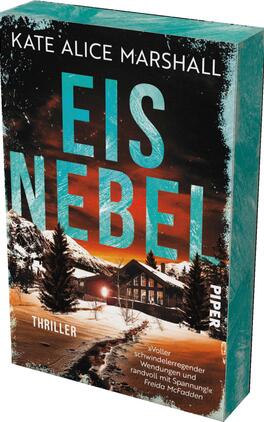



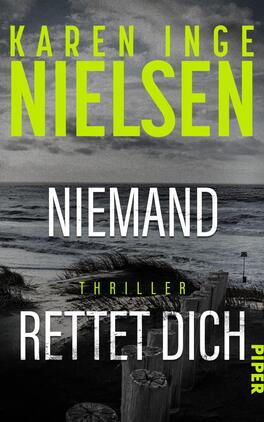



Die erste Bewertung schreiben