
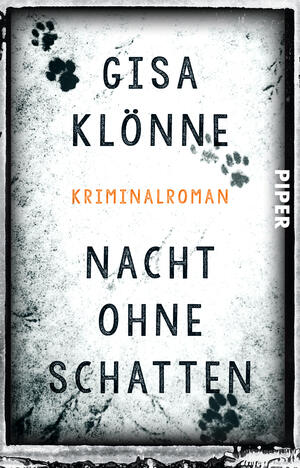
Nacht ohne Schatten (Judith-Krieger-Krimis 3) Nacht ohne Schatten (Judith-Krieger-Krimis 3) - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
Nacht ohne Schatten (Judith-Krieger-Krimis 3) — Inhalt
Ein verlassener S-Bahnhof. Ein erstochener Fahrer. Eine bewusstlose junge Frau, die ganz in der Nähe offenbar zur Prostitution gezwungen wurde. Sowie eine russische Rechtsmedizinerin, die an einer dunklen Vergangenheit trägt. - Die Ermittlungen werden für das Team Krieger und Korzilius unversehens zur Zerreißprobe. Und führen sie in eine beklemmende Welt, in der Gewalt gegen Frauen alltäglich ist.
Leseprobe zu „Nacht ohne Schatten (Judith-Krieger-Krimis 3)“
Samstag, 7. Januar
„Jetzt weißt du, wie es ist.“
Der Satz ist rätselhaft, ohne Zusammenhang. Es gibt keinen Sprecher zu ihm, kein Gesicht. Kriminalhauptkommissarin Judith Krieger liegt ganz still. Jemand hat diesen Satz zu ihr gesagt, vielleicht sogar jemand, den sie kennt. Der Satz muss einen Sinn ergeben. Sie versucht die Traumbilder noch einmal heraufzubeschwören. Sie denkt an die Akten, die sich in ihrem Büro stapeln, auf jeder freien Fläche. Dann an die unselige Weihnachtstombola. Es hilft nichts. Sie kommt nicht einmal darauf, was dieses „Jetzt“ [...]
Samstag, 7. Januar
„Jetzt weißt du, wie es ist.“
Der Satz ist rätselhaft, ohne Zusammenhang. Es gibt keinen Sprecher zu ihm, kein Gesicht. Kriminalhauptkommissarin Judith Krieger liegt ganz still. Jemand hat diesen Satz zu ihr gesagt, vielleicht sogar jemand, den sie kennt. Der Satz muss einen Sinn ergeben. Sie versucht die Traumbilder noch einmal heraufzubeschwören. Sie denkt an die Akten, die sich in ihrem Büro stapeln, auf jeder freien Fläche. Dann an die unselige Weihnachtstombola. Es hilft nichts. Sie kommt nicht einmal darauf, was dieses „Jetzt“ bedeuten mag, das nach Schadenfreude klingt, beinahe wie eine Drohung.
Sie zieht ihren Bademantel über und füllt in der Küche ein Glas mit Leitungswasser. 2:11 Uhr. Sie ist nicht erstaunt, als das Telefon zu klingeln beginnt. Eher ist es so, als habe sie darauf gewartet, ohne sich dessen bewusst zu sein.
„Krieger?“
„Henning, Kriminalinspektion. Tut mir leid.“
„Schon okay.“ Sie sucht unter der Zeitung auf dem Küchentisch nach Notizbuch und Stift, während der Polizeibeamte am anderen Ende der Leitung weiterspricht.
„Ein Toter an der S-Bahn-Haltestelle Gewerbepark. Wahrscheinlich der Fahrer. Könnte ein Unfall sein. Vermutlich aber nicht.“
„Schicken Sie mir einen Wagen.“
Unten auf der Straße empfängt sie Nieselregen, im Rinnstein kleben die aufgeweichten Überreste einer Silvesterrakete. Der Wochenend-Soundtrack der Innenstadt liegt in der Luft: Motorenlärm, Gesprächsfetzen, Musik. Judith schließt die Augen, während ein Polizeistreifenwagen sie durch die fiebernde Innenstadt in den Nordwesten bringt. Sie sehnt sich plötzlich nach etwas, vielleicht einfach nur nach einem jüngeren Ich. Es gab einmal eine Zeit in ihrem Leben, da glaubte sie, Gut und Böse unterscheiden zu können, und für jede Verzweiflung gab es eine Hoffnung.
Am Aufgang der S-Bahn-Haltestelle Gewerbepark warten weitere Polizeiautos. Die Haltestelle liegt erhöht auf schmuddeligem Mauerwerk, das in einen struppig bewachsenen Bahndamm übergeht. Jenseits der Unterführung erkennt Judith eine vernachlässigte Schrebergartenkolonie. Das Gebiet zwischen Ehrenfeld und Bickendorf, das der Haltestelle den Namen gab, befindet sich im Umbruch, zur Kleinindustrie aus diversen Handwerksbetrieben, Auto- und Schrotthändlern haben sich die ersten Bürokomplexe gesellt. An der Straße zum Haltestellenaufgang stehen zum Abriss vorgesehene Mietshäuser und eine alte Backsteinfabrik. Die Fenster sind dunkel. Auch das einzige Lokal weit und breit, eine Pizzeria, hat längst geschlossen.
„KHK Krieger?“ Eine Polizeimeisterin mit straff gebundenem Pferdeschwanz deutet vage die Treppe hinauf. „Der Zeuge, der uns verständigt hat, ist noch hier.“
Graffiti an den Wänden des Treppenaufgangs. Abfall, Urinränder und Erbrochenes auf den Stufen. Die Polizeimeisterin folgt Judith stumm nach oben, wo weitere Polizisten einen drahtigen Mann mit grauem Bürstenhaarschnitt bewachen. Von einem Toten ist nichts zu sehen.
„Der Tote liegt da drüben“, die Polizeimeisterin zeigt auf eine etwa 150 Meter von der Haltestelle entfernt wartende S-Bahn mit leuchtenden Scheinwerfern.
„Wie hat der Zeuge ihn da gefunden?“
„Er sagt, er ist rübergelaufen, weil die S-Bahn nicht einfuhr, wollte sich beschweren.“ Die Polizistin senkt die Stimme. „Der hat eine ganz schöne Fahne.“
„Ich schau mich mal um“, sagt Judith. „Behaltet ihn hier. Was ist mit dem Bahnverkehr?“
„Ist nicht unterbrochen. Aber der Zug steht ja auch auf dem Wartegleis.“ Einer der Beamten gibt ihr eine Stableuchte. Sie springt ins Gleisbett, schaltet die Lampe ein. Nieselregen hängt in der Luft wie Weichzeichner, legt sich auf ihre Haare, ihr Gesicht, ihren Mantel. Millionen feiner Tröpfchen, die unaufhaltsam Spuren zerstören. Wie viel Zeit ist vergangen, seit der Tote gefunden wurde? Zu viel Zeit. Judith beschleunigt ihre Schritte. Die Gleise schimmern kalt im Licht der Taschenlampe, die Scheinwerfer der Bahn blenden Judith. Jenseits des Gewerbeparks erscheint das Großbordell Amor zum Greifen nah: neun Stockwerke, an deren Fassade sich rote Lauflichter jagen. Weiter entfernt schwimmt der Dom in den Lichtern der Innenstadt wie in buntem Nebel.
Der Tote liegt neben dem Führerstand der S-Bahn im Schotter, ein Knie angezogen, halb seitlich auf dem Bauch, als schliefe er. Doch sein grotesk in den Nacken gebogener Kopf macht den ersten Eindruck friedlicher Entspannung zunichte. Der Kopf und das Blut, das aus seinem leicht geöffneten Mund geflossen ist. Beinahe schwarz sieht es aus. Ölig. Judith hockt sich hin und leuchtet dem Mann ins Gesicht. Seine Augen sind schon trüb, trotzdem ist es ihr, als sehe er sie an und bitte um etwas, nicht verstehend, was mit ihm geschehen ist, nicht bereit, seinen Tod zu akzeptieren. Der Geruch von Blut steigt ihr in die Nase. Metallisch. Süßlich. Lebenssaft, der sich bereits zersetzt, nutzlos wird. Urin und Kot mischen sich dazu. Wahrscheinlich hat der Mann im Moment seines Todes in die Hosen gemacht.
„Ich denk die ganze Zeit, dass er was zu sagen versucht.“ Der Polizist, der neben dem Toten gewartet hat, kreuzt die Arme vor der Brust.
„Was?“
„Was?“ Irritiert sieht er Judith an.
„Was, glaubst du, versucht er zu sagen?“
Der Mann zieht die Schultern hoch. „Keine Ahnung, ist ja auch Quatsch.“
Wortlos zwingt Judith Latexhandschuhe über ihre klammen Finger. Der Tote ist korpulent. Er trägt Sweatshirt, Hose und Schuhe, alles in Dunkelblau oder Schwarz. Das Blut ist wirklich überall. Sie fasst unter den Kopf des Mannes, registriert Schürf- und Platzwunden auf Stirn und Wange. Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Wie schwer ein menschlicher Schädel wiegt, wenn die Halsmuskeln ihn nicht mehr stabilisieren. Die Gesichtshaut ist blass, wächsern, kühl. Judith entdeckt keine Totenflecken. Behutsam lässt sie den Schädel zurück auf den Schotter gleiten. Ein Schwall lauwarmen Blutes ergießt sich aus dem Mund des Toten über ihre Hand. Sie unterdrückt einen Fluch.
„Seine Lunge muss verletzt sein.“ Sie spricht laut, um das Unbehagen zu übertönen, das der unverwandt starre Blick des Toten und die Erinnerung an die rätselhafte Traumbotschaft in ihr auslösen. „Wir brauchen die Spurensicherung, Licht, Abdeckplane oder Zelt, und zwar schnell. Gibst du das durch? Verfluchter Regen.“
Der Tote trägt keine Jacke, fällt ihr plötzlich auf. Wieder schickt sie den Lichtstrahl über seinen Leib. Das Bahnlogo prangt auf seiner Sweatshirtbrust. Die linke Hand ist unter dem Körper vergraben. Die andere ist zur Faust geballt. Judith tritt hinter den zusammengekrümmten Mann, geht erneut in die Hocke. Hier ist der Stoff seines Sweatshirts dunkel verkrustet. Sie beugt sich näher zu ihm. Risse im Gewebe, links und rechts der Wirbelsäule. Fadendünne Schnitte, fransige Schnitte, kreuz und quer.
Judith richtet sich auf. „Jemand muss wie von Sinnen auf ihn eingestochen haben. Rücklings. Besser, du rufst auch die Rechtsmedizin.“
Der Polizeimeister spricht erneut in sein Funkgerät.
„Müller hat Dienst“, sagt er zu Judith, als er fertig ist.
Sie nickt, leuchtet weiter die Umgebung ab, dann den Führerstand der S-Bahn. Ihr Haar klebt jetzt an ihrem Kopf, der Regen wird dichter, hüllt sie ein. Er ist zu warm für eine Januarnacht, der ganze Winter ist zu warm, die Nachrichten sind voll davon: Schmelzende Polkappen, steigende Meeresspiegel, Wirbelstürme, Hungersnöte, alles selbst verschuldet, alles menschengemacht. Und trotzdem ist die Nacht zu kalt, um ohne Jacke zur Arbeit zu gehen.
Wieder leuchtet Judith über den Körper des Toten. Was ist mit der Jacke des S-Bahn-Fahrers passiert? Hat er sie ausgezogen, bevor er ermordet wurde? Hat der Täter sie ihm weggenommen, und wenn ja, warum? Die Nase des Toten ist zu groß, der Mund zu klein, das hellbraune Haar wird am Hinterkopf licht. Sie sieht ihn vor sich, wie er an der Bahn entlang durch den Schotter schlurft, vom hinteren zum vorderen Triebwagen, ein müder Mann mit gekrümmten Schultern, der nichts auf Sport und Haltung gibt. Die Schnürsenkel seiner Schuhe sind aufgebunden, registriert sie auf einmal. Wollte er sie ausziehen, in seiner letzten Pause, mitten auf den Gleisen? Wohl kaum.
„Von wo ist der Täter gekommen?“, fragt der Polizeimeister.
„Vielleicht war er in der Bahn. Wir brauchen jemanden von den Verkehrsbetrieben, mit etwas Glück gibt es da drin Kameras.“ Judith schickt den Lichtstrahl ihrer Taschenlampe über die S-Bahn-Waggons. Sie sehen alt aus. Verdreckt. Hat der Tote eine Frau? Kinder? Er trägt keinen Ehering, jedenfalls nicht an der rechten Hand.
„Warte hier und lass KOK Korzilius rufen“, sagt sie zu dem Polizeimeister. „Ich red jetzt mit dem Zeugen.“
Der Wind nimmt zu und peitscht ihr Nässe ins Gesicht. Der Weg zurück zur Haltestelle über die Gleise ist zu einsichtig, als dass der Täter ihn gewählt haben dürfte, auch wenn hier um diese Tageszeit absolut niemand wach oder unterwegs zu sein scheint. Auf dem Bahnsteig stehen jetzt die Spurensicherer bereit, die Gesichter grünlich blass vom trüben Neonlicht. Sie hören sich an, was Judith berichtet, und schwärmen dann über die Bahngleise aus, wie eine Spezies flügelloser weißer Käfer.
Judith streicht sich die nassen Haarsträhnen aus dem Gesieht. Es läuft gut, hat Millstätt, ihr Chef, gestern gesagt, als er sie zur Bereitschaft einteilte. Die Kollegen betrachten dich als rehabilitiert. Es ist genau das, worum sie gekämpft hat, nach ihrer Krise, der Auszeit und der Rückkehr, aber ist es auch das, was sie will? Ja, denkt sie, ja, verdammt, das ist es. Hör endlich mit dem Zweifeln auf. Judith strafft die Schultern, blickt durch den Regen hinüber zum Tatort. Sie hat dort drüben eine Gefahr gespürt, die sie noch nicht benennen kann. Als ob sich hinter den offensichtlichen Fakten dieses Verbrechens noch eine dunklere, kältere Wahrheit verbirgt.
„Hauptkommissarin Krieger?“ Die Streifenbeamtin mit dem straff gebundenen Pferdeschwanz tritt auf Judith zu. „Ich hab unserem Zeugen vorhin Kaffee und Brötchen organisiert, da wurde er plötzlich gesprächig.“
„Und?“
„Er behauptet auf einmal, er hätte da drüben jemanden gesehen. Möglicherweise den Täter.“
* * *
Die Umgebung der S-Bahn-Haltestelle Gewerbepark könnte locker jeden Wettbewerb in Sachen hässlichster Flecken von Köln gewinnen. Es gibt weder einen Park noch besonders viel boomendes Gewerbe, auch wenn die Stadtoberen fest daran glauben, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Ein paar der alten Sozialwohnungsblocks stehen schon leer, in anderen harren die verbliebenen Mieter noch aus, aber normalerweise dürfte hier nachts um drei absolut tote Hose herrschen. Jetzt jedoch ist die Action im vollen Gange. Streifenwagen, Spurensicherung, Karl-Heinz Müllers Fiat Spider und ein Einsatzfahrzeug der Bahn parken kreuz und quer vor der Bahnunterführung, sogar zwei Pressegeier drängeln sich am Absperrband und brüllen Manni ihre Fragen entgegen. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, hält er auf die Treppe zu. Der Anruf ist im allerallerungünstigsten Moment gekommen, absolut worst case, anders kann man das nicht sagen. Und als Krönung des Ganzen schifft es aus vollen Kübeln.
Auf dem Bahnsteig läuft ihm Kollegin Krieger entgegen, einen dampfenden Pappbecher in der Rechten, eine ihrer stinkenden Selbstgedrehten im Mundwinkel. Ihr Ledermantel ist dunkel vor Nässe, das Haar klebt an ihrem Kopf, was ihr den Charme einer ertrinkenden Katze verleiht – eine Tatsache, die sie nicht weiter zu stören scheint.
„Das Opfer heißt Wolfgang Berger, 43 Jahre alt, S-Bahn-Fahrer“, referiert sie, ohne Manni Zeit für eine Begrüßung zu lassen. „Er wurde rücklings erstochen. Tatzeit: während seiner letzten Pause, zwischen 1:35 Uhr und 1:55 Uhr. Wir haben sogar einen Zeugen.“ Sie steckt ihre Zigarette wieder in den Mund und kneift die Augen zusammen. „Ein Fahrgast, der hier gewartet hat. Angetrunken, aber immerhin. Er ist rüberge- laufen, als die S-Bahn zur fahrplanmäßigen Zeit nicht einfuhr.“ Sie wischt die freie Hand an ihren Jeans trocken und klemmt sich die Zigarette zwischen die Finger. „Er hat da drüben jemanden gesehen, bevor er quasi über den Toten gestolpert ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach unseren Täter. ›Und, wie sieht er aus?‹, frag ich ihn. Weißt du, was er geantwortet hat?“
Manni schüttelt den Kopf. „Wie Michael Jackson?“
„›Wie ein Penner‹“, faucht die Krieger. „›Beschreiben Sie ihn‹, sage ich.“
„Und?“
„Er habe ›irgendwie streng gerochen‹, hat er ausgesagt. ›Und sonst‹, frage ich, denn der Geruch könnte sehr gut auch vom Opfer stammen. Er sei normal groß gewesen, habe wahrscheinlich einen Mantel getragen und eventuell halblange Haare gehabt. Und das war’s dann schon. Es sei zu dunkel gewesen. Es sei zu schnell gegangen. Nicht mal auf eine ungefähre Größenbeschreibung will er sich festlegen. Er habe einen Schatten gesehen, den er für einen Penner hielt, und gleich darauf das Opfer. Wir sollten dankbar sein, dass er uns überhaupt verständigt habe. Ende, aus.“
„Vielleicht lügt er und ist in Wirklichkeit unser Täter. Der Rächer aller frustrierten Fahrgäste.“
„Sehr witzig. Das ist das reinste Blutbad da drüben, seine Kleidung wäre voll davon.“
„Wo ist er?“
„Ich hab ihn heimbringen lassen.“
Manni zieht die Augenbrauen hoch.
„Ausführliche Vernehmung später im Präsidium, wenn er hoffentlich wieder nüchtern ist.“ Judith Krieger zerstampft ihre Zigarettenkippe, sehr viel nachdrücklicher, als es nötig wäre.
„Keine erkennungsdienstliche Behandlung?“
„Wir überprüfen seine Kleidung und die Schuhe, wegen der Abdrücke am Tatort. Wird aber nicht viel bringen. Mistregen.“ Sie schüttelt sich, dass die Tropfen fliegen. Manni wirft sich ein Fisherman’s in den Mund, hält ihr die Tüte hin, doch wie zu erwarten, lehnt sie ab.
„Wir haben jetzt einen Kollegen erreicht, der ganz gut mit Berger bekannt ist.“ Ein fettbäuchiger Glatzkopf in dunkelblauem Bahn-Ornat watschelt auf sie zu. „Berger war Single. Er lebte allein. Die nächsten Verwandten sind seine Eltern in Paderborn. Berger hatte kaum Kontakt zu ihnen. Die Mutter hat Alzheimer.“
„Wir schicken einen Kollegen hin“, sagt die Krieger. „Was ist mit den Überwachungskameras?“
Der Glatzkopf windet sich. Das Geld, der Vandalismus, die Fallstricke der öffentlichen Hand, blablabla. Selbstverständlich werde man alles tun, die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen. „Geben Sie uns bitte ein paar Stunden Zeit.“
Judith Krieger zerknüllt ihren Kaffeebecher und schleudert ihn in einen Abfalleimer. Die Geste ist unmissverständlich, so gedenkt sie mit allen zu verfahren, die sie behindern. KHK Krieger in Höchstform. Die letzten Monate Zusammenarbeit mit ihr waren tatsächlich richtig nett. Warum ist Manni jetzt plötzlich sauer auf sie? Weil sie ihn so spät gerufen hat. Weil sie ihn überhaupt gerufen hat. Weil sie sich aufführt, als sei sie der Chef. Er zieht den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Seine Finger duften noch nach der Frau in seinem Bett. Er hat verflucht noch mal gehofft, dass diese Nacht ohne Anruf vergeht.
Die Spurensicherer wuseln um das Zelt herum, das sie neben der S-Bahn über dem Opfer errichtet haben. Kamerablitzlicht zuckt. Weitere Kollegen kriechen über den Bahndamm und wühlen im Müll, der sogar hier liegt, wo eigentlich niemand entlanglaufen darf. Manni späht unter die Zeltplane. Das Opfer ist fast völlig mit nummerierten Klebestreifen bedeckt.
„Jede Menge Faserspuren, wir werden viel zu tun haben in den nächsten Tagen!“ Der Kriminaltechniker Klaus Munzinger hat rote Apfelbäckchen, wie immer, wenn er in Schwung ist. Auch seine Gattin dürfte nicht weit sein, Karin. Vor ein paar Monaten haben die beiden geheiratet. Als ob es noch nicht reichte, Tag für Tag zusammen zu arbeiten.
„Habt ihr die Tatwaffe?“, fragt die Krieger.
„Wir suchen noch.“
Suchen, denkt Manni, na klar. Die Jacke, die der Fahrer getragen haben muss. Den Rucksack, den er seinem Kollegen zufolge immer dabeihatte. Den Täter, sein Motiv, einen brauchbaren Zeugen, irgendeine Spur. Der Regen wird stärker, einer der Spurensicherer stolpert und flucht. Wo verläuft die Grenze zwischen Sorgfalt und Irrsinn? Das ist eine Frage, die sich, was polizeiliche Ermittlungsarbeit angeht, nicht immer befriedigend beantworten lässt.
* * *
Ein feuchtwarmer Wind weht vom Westen her auf den Balkon, der Himmel ist schwarz. Der Wind bringt nichts Gutes. Der Gedanke ist plötzlich da, nein, kein Gedanke, eine Gewissheit, die sie nicht begründen kann und deshalb augenblicklich zu ignorieren beschließt. Ekaterina Petrowa zieht den Morgenmantel enger um sich und geht zurück in ihre Küche. Es ist Samstag, gerade erst fünf Uhr, sie hat frei, es gibt keinen Grund, irgendetwas zu befürchten. Sie könnte sich noch einmal hinlegen, aber sie ist eine Frühaufsteherin, und sie mag Gewohnheiten, also bereitet sie wie jeden Morgen einen Teller Haferbrei mit Butter und braunem Zucker zu, trinkt eine Kanne schwarzen Tee und liest die Prawda und die FAZ. Um 6:30 Uhr ist sie fertig und spült das Geschirr unter fließendem Wasser. Prawda heißt Wahrheit, aber die Zeitung ist voller Lügen, wie früher auch, nur dass ihr neuer Gott freie Wirtschaft heißt, was wiederum bedeutet, dass einige wenige sich die Freiheit nehmen, Russland noch skrupelloser auszubeuten als die alten Machthaber, die sich Kommunisten nannten, denen es angeblich auch um Gerechtigkeit ging.
Ich sollte die Prawda wirklich abbestellen, denkt sie, während sie den Pullover anzieht, den sie sich zu Weihnachten gekauft hat. Violettes Mohair mit eingewirktem Glitzerfaden, sehr, sehr schön. Die Prawda taugt allenfalls dazu, Fisch einzuwickeln oder den Ofen anzuheizen, Katjuschka. Sie lächelt bei der Erinnerung an die Inbrunst, mit der ihre Großmutter dies ein ums andere Mal wiederholt hat. Und trotzdem muss man den Feind beobachten, denn das heißt ihn kennen. Also liest Ekaterina die Prawda, obwohl sie längst die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich in ihrer Heimat so etwas wie Pressefreiheit durchsetzen wird.
Pudrig violetter Lidschatten, passend zum Pullover, nicht viel, nur ein Hauch. Lippenstift, dessen Farbton winterlich kühl ist, ebenfalls perfekt zum Pullover passend. Sie fährt mit der Bürste über ihr kurzes Haar, bewundert die neuen, kirschroten Strähnchen im glänzenden Schwarz. Sie hat dieses Schwarz schon oft verflucht, aber so gefällt es ihr. Sie lächelt ihrem Spiegelbild zu. Zwei bis drei Stunden will sie ins Institut, ein paar Kleinigkeiten erledigen, die unter der Woche liegengeblieben sind. Danach zum Markt, Gemüse und Gardinenstoff kaufen, am Nachmittag vielleicht ein gutes Buch auf dem Sofa, ein Schaumbad und abends tanzen gehen.
Sie wählt den Weg am Kanal entlang, in den sie sich sofort verliebt hat. Die Luft schmeckt nach Regen, der Asphalt glitzert. Die kahlen Kronen der Kastanien akzentuieren das spärliche Licht der Straßenlaternen, von den Ausfallstraßen der Stadt weht gedämpfter Verkehrslärm herüber. Am Wochenende ist sie hier um diese Uhrzeit allein, nicht einmal die unermüdlichen Jogger und die Rentner mit ihren fett gefütterten Schoßhunden sind schon unterwegs. Schlafende Schwäne gleiten über das Wasser wie Träume. Sie hält inne, sieht ihnen zu. Schwäne sind Luxusgeschöpfe, dort, wo sie herkommt, gibt es keine Schwäne. Eine Windbö schlägt ihr den Schal vors Gesicht. Sie fährt zusammen, unterdrückt einen Schrei. Nur der Wind. Sie stopft das Schalende unters Mantelrevers. Der Wind bringt nichts Gutes. Wieder dieser Gedanke, genährt von einem Wissen, das älter ist als sie. Auf einmal fühlt sie sich unwohl so allein und beschleunigt ihre Schritte, dass die Stiefelabsätze ein wildes Stakkato aufs Pflaster hämmern.
Der Anblick des Rechtsmedizinischen Instituts, das sie eine Viertelstunde später erreicht, bringt ihr die Ruhe zurück. Ihr Arbeitsplatz, ihr Glück. Das Stipendium für das Medizinstudium in Deutschland war ihr Ticket in die Freiheit. Sie hat hart gearbeitet, sehr hart, und trotzdem war ihr Abschluss mit Auszeichnung keineswegs ein Garant dafür, dass sie bleiben durfte. Aber sie hat es geschafft. Einer ersten Anstellung in Kiel folgte ein Jahr Frankfurt. Und nun ist sie hier in Köln gelandet, mit einem Arbeitsvertrag für drei weitere glückliche deutsche Jahre, mit der Lizenz, die unzähligen Facetten des Todes noch weiter zu ergründen. Dr. Ekaterina Petrowa, Rechtsmedizinerin an der Universität zu Köln. Sie lächelt, als sie den Institutsschlüssel aus ihrer Handtasche nimmt. Ja, sie hat allen Grund, zufrieden zu sein.
Sie vermag nicht zu sagen, woher die Frau gekommen ist. Wie aus dem Boden gewachsen steht sie neben ihr, gerade als Ekaterina die Glastür neben der Pförtnerloge aufschließen will.
„Bitte. Sie müssen mir helfen.“
„Helfen?“ Ekaterina widersteht dem Impuls, sich an der Frau vorbeizudrängen und die Tür von innen zu verriegeln. Irgendetwas an ihr ist beunruhigend, vielleicht die fiebrige Entschlossenheit, mit der sie Ekaterina fixiert. Andererseits sieht die Frau nicht wie eine Asoziale oder Verbrecherin aus, eher im Gegenteil, reich und gepflegt, auch wenn sie offenbar ziemlich lange durch den Regen gelaufen ist.
„Das Projekt“, flüstert die Frau. Ihre Stimme klingt wie Wind in Birkenlaub. „Sie sind doch die Nachfolgerin von Frau Doktor Schmitt-Mergel?“
Die Vorfreude auf diesen Tag, die Ekaterina soeben noch erfüllt hat, verfliegt. Wie festgefroren steht sie da. Häusliche Gewalt. Das Kölner Modellprojekt. Das Vorzeigeprojekt. Lieblingskind ihrer Vorgängerin Antje Schmitt-Mergel. Beim Vorstellungsgespräch hat Ekaterina ganz vorsichtig gefragt, ob die Projektleitung unabänderlich an ihre Stelle gebunden sei, sie habe sich ja bislang eher auf die Toten konzentriert, nicht so sehr auf Gesellschaftspolitik, kenne ja auch die Kölner Mentalität und Behörden noch nicht, ob nicht ein Kollege … – Die Frauen werden sich Ihnen schon anvertrauen, von Frau zu Frau, hatte ihr künftiger Chef gesagt. Und die Untersuchungen schaffen Sie allemal. Oder wollen Sie die Stelle nicht? Was für eine Frage. Natürlich hatte Ekaterina eilig erklärt, sie werde das Projekt zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben im Institut mit großer Freude übernehmen.
„Dr. Petrowa, das sind Sie doch?“ Die Frau nestelt einen Zeitungsausschnitt aus ihrer Anoraktasche, den unübersehbar ein Foto von Ekaterina ziert. „Diese Frau kämpft gegen Gewalt“ brüllt die Überschrift, ein klarer Beweis dafür, dass auch deutsche Zeitungen es mit der Wahrheit nicht immer genau nehmen.
„Das Institut ist samstags geschlossen.“
„Bitte“, wiederholt die Fremde heiser. „Sie sind doch oft auch am Wochenende hier. Mein Mann … er hat mich …“, sie fasst sich an die Kehle, „er wollte mich …“
„Haben Sie die Polizei verständigt?“
Die Frau beginnt zu schwanken, als ob sie nun, da sie sich Ekaterina anvertraut hat, alle Kraft verließe. „Das Projekt“, murmelt sie und tastet nach einem Halt.
Was bleibt ihr übrig? Ekaterina stemmt ihre Schulter stabilisierend unter den Arm der Fremden und schiebt sie ins Institut. Ohne erkennbare Gegenwehr oder Mithilfe lässt die Frau es geschehen. Trotz ihrer beachtlichen Größe wiegt sie nur wenig, doch als sie sich schließlich bis ins Büro vorgearbeitet haben, ist Ekaterina außer Atem. Sie bugsiert ihre ungebetene Besucherin auf die Untersuchungspritsche und wirft ihren Mantel ab. Die Frau beobachtet sie. Abschätzend? Verängstigt?
„Sie sind sehr stark für eine so kleine Person“, flüstert sie.
„Wie heißen Sie?“
„Ines. Nennen Sie mich Ines.“
„Nachname?“
Die Frau schließt die Augen, ihr Kopf rollt zur Seite. Kollabiert sie etwa? Ekaterina sehnt sich nach dem vertrauten Prozedere einer Obduktion, bei dem sich Fragen dieser Art nicht stellen.
„Winkeln Sie die Beine an, Ines, stellen Sie sie auf“, befiehlt sie mit ihrer Ärztinnenstimme. „Atmen Sie tief durch. Und dann erzählen Sie bitte. Was hat Ihr Mann getan? Weshalb sind Sie hier?“
Statt zu antworten, beginnt die Frau zu zittern, lautlos, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Ekaterina breitet eine Wolldecke über sie und versucht zu rekapitulieren, was ihre Vorgängerin über misshandelte Frauen gesagt hat. Sie stehen unter Schock, unterliegen starken Stimmungsschwankungen. Einige berichten die ungeheuerlichsten Dinge in so neutralem Ton, als sprächen sie über das Wetter. Andere sind nicht fähig, überhaupt etwas zu sagen. Wieder andere leugnen. Sehr hilfreich, wirklich, sehr, sehr hilfreich.
Sie beschließt, sich lieber nicht auf ihre psychologischen Fähigkeiten zu verlassen, sondern sich stattdessen auf den Körper zu konzentrieren. Die Frau, die sich Ines nennt, konnte ihre Gliedmaßen eben noch bewegen. Sie scheint keine inneren Verletzungen zu haben, keine gebrochenen Rippen, sonst hätte sie den Transport ins Büro nicht klaglos mitgemacht. Vorsichtig streicht Ekaterina ihr die nassen Ponyfransen aus der Stirn. Keine Platzwunden oder kahlen Stellen im Haar. Keine sichtbaren Hämatome im Gesicht. Die Haut ist weich. Makellos. Die Augen öffnen sich wieder und starren angstvoll zu Ekaterina empor.
Die Bindehaut ist gerötet. Ekaterinas Herzschlag beschleunigt sich. Sie nimmt eine Untersuchungslampe, während sie beruhigend auf die Frau einredet und sich weiter herunter beugt. Petechien, Punktblutungen, ganz eindeutig. Blutzufluss und -abfluss zum Gehirn müssen unterbrochen gewesen sein. Sie überprüft auch die Mundschleimhaut, leuchtet hinter die Ohren.
„Ihr Mann hat Sie gewürgt. Ich vermute, Sie sind sogar ohnmächtig geworden.“ Nein, denkt sie wild, ich weiß, dass du schon weggetreten warst. So wie es aussieht, ist es ein Wunder, dass du wieder zu dir gekommen bist. Jemand hat versucht, dich zu töten, so viel steht fest.
„Kommen Sie, ich untersuche Sie. Deshalb sind Sie doch gekommen, nicht wahr? Ziehen Sie sich aus, Ines. Vertrauen Sie mir, ich tue Ihnen nicht weh.“
Durchnässte Pumps, Designerjeans, ein beigefarbener Rollkragenpullover. Darunter Seidenwäsche, blutbefleckt. Die Hämatome am Hals sind noch sehr blass. Fingerabdrücke in lichtem Himmelblau, ganz ungefährlich sehen sie aus, ganz zart. Aber die Flecken an den Innenseiten der Oberschenkel sind alles andere als dezent. Hämatome in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mehrere Zentimeter groß. Dunkelblau, violett, gelblich, braun schillern sie.
„Ihr Mann vergewaltigt Sie.“
Die Frau schüttelt den Kopf, beginnt wieder zu zittern.
Ekaterina fotografiert, vermisst, dokumentiert.
„Sie müssen zur Polizei gehen. Wer auch immer das getan hat, ist gefährlich.“
Wieder schüttelt die Frau den Kopf, greift nach ihrer Kleidung. Nun, da ihre Verletzungen untersucht worden sind, kehrt Leben in sie zurück, nun will sie gehen.
„Wie heißen Sie mit Nachnamen?“
Die Frau umklammert ihren Anorak, hastet auf den Flur. Ekaterina hat keine Befugnis, sie zum Bleiben zu zwingen. Sie muss den Wunsch der Patientin nach Vertraulichkeit respektieren. So will es das Projekt, so ist es ihre Pflicht als Ärztin. Erst als sie allein ist, erinnert sie sich an das Blut auf dem seidenen Unterhemd und daran, dass es am ganzen Körper der Frau keine offene Wunde gab. Von wem stammte dieses Blut, wenn nicht von ihr? Ekaterina rennt die Außentreppe hinunter auf die Straße. Zu spät. Nur der Wind ist noch hier, der feuchtwarme Westwind, der von Unheil kündet.
* * *
Schritte. Knistern. Was zum Teufel? Benommen öffnet Manni die Augen. Die Frau, die er in der Nacht nur äußerst widerwillig allein in seinem Bett zurückgelassen hat, lächelt auf ihn herab, unverschämt sexy, hinreißend schön.
„Guten Morgen, Herr Oberkommissar. Ich hab Frühstück mitgebracht.“
Manni hievt seinen vom nächtlichen Einsatz lädierten Körper in eine halbwegs sitzende Position. Stundenlang ist er mit den Spurensicherern im strömenden Regen über den Bahndamm gekrochen und hat Müll eingesammelt. Kippen, Verpackungen jeder Art in diversen Stadien des Verfalls, angegammelte Klamotten. Als er schließlich auch noch eine Klobrille fand, hat er es drangegeben. Zu spät, wie sich herausstellte, denn als er endlich zu Hause ankam, war sein Bett gähnend leer. Er ist auf dem Sofa eingeschlafen, hat sich nicht einmal ausgezogen, die Jeans klebt noch immer feucht an seinen Beinen, und sein Nacken ist steif und schmerzt höllisch. Manni angelt sein Handy aus der Hosentasche. Heilige Scheiße, es ist kurz vor acht. Warum hat Sonja nicht auf ihn gewartet? Und wie ist sie jetzt wieder in seine Wohnung gekommen? Er entdeckt seinen Ersatzschlüssel auf dem Tisch, neben einer Brötchentüte. Diese Frage wäre zumindest geklärt.
„Wo warst du?“ Seine Stimme klingt mindestens eine Oktave tiefer als sonst.
„Zu Hause.“ Sonja macht sich in Hausherrinnenmanier an seinen Schränken zu schaffen, stellt Tassen und Brettchen auf den Tisch. „Hast du grünen Tee?“
„Ich hab O-Saft, wenn du keinen Kaffee magst.“ Er stampft ins Bad, reißt sich die Klamotten vom Leib und stellt sich unter die Dusche. Sonja. Ewig hat es gedauert, bis er sie im Bett hatte, und dann, kaum ging es endlich zur Sache, war’s schon wieder vorbei mit dem Spaß. Er denkt daran, wie perfekt ihre Brüste in seine Hände passen, während das heiße Wasser auf seine Schultern prasselt. Wie sie lacht, wie sie riecht, wie sie ihn angefasst hat. Auf dem Bauch hat sie ein interessantes Tattoo, dessen Bedeutung sie ihm nicht verraten will. Es hilft nichts. Als Manni sich abtrocknet, fühlt er sich trotzdem wie ein ausgemusterter Zugochse, was insofern nicht weiter tragisch ist, als ihm keinerlei Zeit für eine Morgennummer bleibt. Im Stehen stürzt er ein Glas Saft runter und schnappt sich ein Croissant. Sonja hat ihr rotblondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie riecht noch immer nach diesem Orientparfum und mustert ihn, ohne etwas zu sagen.
„Sorry, ich muss los. Ich ruf dich an. Lass meinen Schlüssel hier, wenn du gehst.“
Sie deutet einen Militärgruß an, winkt dann zum Abschied und lächelt.
Unten fegt der Wind Zeitungsseiten den Rinnstein entlang. Fettbäuchige Wolken verschlucken das Morgenlicht, nur wenige Autos sind unterwegs, so dass Manni zügig vorankommt und sogar direkt vor den Waschbetontreppen des Rechtsmedizinischen Instituts einen Parkplatz ergattert. Vor der gläsernen Eingangstür des Obduktionsgebäudes steht eine zierliche Frau mit einer irrsinnigen Fellmütze in einem die Augen beleidigenden, violetten Plüschpullover. Ein Hauch von Kälte scheint sie zu umgeben. Sie drückt eine Pappmappe aus einer Hängeregistratur an ihre Brust. Manni nickt ihr zu, aber sie schaut mit ihren Kohleaugen einfach durch ihn durch in den Himmel. Der Obduktionssaal ist noch leer, Judith Krieger und Karl-Heinz Müller lungern, Nikotinschwaden ausatmend, drei Stockwerke höher im Büro des Rechtsmediziners herum und wärmen sich an Kaffeebechern. Die Kaffeemaschine blubbert einladend. Manni angelt eine einigermaßen sauber aussehende Tasse hinter einem grinsenden Totenschädel hervor und schenkt sich ein.
Der Kaffee ist so stark, dass er Lebende töten oder Tote wecken könnte, je nachdem. Der Krieger scheint er jedenfalls zu bekommen. Nur die Schatten auf ihren sommersprossigen Wangen zeugen noch davon, dass sie genauso wenig geschlafen hat wie Manni. Er entdeckt einen Teelöffel, reibt ihn an seiner Jeans notdürftig sauber und rührt Zucker in seine Tasse. „Ich glaub, ich hatte grad ’ne Erscheinung. Da draußen steht ’ne Eskimofrau.“
„Inuit“, sagt die Krieger und gähnt. „Hä?“
„So lautet die politisch korrekte Bezeichnung.“
„Eskimo heißt Rohfleischesser, das hören die nicht so gern.“ Karl-Heinz Müller zündet eine Davidoff an der Glut ihrer Vorgängerin an. „Trug die Frau eine Kaninchenfellmütze?“
„Yep.“ Manni versucht, an den Fenstergriff zu gelangen, ohne die statisch höchst gewagte Aktenstapelkonstruktion auf dem Schreibtisch des Rechtsmediziners zu berühren. Keine Chance. Resigniert stellt er seine Bemühungen um Frischluftzufuhr wieder ein.
Müller grinst, offenbar zufrieden mit Mannis Einsichtigkeit. „Es handelt sich um meine neue Kollegin. Dr. Ekaterina Petrowa aus Russland. Ein großes Talent.“
Groß ist übertrieben, unten im Obduktionskeller geht das russische Talent Manni gerade mal bis zur Brust, aber im grünen Ornat sieht die Russin immerhin manierlicher aus als in Violett und Pelz. Und mit Skalpell und Messer kann sie auch umgehen, wie sie augenblicklich beweist, als die langwierige äußere Besichtigung und akribische Beschreibung des bekleideten Leichnams abgeschlossen ist.
Manni atmet erleichtert auf, als die Knochensäge des Präparators endlich ihr nervtötendes Sirren einstellt. Eine Obduktion ist per se niemals appetitlich, aber die Schädelöffnung ist aus seiner Sicht jedes Mal wieder der Tiefpunkt.
„Judith hat bei unserer Weihnachtstombola übrigens das große Los gezogen“, sagt er zu Karl-Heinz Müller, um sich davon abzulenken, wie der Präparator das Gehirn entnimmt, wiegt und unter den Argusaugen der Russin millimeterdünne Scheibchen davon absäbelt und in Formalin gibt. Außerdem ärgert es ihn immer noch, dass er nicht selbst gewonnen hat.
„Tatsächlich?“, fragt der Rechtsmediziner im selben Moment, als die Krieger „Das ist doch nun echt nicht wichtig“ zischt.
Die Russin räuspert sich, ohne die Nase vom Rücken des Toten zu heben. Offenbar ist sie nicht sehr angetan von jeglicher fachfremden Konversation.
„Elf Einstiche, das entspricht dem äußeren Erscheinungsbild“, verkündet sie in die entstehende Stille. Ihr Deutsch ist beinahe akzentfrei, nur ein minimaler slawischer Zungenschlag verrät bei sehr genauem Hinhören ihre Herkunft. Sie hebt den rechten Arm des Toten, tappt in ihren grünen Gummiclogs um den Obduktionstisch herum, wiederholt das Prozedere auf der anderen Seite. „Ich erkenne immer noch keine Abwehrverletzungen“, sagt sie.
„War er sofort tot?“, fragt die Krieger.
Unentschlossen wiegt die Petrowa den Kopf, macht sich dann wieder an den Wunden zu schaffen. Diktiert ihre Beschreibungen ins Mikrofon, das über dem Obduktionstisch baumelt. Spreizt mit einer Pinzette die Wundränder und schiebt einen Messstab hinein.
„Zwei Stiche sind ins Herz gegangen, fünf weitere haben die Lungen punktiert“, sagt sie schließlich. „Ich kann nicht sagen, welcher der Stiche ihm zuerst zugefügt wurde.“
Irgendwann in dieser Nacht, während er mit den Spurensicherern im Müll rumwühlte, hat Manni plötzlich geglaubt, jemand beobachte ihn. Er hat den anderen nichts gesagt, weil absolut niemand zu sehen war, aber ein unangenehmes Gefühl von Verletzlichkeit ist geblieben. Hätte er bemerkt, wenn sich jemand bis dicht an ihn herangeschlichen hätte? Wäre er schnell genug gewesen, sich zu wehren? Wie viel Zeit hat man dafür, mit einem Messer im Rücken? Hat man überhaupt eine Chance? Wieder spreizt die Russin Wundränder auseinander, späht in die dunkel verkrustete Höhle.
„Das reinste Gemetzel.“ Judith Krieger betrachtet die bräunlichen Stichwunden auf dem käsigen, teils dunkel behaarten Rücken mit Widerwillen.
„Ein Profi tötet anders“, bestätigt die Petrowa. „Effektiver.“ Ihre Kohleaugen glühen.
„Was wissen wir über die Tatwaffe?“
Die Petrowa beugt sich tiefer über den Leichnam. Sie wechselt einen schnellen Blick mit Karl-Heinz Müller, bevor sie Judith Krieger antwortet.
„Einschneidig. Scharf.“
„Vermutlich ist die Klinge glatt.“ Auch Karl-Heinz Müller hängt jetzt so dicht über dem Opfer, dass sein Mundschutz beinahe dessen Haut berührt. „Der Täter ist Rechtshänder, würde ich tippen. Etwa so groß wie das Opfer, vielleicht etwas größer. Die Klingenlänge können wir erst beziffern, wenn wir fertig untersucht haben. Das kann dauern. Verdammt viel Arbeit ist das, jede einzelne Wunde aufzubereiten.“
Als sei das Wort „Arbeit“ ein Code, beginnt Judiths Handy Rockmusik zu dudeln. Sie dreht sich weg, hält ihr freies Ohr zu, um das halblateinische Fachkauderwelsch, mit dem sich Müller und sein Talent über ihre Beobachtungen verständigen, auszublenden.
„Auf Bergers Schuhen sind fremde Fingerabdrücke“, berichtet sie, als sie ihr Telefonat beendet hat.
„Von seinem Schuhverkäufer.“
„Klaus sagt, die Schuhe sind nicht neu und auch nicht frisch besohlt. Die Schnürsenkel waren offen, ist dir das aufgefallen?“
„Jemand wollte ihm die Schuhe ausziehen.“
„Und wer?“ Judith Krieger lehnt sich an einen freien Obduktionstisch.
„Wenn unser Täter tatsächlich ein Tippelbruder ist, macht das doch Sinn. Jacke, Rucksack, Schuhe – kann er alles gebrauchen. Und dann kommt unser Zeuge und stört ihn, also haut er ab.“ Manni betastet seinen Nacken. Eine Massage täte jetzt gut. Nicht nur im Nacken. Von Sonja.
„Okay, angenommen, es war ein Obdachloser. Wie ist er zum Tatort gekommen?“ Der sonst so auffällige türkisblaue Rand um die grauen Iris der Krieger ist im grellen Licht der Obduktionslampen kaum zu erkennen.
„Er hat die Endstation verpennt“, schlägt Manni vor.
„Mag sein.“ Sehr überzeugt sieht seine Kollegin nicht aus.
„Berger schmeißt ihn raus, da wird er sauer. Wartet, bis der ihm den Rücken zukehrt, dann sticht er zu.“
„Elf Mal?“
„Vielleicht ist er durchgeknallt. Oder er wollte einfach nur sichergehen, dass Berger wirklich tot ist.“
„Hass.“ Judith Krieger fixiert den toten S-Bahn-Fahrer, als erwartete sie, dass der diese Theorie bestätigt.
Schweigend sehen sie zu, wie die Russin ihre Pinzetten und Messer in den ohnehin schon geschundenen Rücken pikt. Wie immer bei Obduktionen ist Karl-Heinz Müller bester Laune. Er klimpert mit seinen Instrumenten und pfeift Kalinka, ein offensichtlicher Tribut an seine Kollegin, die dies jedoch völlig kaltzulassen scheint. Ohne eine Miene zu verziehen, schnippelt sie an Berger herum. Wenigstens hat der noch nicht begonnen zu stinken. Man muss ja für die kleinen Freuden dankbar sein. Die Erinnerung an das ungute Gefühl während der fruchtlosen nächtlichen Sucherei drängt sich erneut in Mannis Bewusstsein. Hat ihn tatsächlich jemand beobachtet, oder hat er sich das nur eingebildet?
Er räuspert sich. „Vielleicht wusste der Täter, wann Berger Pause macht, und hat ihm neben den Gleisen aufgelauert.“
„Wenn es so war, muss es eine Beziehung zwischen Berger und dem Täter geben“, sagt Judith Krieger. „Vielleicht hat einer der Anwohner was gesehen. Oder die Kameras. Die Kriminaltechnik ist dran, Ralf Meuser klappert die Häuser ab. Lass uns jetzt erst mal in Bergers Wohnung fahren.“
Ein rotgesichtiger Hausmeister empfängt sie im Parterre des Ehrenfelder Hochhauses, in dem der S-Bahn-Fahrer für 447 Euro Warmmiete 59 Quadratmeter im sechsten Stock angemietet hatte. Die Wohnung ist spartanisch eingerichtet. Sofa, Schrankwand, Esstisch, Fernseher und Stereoanlage im Wohnzimmer. Eine winzige Küche mit vergilbten Hängeschränken. Das Schlafzimmer müffelt nach Schmutzwäsche. Über dem französischen Bett hängt das Acryllackgemälde einer sich am Meer räkelnden, nackten Blondine, die ihre unnatürlich spitzen, aufrecht stehenden Kegelbrüste einem Schwan offeriert. Die Farbgebung soll wohl Romantik demonstrieren: Rot, Orange und Schwarz dominieren.
„Sehr hübsch.“ Die Krieger zieht die Augenbrauen hoch.
Manni öffnet die Schublade des Nachttischschränkchens. Nasentropfen, Taschentücher und Pornoheftchen, geschmacklos, aber legal. Das fensterlose Bad riecht nach Schimmel, die Armaturen sind blind von Kalk. Es gibt nur eine Zahnbürste und kein Parfum, keine Tampons, keinen Lippenstift, einfach nichts, was auf die Anwesenheit einer Frau in Bergers Leben hindeuten würde. Die Innenseite der Schranktüren in Schlafzimmer und Küche sind mit Playboy-Pin-ups dekoriert. Schwul war Berger wohl jedenfalls nicht.
„Er hat kein Telefon.“ Die Krieger tigert auf und ab, ihre latexbehandschuhten Hände fingern routiniert durch Schubladen und Schränke.
„Vielleicht reichte ihm sein Handy.“
„Und wo ist das?“
Entnervt sehen sie sich an. Die Jacke. Der Rucksack. Immer wieder läuft es darauf hinaus. Sie teilen sich auf, während sie auf die Ankunft der Spurensicherung warten. Manni übernimmt das Schlafzimmer, Judith den Wohnraum. Wie hat Berger gelebt? Wofür hat er sich interessiert, von nackten Frauen einmal abgesehen? Wer könnte ihn so sehr gehasst haben, dass er ihn ermordete? Die Wohnung verrät es nicht, alles in ihr erscheint unpersönlich.
Der Vibrationsalarm seines Handys enthebt Manni weiterer Grübeleien.
„Ich habe für morgen Mittag Sauerbraten eingelegt! Den isst du doch so gern.“
„Tut mir leid, Ma, ich hab einen Fall.“
Er wimmelt seine Mutter ab, versucht, sich deswegen nicht wie ein Schwein zu fühlen. Judith Krieger steht mit einem Packen Rechnungen in der Hand im Wohnzimmer und schaut den staubblinden Fernseher an. Ganz still, ganz konzentriert, als warte sie auf etwas, nein, als bereite sie sich auf einen Zweikampf vor. Kriegerin. Irgendetwas an ihrem Gesichtsausdruck verunsichert Manni.
„Der war ganz schön allein“, sagt sie leise, als sie auf ihn aufmerksam wird.
Ja, verdammt, wer ist das nicht, denkt er.














DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.