

Leben unter Rehen
Sieben Jahre in der Wildnis
„Es mag schon viele Bücher über den Wald und seine Bewohner gegeben haben, ein solches - zugleich lehrreich und amüsant, spannend und berührend - dürften Sie indes noch nicht gelesen haben.“ - tam.tam. Das Stadtmagazin
Leben unter Rehen — Inhalt
Eine berührende Aussteigergeschichte, die einen faszinierenden Blick auf die Tiere des Waldes gewährt
Der mit den Rehen lebt
Schon als Teenager sind ihm die Tiere näher als die Menschen. Am liebsten streift Geoffroy Delorme in den Wäldern hinter seinem Elternhaus in der Normandie umher. Als er eines Tages auf einen neugierigen Rehbock trifft, der schnell Vertrauen zu ihm fasst, schließt er sich ihm an.
In den folgenden Jahren kehrt Delorme immer seltener und schließlich gar nicht mehr in die Zivilisation zurück. Ohne Decke und Zelt lebt er bei den Rehen. Er orientiert sich an ihrem Schlafrhythmus und lernt, wie man ein Revier anlegt und nährstoffreiche Pflanzen findet. Wie man sich nachts warm hält und im Wechsel der Jahreszeiten überlebt. Dabei wird er Zeuge, wie Kitze geboren werden, aber auch, wie Jäger die Tiere abrupt aus dem Leben reißen.
„Atemberaubend, bescheiden und gefühlvoll“ Arte
In dem tief bewegenden Bestseller aus Frankreich erzählt der junge Autor zärtlich und voller Demut davon, wie er sich auf der Suche nach einem erfüllten Leben von der menschlichen Gesellschaft abwendet. Von der Kompromisslosigkeit und zugleich heilenden Kraft der Natur. Und von der faszinierenden, uns oftmals verborgenen Welt der Waldbewohner.
- Die einzigartige Geschichte eines jungen Mannes auf der Suche nach einem erfüllten Leben
- Mit seltenen Einblicken in das Leben der Rehe und anderer Waldbewohner
- Über den Wald als Kraft- und Rückzugsort
Leseprobe zu „Leben unter Rehen“
Prolog
Mann oder Frau? Meine Augen haben längst die Fähigkeit verloren, solche Details auf eine Entfernung von mehr als dreißig Metern wahrzunehmen. Springt da etwa ein Tier neben ihm oder ihr herum? Nein, bitte nicht, bitte kein Hund!
Ich muss die beiden aufhalten, ehe sie meine Freunde in die Flucht schlagen.
Genau wie sie lege ich inzwischen ein ausgeprägtes Territorialverhalten an den Tag. Wer immer mein Revier betritt, wird als potenzielle Gefahr wahrgenommen. Ich habe dann das Gefühl, dass meine Privatsphäre verletzt wird. Mein „Territorium“ hat [...]
Prolog
Mann oder Frau? Meine Augen haben längst die Fähigkeit verloren, solche Details auf eine Entfernung von mehr als dreißig Metern wahrzunehmen. Springt da etwa ein Tier neben ihm oder ihr herum? Nein, bitte nicht, bitte kein Hund!
Ich muss die beiden aufhalten, ehe sie meine Freunde in die Flucht schlagen.
Genau wie sie lege ich inzwischen ein ausgeprägtes Territorialverhalten an den Tag. Wer immer mein Revier betritt, wird als potenzielle Gefahr wahrgenommen. Ich habe dann das Gefühl, dass meine Privatsphäre verletzt wird. Mein „Territorium“ hat einen Radius von fünf Kilometern. Sobald ich jemanden bemerke, folge ich ihm, spähe ihn aus, sammle Informationen. Wenn diese Person zu oft in mein Gebiet zurückkehrt, unternehme ich alles, um sie zu vertreiben.
Ich verlasse das Unterholz, fest entschlossen, den Eindringling aufzuhalten. Ein kräftiger, sehr süßlicher Geruch nach Veilchen steigt mir aufdringlich in die Nase. Mein Spaziergänger muss also eine Frau sein. Während ich den schmalen Waldweg weitergehe, wird mir bewusst, dass ich seit Monaten kein Wort mehr mit einem Menschen gesprochen habe. Ich lebe jetzt seit sieben Jahren im Wald und kommuniziere ausschließlich mit Tieren. In den ersten Jahren bin ich noch zwischen der Menschenwelt und der Wildnis hin- und hergependelt, aber mit der Zeit habe ich dem, was man „Zivilisation“ nennt, endgültig den Rücken gekehrt, um mich meiner wahren Familie anzuschließen: den Rehen.
Je weiter ich auf dem schmalen Waldweg vorwärtsgehe, desto mehr steigen auf einmal Gefühle in mir auf, von denen ich glaubte, ich hätte sie vollkommen aus meinem Leben gestrichen. Wie sehe ich aus? Was ist mit meinen Haaren? Sie haben schon seit Jahren keinen Kamm mehr gesehen und wurden immer nur „blind“ mit einer kleinen Nähschere geschnitten. Zum Glück habe ich einen sehr spärlichen Bartwuchs. Und meine Kleidung? Meine Hose ist so dreckverkrustet, dass sie ganz von allein stehen könnte, aufrecht, wie eine Skulptur. Wenigstens ist sie heute trocken.
Zu Beginn meines Abenteuers habe ich mich immer mal wieder in einem kleinen Spiegel betrachtet, den ich in einer kleinen, runden Dose aufbewahrte, aber die Zeit, die Kälte, die Feuchtigkeit haben den Spiegel blind werden lassen, und so weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie ich aussehe.
Es ist also eine Frau. Ich muss höflich sein, um sie nicht zu verschrecken. Aber Vorsicht, man kann nie wissen! Womit soll ich beginnen? „Bonjour“, ja, „Guten Tag“, das ist gut. Nein, besser „Bonsoir“, „Guten Abend“. Denn der Tag geht schon zu Ende.
„Bonsoir …“
„Bonsoir, Monsieur.“
1
Schon als kleiner Junge, als ich in der Wärme des Unterrichtsraums der ersten Klasse die Grundlagen für mein zukünftiges Leben erfahre – ich lerne lesen, schreiben, rechnen und wie ich mich in der Gesellschaft zu verhalten habe –, lasse ich mich leicht ablenken und bewundere durch das Fenster die Erhabenheit der Wildnis. Ich beobachte die Spatzen, Rotkehlchen, Meisen, alle Tiere, die in meinem Blickfeld auftauchen, und ich beneide diese Tiere um das Glück, eine solche Freiheit genießen zu können. Ich dagegen bin in diesen Raum zusammen mit anderen Kindern eingesperrt, denen es hier offensichtlich gefällt, während ich mich schon mit meinen sechs Jahren nach dieser Freiheit sehne. Ich kann mir natürlich vorstellen, wie hart das Leben dort draußen sein muss, aber die Betrachtung dieses einfachen, heiteren, wenn auch gefährlichen Daseins lässt in mir ein erstes inneres Auflehnen gegen das Konzept eines Lebens aufkeimen, in das man mich meinem Gefühl nach pressen will. Dieses Gefühl hatte ich schon früh. Jeder Tag, den ich an diesem Fenster ganz hinten im Klassenzimmer verbringe, entfernt mich ein wenig mehr von den sogenannten gesellschaftlichen Werten, während die Wildnis mich so unweigerlich anzieht wie ein Magnet eine Kompassnadel.
Einige Monate nach Beginn des Schuljahrs lässt ein auf den ersten Blick banales Ereignis diesen Keim der Auflehnung weiterwachsen. Als ich eines Morgens in die Klasse komme, erfahre ich, dass ein Ausflug ins Schwimmbad ansteht. Da ich von Natur aus etwas ängstlich bin, befürchte ich das Schlimmste. Am Beckenrand erstarre ich. Ich stehe zum ersten Mal vor einer solchen Menge Wasser, und da ich noch nie in meinem Leben geschwommen bin, überkommt mich eine instinktive Furcht. Alle anderen Kinder scheinen sich wohlzufühlen, während ich völlig verkrampfe.
Die Schwimmlehrerin, eine rothaarige Frau mit einem langen, streng wirkenden Gesicht sagt mir, ich solle ins Wasser gehen. Ich weigere mich. Sie runzelt die Stirn und fordert mich in schärferem Ton auf, ins Becken zu springen. Ich weigere mich erneut. Plötzlich stürmt sie zackig auf mich zu, packt mich an der Hand und stößt mich mit Gewalt ins Becken. Zwangsläufig schlucke ich Wasser, und da ich nicht schwimmen kann, gehe ich zunächst unter. Während ich verzweifelt mit den Armen rudere, sehe ich, dass meine Peinigerin ins Wasser springt und in meine Richtung kommt. Panik überfällt mich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie mich umbrin-
gen will!
Mein Überlebensinstinkt treibt mich zu einer völlig unmöglichen Aktion. Wie ein kleiner Hund strample ich in die Mitte des Beckens und tauche unter dem Sicherheitsnetz durch, das mich vom Schwimmerbereich trennt, weil ich unbedingt auf die andere Seite gelangen will. Nachdem ich den Beckenrand dort erreicht habe, klettere ich die Leiter hoch und flüchte mich in die Umkleide. Ich streife rasch meine Hose und mein T-Shirt über.
Inzwischen ist auch meine Schwimmlehrerin aus dem Wasser gekommen und sucht mich überall. Das Platschen ihrer schweren Schritte auf dem nassen Boden zeigt mir an, dass sie den schmalen Gang zwischen den Kabinen entlangkommt. Ich habe mich in der dritten auf der linken Seite eingeschlossen. Sie öffnet die erste Tür, die anschließend laut zuknallt. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Sie öffnet die zweite Tür, die ebenfalls geräuschvoll zufällt. Es ist schrecklich laut, und ich habe den Eindruck, dass sie jede Tür, vor der sie sich aufbaut, mit den Füßen eintritt.
In meiner Panik quetsche ich mich durch den Spalt unter den Zwischenwänden und dem Boden und robbe von einer Kabine in die nächste. Am Ende der Reihe nutze ich die paar Sekunden Vorsprung, in denen sie eine weitere Kabine inspiziert, um auf die andere Seite zu schlüpfen, und schlendere dann unauffällig zum Ausgang. Als ich endlich draußen bin, renne ich mit von Tränen und Chlor verschleierten Augen die Straße entlang, ohne nach rechts oder links zu schauen, bis ein mir vertraut wirkender Mann mich aufhält, meine Hand nimmt und mich auffordert, mit ihm zu kommen. Es ist der Busfahrer. Er hat beobachtet, wie ich ganz allein aus dem Schwimmbad gerannt kam, und die Geistesgegenwart besessen, mir zu folgen. Schluchzend erkläre ich ihm, was passiert ist und warum ich auf keinen Fall ins Schwimmbad zurückwill. Seine Stimme und seine Worte beruhigen mich ein wenig.
Nachdem mein kleines Abenteuer nun beendet und die Schwimmlehrerin darüber informiert ist, wo ich gelandet bin, sitze ich schließlich ganz allein hinten im Bus, während meine Mitschüler, aber auch die Lehrer mich anstarren wie ein wildes, gefährliches Tier, das man im Auge behalten muss. Nach diesem Zwischenfall wird deshalb beschlossen, dass ich die Schule verlassen und zu Hause mit Unterstützung des Nationalen Instituts für Fernausbildung unterrichtet werden soll.
Nun sitze ich also allein in meinem Zimmer, isoliert von der Außenwelt, ohne Mitschüler oder Lehrer. Zum Glück finde ich im Haus eine große Bibliothek mit literarischen Schätzen vor (Nicolas Vanier, Jacques Cousteau, Dian Fossey, Jane Goodall etc.), in denen über die Natur und über das Leben in der Wildnis berichtet wird. Ich verschlinge ebenso alle Nachschlagewerke, in denen diese Themen kindgerecht aufbereitet sind. Eine wahre Goldgrube an wertvollen Informationen, die ich danach gleich in meinem Umfeld, in unserem Garten, anzuwenden versuche. Ein Apfelbaum, ein Kirschbaum, Berberitzenhecken, Zwergmispeln, Feuerdorn, einige Rosenstöcke, es gibt so viel rund ums Haus meiner Familie, um sich die Langeweile zu vertreiben. Mich um all diese Pflanzen zu kümmern wird bald die beste Möglichkeit, dem tristen Alltag zu entfliehen.
Eines Morgens entdecke ich, dass in der Hecke gegenüber von meinem Zimmer ein Paar Amseln sein Nest gebaut hat. In meinem Kinderhirn sehe ich mich sofort in der Pflicht: Ich muss sie beschützen! Wie ein Parkwächter drehe ich meine Runden an der Hecke, um die Katzen zu verjagen, die von der Witterung leichter Beute angelockt werden. Zu allen Tages- und Nachtzeiten, sobald die Aufmerksamkeit der Erwachsenen nachlässt, öffne ich mein Fenster und schlüpfe katzengleich leise nach draußen, um nachzuschauen, wie es meiner gefiederten Kleinfamilie geht. Je öfter sie mich sehen, desto mehr scheinen sie sich an mich zu gewöhnen. Ich gebe ihnen Futter, Brotkrumen, Regenwürmer oder Insekten, die ich auf einen Teller lege. Die Eltern picken das Futter auf und bringen es den Jungvögeln.
Mit jedem Tag gewinne ich mehr und mehr ihr Vertrauen. Inzwischen darf ich sogar meinen Kopf in die Hecke stecken und die piepsenden Babys aus zwanzig Zentimeter Entfernung betrachten. Als endlich der große Moment da ist, an dem sie das Nest zum ersten Mal verlassen sollen, kommt der Vater als Erster heraus. Die Kleinen hüpfen hinter ihm her und plumpsen ungeschickt auf den Boden. Die Mutter bildet die Nachhut. So drehen sie ihre Runden um die Hecke. Manchmal kommen sie auch zu mir. Ich habe das Gefühl, dass sie sich dem kleinen, neunjährigen Jungen, der ich mittlerweile bin, vorstellen wollen. Das Herz klopft mir bis zum Hals. Es ist mein erster Kontakt mit der freien Natur, und um ihn festzuhalten, mache ich ein Foto von den Vögelchen und schicke es meiner Fernlehrerin, Madame Krieger.
Bei jedem Spaziergang weite ich meine Erkundungen etwas aus. Hinter der Hecke ist ein Zaun, unter dem ein Loch gegraben wurde, wahrscheinlich waren es Füchse. Ich kann daher problemlos darunter hindurchschlüpfen und das angrenzende Feld auf der Suche nach weiteren Abenteuern durchstreifen. Die ersten Male, als ich in der vom Mond nur spärlich erleuchteten Nacht losziehe, wird mein Freiheitsdrang stets von Furcht dominiert und der Wissensdurst des kleinen Abenteurers von der Vorsicht des braven kleinen Jungen ausgebremst. Aber der unwiderstehliche Lockruf der Natur lässt bald das Pendel zur Seite des wilden Lebens ausschlagen. Und auf dieser neuen Spielwiese erwachen all meine Sinne.
Während ich mich auf meinen Weg konzentriere, erfasse ich die Topografie und die Beschaffenheit des Bodens. In jeder Nacht ersetzt der Tastsinn das Sehen, und mein Körper lernt das Gelände so gut kennen, dass ich mich selbst mit geschlossenen Augen zurechtfinde. Hier haben sich ähnliche Gedächtnisprozesse in Gang gesetzt wie im Haus, wo man mitten in der stockfinsteren Nacht aufstehen kann und genau weiß, wo der Lichtschalter ist, nur dass ich dies nun in der freien Natur erlebe. Auch die Gerüche verändern sich. Brennnesseln riechen zum Beispiel in der Nacht viel intensiver. Selbst die Erde verströmt einen anderen Duft. Und wenn die feuchten Dünste des Tümpels von Petit Saint-Ouen in meine Nase dringen, weiß ich, dass mein Ausflug bald zu Ende ist. Denn wenn ich noch etwas weiter gehe, komme ich zum Haus des Försters. Und dahinter liegt der Wald, das Unbekannte. Die Ziegenmelker kreisen über mir, ihr Flug erzeugt ein merkwürdig schnurrendes Geräusch, rau und monoton. Ich habe keine Angst mehr, ich fühle mich wohl hier.
Tief in meinem Inneren ist ein instinktiver Freiheitsdrang verwurzelt, der mich antreibt auszubrechen, sobald sich mir die Gelegenheit dazu bietet. Und nur eine Regel scheint mir wert, respektiert zu werden: das Gesetz der Natur. Ich breche niemals einen Ast ab, rühre nicht einmal abgestorbenes Holz an. Ich denke mir auch immer ausgeklügeltere Rituale aus, die fast schon ans Absurde grenzen. So gehe ich an großen Bäumen niemals links vorbei, denn ich habe das unbestimmte Gefühl, dass ich weit mehr und bedeutsamere Dinge erlebe, wenn ich rechts an ihnen vorbeigehe. Auf diese Weise baue ich mir meine eigene Vorstellungswelt auf, meine eigene Spiritualität, meine Beziehung zur Natur, einerseits rational und faktenbasiert, andererseits von einem kindlich naiven Mystizismus geprägt.
Seit einiger Zeit kommt ein Fuchs in unseren Garten, um dort unter einem Baum mit buschiger Krone zu schlafen. An einem Winterabend folge ich ihm schließlich auf seinem Weg zurück über die Felder. Als ich am Forsthaus ankomme, sehe ich, wie er einfach weitertrottet. Nun ist es an der Zeit, den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Hundert Meter weiter zeigt mir der junge Reineke Fuchs den Zugang zu seinem Bau. Ich habe mich noch nie so weit von meinem Zimmer entfernt.
Der Wind, der immer aus der gleichen Richtung weht, trägt alle Gerüche vom Feld mit sich. Die Lichtverhältnisse verändern sich, plötzlich ist es richtig dunkel. Auch die Geräusche verändern sich. Auf einmal umgeben mich unzählig viele neue Laute, denn dort in der Tiefe des Waldes ist das Leben. Ich wage mich etwa fünfzig Meter hinein, genau so weit, um den kleinen Adrenalinkick zu spüren, den das Geheimnis hervorruft, ehe ich umkehre. In Wirklichkeit gibt es hier nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Die Gefahr kommt niemals aus dem Wald. Die Tiere wissen, dass man sich vielmehr vor dem Feld in Acht nehmen muss.
Der Wald ist so faszinierend und übt einen Zauber auf mich aus. Jede Nacht wage ich mich etwas weiter vor, immer ganz vorsichtig, um nichts zu überstürzen. Und eines Nachts stehe ich auf einmal Auge in Auge einem Hirsch gegenüber. Im Herbst habe ich sie oft röhren gehört, aber ich habe es nie gewagt, mich ihnen zu nähern. Ihr raues Brüllen mitten in der Nacht war doch zu einschüchternd für einen zehnjährigen Jungen. Auch bei dieser unerwarteten Begegnung stehe ich wie angewurzelt da. Dieser massige Körper kaum zehn Meter von mir entfernt, der Boden, der unter jedem seiner Schritte erbebt, ich fühle mich von der Kraft überwältigt, die von dieser Kreatur ausgeht. Mein Herzschlag muss einige Hundert Kilometer weit zu hören sein.
Plötzlich wendet sich der Hirsch mir zu und röhrt los. Die Hirschkühe in seiner Umgebung antworten mit einem etwas helleren Ton, aber immer noch sehr laut. Jeder Grunzlaut dieses Hirsches lässt meinen Brustkorb erbeben wie die Bassfrequenzen einer Lautsprecherbox. Schließlich dreht er ab. Ich kehre ebenfalls um, um ihm zu zeigen, dass ich nicht seinetwegen gekommen bin. Und so gehen wir auseinander wie zwei Lebewesen, die durch die verschlungenen Pfade des Waldes zusammengeführt wurden.
Als ich etwas später leise unter meine Decke schlüpfe, wird mir klar, dass dieser Hirsch mir die schönste Lektion meines noch kurzen Lebens erteilt hat: Tiere wollen mir nichts Böses. Ich möchte am liebsten sofort wieder dorthin zurückkehren, aber ich muss geduldig sein. Die Wildnis öffnet sich einem nicht auf den ersten Blick.
Von da an klettere ich aus dem Fenster meines Zimmers, sobald alles im Haus schläft, schlüpfe hinter die Amselhecke und unter dem Zaun hindurch und laufe durch das Feld der Ziegenmelker hin zum Helldunkel der großen Bäume und zum lebendigen Treiben der Tiere. Die Füchse, die mich als Erste hierhergeführt haben, bringen mich zu ihren Nachbarn, den Dachsen. Hoch über mir entdecke ich die Eulen und Uhus. Wenn es ein Tier im Wald gibt, das einem eine Gänsehaut bescheren kann, dann ist das zweifelsohne der Uhu. Ein lautloser Räuber, der vor nichts und niemandem Angst hat. Durch die andauernden leisen Geräusche, die den Wald erfüllen, hört man gar nicht, wie er heranfliegt, und wenn man seine Neugier geweckt hat, dann zögert er nicht, auch ganz nah zu kommen.
Als ich das erste Mal einem Uhu begegne, bin ich noch tief verstört von den dantesken Szenen aus dem Film Jurassic Park. Ohne dass ich es mitbekomme, lässt sich der Vogel etwa zwei Meter von mir entfernt auf einem Ast nieder. Plötzlich stößt er ohne Vorankündigung sein „Buho“ aus. Ich mache einen Satz rückwärts, stolpere dabei über einen Baumstumpf, und auf einmal liege ich mit dem Hintern im Dreck und strecke mit weit aufgerissenen Augen alle viere von mir.
Das nächtliche Treiben im Wald ist aufregend. Zahlreiche Tiere, kleine wie große, verbringen den Hauptteil ihres aktiven Lebens in der Nacht. Einige dagegen scheinen sich niemals auszuruhen. Wie zum Beispiel die Eichhörnchen, die ich tagsüber in meinem Garten herumhuschen sehe und die dann auch in der Nacht überall herumlaufen. Wann finden sie eigentlich die Zeit zum Schlafen? Diese Frage beschäftigt mich, bis ich meinen Irrtum begreife. Als ich in einem Buch mit vielen detaillierten Abbildungen über das Leben im Wald blättere, wird mir klar, dass die kleinen hyperaktiven Nager, die ich in der Nacht beobachte, nicht etwa Eichhörnchen sind, sondern Siebenschläfer. Ihr buschiger Schwanz hat mich in die Irre geführt.
All diese Erlebnisse in meiner Kindheit scheinen mir etwas sagen zu wollen, nämlich dass die Wildnis irgendwo da draußen auf mich wartet. Und sobald ich mich von der Bürde der menschlichen Zwänge befreit habe, wird der Wald da sein, um mich aufzunehmen. Ich glaube so sehr an diese Bestimmung, dass ich manchmal mit fest geballten Fäusten einschlafe und bete, dass ich mich in einen Fuchs verwandle, damit ich in aller Frühe, wenn ich das Fenster meines Zimmers öffne, dort hinausschlüpfen und hin zu dieser grenzenlosen Freiheit des Waldes traben kann, die meine Fantasie so anregt.
Die Realität ist weitaus weniger aufregend. Ich lebe fast vollkommen für mich allein, ohne Freunde oder Mitschüler, für mich gibt es auch keine Ferien oder Schulausflüge, und bis auf meine nächtlichen Streifzüge sitze ich an meinem Schreibtisch, um im Fernunterricht mit Lehrern zu lernen, die am anderen Ende von Frankreich leben, oder drehe mit meinem Fahrrad ein paar Runden im Garten. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen ich mal vor die Tür darf, zum Beispiel zum Einkaufen, werde ich manchmal von den Händlern gefragt, wie denn das mit dem Fernunterricht läuft. Allen antworte ich, dass das genau zu mir passt, denn auch wenn ich tief im Inneren fühle, dass etwas daran nicht richtig ist, habe ich keine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Kindern.
Aber ehrlich gesagt, wird dieses Leben, das man mir auferlegt hat, immer mehr zu einem psychischen Leidensweg. Deshalb beschließe ich, als ich sechzehn bin, dass ich nicht nur meine Nächte, sondern auch meine Tage im Wald verbringen möchte. Den Höhepunkt erreicht diese Rebellion am Tag der Abiturprüfung. Ich beende meine schulische Laufbahn, indem ich die Einladung zu dieser Prüfung in ein Maisfeld werfe.
In den Jahren davor habe ich ein starkes Interesse für naturalistische Zeichnungen entwickelt, weshalb ich gerne eine Ausbildung zum Grafiker machen möchte. Doch man verlangt von mir, ich solle Kurse in „Handelsaktivitäten und Handelskommunikation“ belegen. Ich verstehe nicht einmal, was diese Worte bedeuten sollen. Schließlich willige ich um des lieben Friedens willen ein, wenigstens eine kaufmännische Grundausbildung zu absolvieren, da man mir zum Ausgleich einen Fernkurs in Fotografie zugesteht.
Meine Leidenschaft für die Tierwelt der Wildnis hält an, und ich habe die Absicht, irgendetwas daraus zu machen. Durch meine Streifzüge in den Wald wird mir bewusst, dass die Tiere meinen Geruch, meine unterschiedlichen Stimmungen und mein Verhalten erkennen. Sie akzeptieren mich in ihrem Umfeld, bis ich ein Teil der Kulisse werde. Dafür brauche ich viel Zeit, ich bleibe tagelang, ja ganze Wochen im Wald unter dem Vorwand, dass ich eine langwierige Fotoaufgabe zu erledigen habe. Wenn ich wieder nach Hause komme, erklärt man mir, dass das doch kein Beruf sei und dass ich von dieser Tätigkeit nicht leben könne. Aber das Geld ist für mich nicht das Wichtigste. Ich suche seelischen Halt. Wenn ich im Moment lebe, ganz nach dem Beispiel der Tiere des Waldes, fühle ich mich genau an meinem Platz innerhalb der Ordnung der Dinge. Die Tiere zeigen mir, dass ich, je mehr ich denke, umso mehr überall Gefahren lauern sehe. Die Probleme meiner Vergangenheit oder diejenigen, die mit der Ungewissheit, wie meine Zukunft aussieht, verbunden sind, sowie mein Wunsch, die Herrschaft über die Gegenwart zu behalten, ohne mich unterkriegen zu lassen, zermürben mich allmählich. Während das Beobachten der Natur, die mich umgibt, wenn ich die Wildnis ganz in mich aufsauge, meinen Geist auf tausenderlei Art weckt und ihn wacher und klarer macht.
Seit ein paar Monaten habe ich kein Zeitgefühl mehr, kein Gefühl mehr dafür, wie viele Stunden und Tage ich im Wald verbracht habe. Mein Leben ist intensiver geworden, und mich erfüllen immer mehr Freude, Staunen und Gelassenheit. Trotzdem verliere ich nicht den Sinn für die Realität. Um nicht in Armut zu versinken, mache ich für einige Lokalzeitungen ein paar Sportberichterstattungen mit Fotos, davon kann ich mir dann Kleidung und Lebensmittel kaufen.
Doch offensichtlich glaubt niemand an mich, und ich erfahre keinerlei moralische Unterstützung. Man will mich ködern, indem man mir beweist, dass das „Rudel“ mich beschützen und ich allein nicht lange überleben würde. Aber je mehr man versucht, mich zu halten, desto mehr lockern sich die Bande. Und dann kommt es eines Tages zum Bruch. Meine Entscheidung steht fest, ich breche in den Wald auf. Eine Fabel von Jean de La Fontaine beschreibt ziemlich genau, was ich in diesem Moment fühle. Diese Fabel heißt „Der Wolf und der Hund“ und geht folgendermaßen:
Ein Wolf war nichts als Haut und Knochen,
Die treuen Hunde waren schuld daran.
Wie er nun einst so matt des Wegs gekrochen,
Traf er die schönste, stärkste Dogge an,
Die sich vom Herrenhof verlaufen hatte.
Der Hund war solch ein fester, wohlgenährter Klotz,
Dass neben ihm der Wolf nur eine hagre Latte.
So gern der’s auch getan, so schien’s ihm leider Gotts
Höchst ungeraten, diesen Burschen anzuspringen,
Denn solch ein Gegner war so leicht nicht zu verschlingen.
So also sprach voll Demut unser Wolf ihn an
Mit Komplimenten über seine Wohlgestalt.
Da sprach der Hund: „Mein schöner Herr, liegt Euch daran,
So fett zu sein wie ich, nun, so verlasst den Wald,
In dem nur arme Schlucker lungern.
Ihr lebt ja nur, um zu verhungern,
Habt Tag und Nacht nicht Ruh und nichts zu schnabulieren;
Folgt mir, Ihr werdet ein vergnügtres Leben führen.“
Da sprach der Wolf: „Was hätte ich dafür zu leisten?“
Der Hund: „Fast nichts! Nur Leute zu verjagen,
Die Bettelsäcke oder Stöcke tragen,
Dem Hausgesind zu schmeicheln, und am meisten
Dem Herrn. Als Sold bekommt Ihr schöne Rester,
Hühner- und Taubenknochen – ja, mein Bester! –
Und manches Kosewörtchen obendrein.“
Der Wolf glaubt schon, im Paradies zu sein.
Er weint vor Glück und will den Hund begleiten.
Da sieht am Hundehals er eine Stell,
Wo abgeschabt erscheint das schöne Fell.
„Was ist das?“, fragt er. – „Nichts!“ – „Wieso?“ –
„Ach, Kleinigkeiten!“ –
„Nun was denn?“ – Drauf der Hund:
„Das Halsband meiner Kette rieb mich wund.“ –
„Wie? Was? In Ketten dienet Ihr?
Lauft nicht, wohin Ihr wollt?“ –
„Nicht immer. Doch was tut’s?“ – „Es tut so viel, dass mir
Die Lust vergeht nach Eurem schönen Sold.
Ich ging nicht mit um eine ganze Kuh!“
Und Meister Wolf hat sich getrollt
Und läuft noch immerzu.
Schon als Junge faszinierte dich der Wald hinter deinem Elternhaus. Hattest du auch manchmal Angst davor?
Der Wald hat mich nie beängstigt. Im Gegenteil, er hat mich schon immer magisch angezogen. Was sicher mit der Abgeschiedenheit zu tun hat, die ich in meiner Kindheit erlebte. Ich wurde zu Hause unterrichtet und war isoliert von anderen Kindern. Ich hatte keine Freunde, keine Haustiere und nahm an keinen Schulausflügen teil. Wenn ich auf den nahe gelegenen Wald blickte, sah ich Freiheit. Deshalb beschloss ich, als ich 19 wurde, dort hineinzugehen und für mich allein zu leben.
Die Widersprüchlichkeit meiner Eltern erdrückte mich: Jahrelang wurde mir beigebracht, die äußere Welt und ihre Einflüsse zu meiden. Doch auf einmal sollte ich einen Job finden und mich an diese Welt anpassen. Das war belastend. Der Wald schien mein Ausweg zu sein, um mich aus dem Griff meiner Familie zu befreien. Anders als meine Eltern war ich im tiefsten Inneren davon überzeugt, dass man da draußen im Einklang mit der Natur leben konnte.
Wie hast du dich auf das Leben in der Natur vorbereitet?
Gar nicht, jedenfalls nicht bewusst. Ich habe Bücher unter anderem von Nicolas Vanier und Jane Goodall gelesen. Dadurch wusste ich sehr viel darüber, was in der Natur möglich ist und was nicht. Obwohl sie nicht im Detail beschreiben, wie man in der Wildnis überlebt, waren sie eine sehr große Hilfe für mich.
Anfangs bin ich deshalb auch nur für kürzere Ausflüge in den Wald gegangen, lediglich für einige Tage, und dann wieder nach Hause gekommen. Dort habe ich meine Erfahrungen mit dem abgeglichen, was in den Büchern beschrieben wird. Dadurch habe ich immer mehr dazugelernt. Während meiner sieben Jahre im Wald gab es somit mal kürzere und dann wieder sehr lange Aufenthalte am Stück. Man kann nun mal nicht aus einer Laune heraus packen und gehen, das wäre Selbstmord.
Wie war es für dich, im Wald anzukommen?
Der erste Eindruck vom Leben in der Wildnis war ziemlich heftig. Ich musste lernen, dass es unmöglich ist, in der Nacht wie gewohnt acht bis zehn Stunden durchzuschlafen. Schon nach dreißig Minuten wird es kalt und unbequem. Manchmal kann es wochenlang regnen, und man wird einfach nicht mehr trocken.
Und als du einem Reh begegnet bist, hat sich alles verändert?
In der Tat. Zu Beginn hatte ich nur den Plan, fünfzehn Tage im Wald zu verbringen, um mich zu sammeln, Frieden zu finden und Energie zu tanken. Ich wollte einfach autonom sein. Ich hätte mir nie ausgemalt, mit wilden Tieren zu leben. Aber nach einer Weile kamen die Tiere von allein auf mich zu, weil sie wissen wollten, was ich dort zu suchen hatte. Und schließlich war es ein Reh, das mich zähmte, und nicht umgekehrt. Daguet brachte mir bei, mich an den Wald anzupassen, ihn zu verstehen. Er zeigte mir, in kleinen Dosen zu schlafen und zu essen und was überhaupt essbar ist. Jedes Reh lehrte mich etwas anderes.
Hast du dich auch physisch verändert?
Anders als beim körperlichen Training, wo man schneller Veränderungen spürt, ist das Anpassen der Sinne ein langwieriger Prozess. Fühlen beispielsweise: Ich habe viele Pflanzen mit Selbstverteidigungsmechanismen berührt, deshalb hatte ich mit Hautausschlägen zu kämpfen. Die Sehkraft wird beeinträchtigt, wenn man statt auf einen Horizont nur noch auf Bäume blickt. Relativ schnell verlor ich dadurch die Fähigkeit, in die Ferne zu sehen. Aber dafür habe ich andere Fertigkeiten dazugewonnen. Mein Geschmacks und Geruchssinn wurde besser, ebenso mein Tastsinn, da meine Haut sich anpasste. Am schwierigsten war es aber, Fettreserven anzulegen, um über den Winter zu kommen, da ich von Natur aus dünn bin. Manchmal wurde es schon gefährlich kalt für mich ...
Was war für dich die härteste Situation in der Wildnis?
Da gab es einige! Im Wald bist du immer hungrig, es ist immer kalt. Vor allem am Anfang, wenn du noch nicht weißt, wie du dich anpassen und überleben kannst. Schauen wir uns die Kleidung an: Ich war an Baumwoll-T-Shirts und Jeans gewöhnt, was nicht sehr praktisch für die Wildnis ist. Weil sie schneller trocknet, bin ich bald auf Kleidung aus Schafwolle und Leinen umgestiegen.
Manchmal muss man Essen bunkern, Haselnüsse zum Beispiel, in Bäumen, in denen es trocken bleibt. Nur um am nächsten Tag festzustellen, dass ein Eichhörnchen sich alles geholt hat. Man lernt, dass es nichts bringt, sich zu beschweren: Das cleverste Tier gewinnt nun mal. Vielmehr muss man aus seinen Fehlern lernen. Aber einige Fehler kosten eben mehr als andere.
Gab es auch gute Momente?
Es gab so viele, aber das Beste ist, wenn man sich zusammen mit einem Reh auf einer Lichtung ausruht. So eine Lichtung ist perfekt für diese Tiere. Sie befindet sich außerhalb des Waldes, aber man ist immer noch verborgen im hohen Gras. Wenn man dort sitzt, durchströmt einen das Gefühl von Frieden und tiefer Freude, egal, ob gerade die Sonne den Körper wärmt oder der Regen zu fallen beginnt und mit seinen harten Tönen diese wundervolle Melodie erzeugt.
Wie kommuniziert man mit einem Reh?
Am naheliegendsten ist es, das Tier zu rufen. Du kannst allerdings kein Reh rufen, das du nicht kennst, denn es ist nicht mit dem Klang deiner Stimme vertraut. Das wäre so, als würdest du auf der Straße „Robert, Robert, Robert!“ rufen, obwohl gar kein Robert in der Nähe ist, das bringt also nichts. Am besten kommuniziert man deshalb über den Geruch. Sind wir positiv eingestellt, verströmen wir einen süßlichen Geruch. Haben wir Angst, wird der Geruch beißend und säuerlich. Sind wir aggressiv, wird er bitter. Rehe reagieren sehr sensibel darauf. Außerdem kann man über Blicke und Verhalten mit ihnen kommunizieren.
Wird einem irgendwann langweilig im Wald?
Nein, man muss schließlich nicht nur nach Essen und einem Schlafplatz suchen, sondern auch ständig kleine Holzvorräte an trockenen Stellen anlegen, damit man sich ein Feuer zum Aufwärmen machen kann. Man muss Schnüre und Zweige finden, die Kleidung reparieren – es gibt immer etwas zu tun. Auch Meditation hilft. Dabei kann man sich auf den Moment fokussieren, ohne sich zu viele Fragen zu stellen. Mein Ziel war es, nicht mehr nachzudenken. Das scheint einfach zu sein im Wald, aber alles dort erinnert einen an die Welt da draußen: in der Ferne vorbeifahrende Krankenwagensirenen, das Glockenläuten der nahe gelegenen Kirche … Vor allem am Anfang versucht das Gewissen ständig, einen zum Aufgeben zu bewegen und zurück in das sichere Heim, zum Essen, an den Ofen zu drängen. Man muss sehr hart an sich arbeiten, um da standhaft zu bleiben.
Was hat dich nach sieben Jahren dazu veranlasst, den Wald zu verlassen?
Der Hauptgrund ist die intensivierte Forstwirtschaft. Sie zerstörte maßgeblich die Nahrungsvielfalt, die ich zum Überleben im Wald brauchte. Plötzlich musste ich viele Kilometer weiter laufen, um etwas zu Essen zu finden. Ich war erschöpft, mein ganzes System war gefährdet. Der zweite Grund waren die Rehe selbst. Mittlerweile erwachsen und gereift, haben sie mich immer öfter an die Wege der Menschen, an den Waldrand geführt, als ob sie mir sagen wollten: „Dein Platz ist nicht hier, das ist nicht deine Welt.“ Und zu guter Letzt traf ich bei einem Spaziergang auf meine spätere Freundin. Alles deutete also darauf hin, dass es an der Zeit für mich war, nach Hause zu gehen.
„Es mag schon viele Bücher über den Wald und seine Bewohner gegeben haben, ein solches - zugleich lehrreich und amüsant, spannend und berührend - dürften Sie indes noch nicht gelesen haben.“
„Ein berührender und außergewöhnlicher Einblick in die Welt der Rehe.“
„Der Autor versteht sich auf die Poesie des Einfachen. Geoffrey Delorme kann also anrühren, ohne es spürbar darauf anzulegen, und sachkundig erklären, während er nur leichthin seine Geschichten erzählt.“
„Geoffrey Delorme kann anrühren, ohne es spürbar darauf anzulegen, und einprägsam und sachkundig erklären, während er nur leichthin seine Geschichte erzählt.“
„Ein spannender, interessanter, lehrreicher und amüsanter Einblick in den Wald, den uns Delorme mit seinem Buch liefert.“
„Mit seinem Buch wirbt er auf eine überzeugende, sanfte Weise für den Erhalt artenreicher Wälder.“
„Ein einzigartiger Einblick, der uns bewusst macht, wie verletzlich und schützenswert der Wald und all seine Bewohner sind.“




















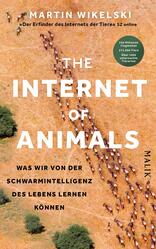




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.