
Herrgottswinkel
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Die bewegte Geschichte einer Bauernfamilie aus dem Allgäu
Tiefe Konflikte mit dem Bruder ihres Mannes und dessen Frau drohen Julias Familie zu entzweien. In ihrer Not besinnt sie sich auf die Geschichte ihrer weiblichen Vorfahren: drei Generationen von starken Frauen, die frei über ihr Leben bestimmen wollten. Die zwischen harter bäuerlicher Arbeit und den Konventionen ihrer Zeit gefangen waren – und sich doch ihre innere Stärke bewahrten.
Drei Generationen von starken Frauen
Die Berganna, deren Liebe zum Wilderer Daniel ein jähes Ende fand. Johanna, die mit dem Patriarchen des Orts 13 Kinder…
Die bewegte Geschichte einer Bauernfamilie aus dem Allgäu
Tiefe Konflikte mit dem Bruder ihres Mannes und dessen Frau drohen Julias Familie zu entzweien. In ihrer Not besinnt sie sich auf die Geschichte ihrer weiblichen Vorfahren: drei Generationen von starken Frauen, die frei über ihr Leben bestimmen wollten. Die zwischen harter bäuerlicher Arbeit und den Konventionen ihrer Zeit gefangen waren – und sich doch ihre innere Stärke bewahrten.
Drei Generationen von starken Frauen
Die Berganna, deren Liebe zum Wilderer Daniel ein jähes Ende fand. Johanna, die mit dem Patriarchen des Orts 13 Kinder zeugte. Und Julias Großmutter Anna, der man nach der Geburt den unehelichen Sohn wegnahm.
Sie alle hatten in ihrem Leben harte Kämpfe auszustehen – und bewahrten sich doch ihre innere Stärke. Eine Stärke, die auch Julia dringend braucht, als die Dinge sich zuspitzen …
Über Ramona Ziegler
Aus „Herrgottswinkel“
Gewidmet der guten Fee in meinem Leben,
Rosel, die an Lichtmess 2009
95 Jahre alt wurde.
Ohne sie hätte ich dieses Buch nicht schreiben können.
Für Lina,
die in meinem Herzen meine Oma war.
Und für Hans,
dem ich so viel verdanke.
JULIA
DASS ES EINMAL SO WEIT KOMMEN WÜRDE, HÄTTE ICH mir selbst in meinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen können. Mir war in meinem Leben nie etwas geschenkt worden, geschweige denn in den Schoß gefallen, aber die letzten vierundzwanzig Stunden stellten alles in den Schatten, was mir in meinem bisherigen Leben zugestoßen war. Es war stets [...]




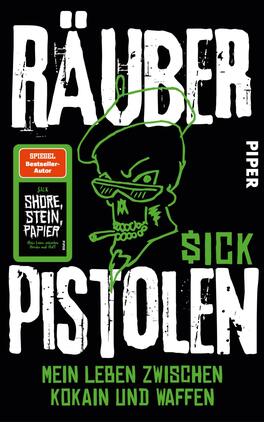
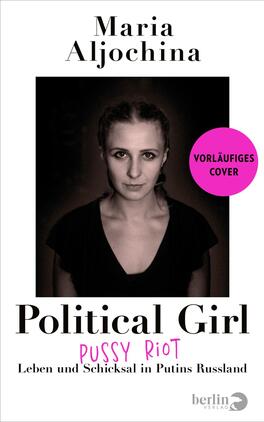
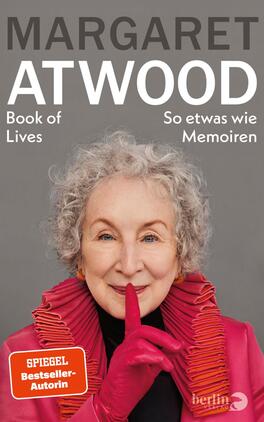

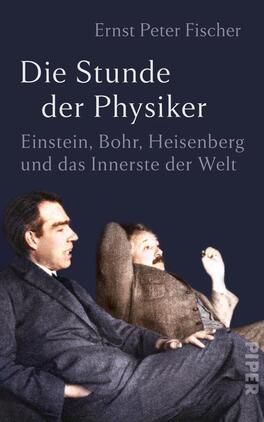





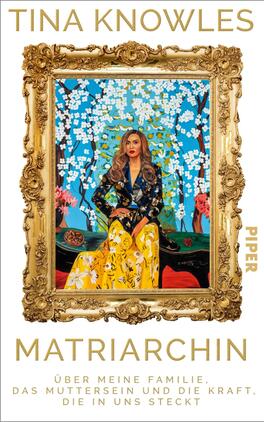

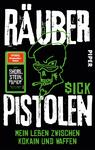


Die erste Bewertung schreiben