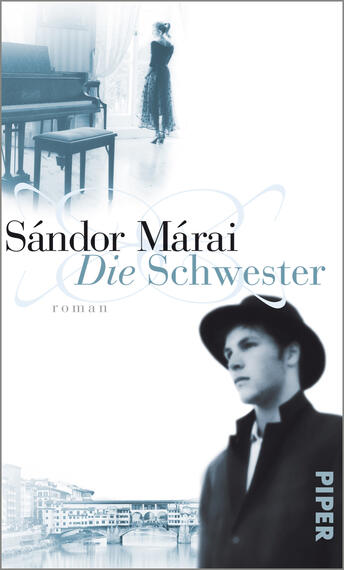
Die Schwester - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„…wie alle Bücher des großartigen Erzählers und literarischen Psychologen ist auch dieser Roman von Sándor Márai selbstverständlich ein Reisebuch, nämlich eines in die Seele des Menschen. Ein grandioses noch dazu.“
TagesspiegelBeschreibung
Der Zufall führt die beiden zusammen: den Erzähler und den berühmten Pianisten Z.In einem Kurort in den transsilvanischen Bergen begegnen sie sich. Es ist Weihnachten, und eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft verbringt die Feiertage in einem kleinen Gasthof. Schockiert müssen die Anwesenden zur Kenntnis nehmen, dass sich ein elegantes Liebespaar gemeinsam das Leben genommen hat. Tief betroffen vertraut der Pianist dem Erzähler ein Manuskript an, aus dem wir von seiner eigenen großen Liebe erfahren – einer Liebe, die ihn seine Bestimmung finden ließ, für die er aber einen hohen Preis…
Der Zufall führt die beiden zusammen: den Erzähler und den berühmten Pianisten Z.In einem Kurort in den transsilvanischen Bergen begegnen sie sich. Es ist Weihnachten, und eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft verbringt die Feiertage in einem kleinen Gasthof. Schockiert müssen die Anwesenden zur Kenntnis nehmen, dass sich ein elegantes Liebespaar gemeinsam das Leben genommen hat. Tief betroffen vertraut der Pianist dem Erzähler ein Manuskript an, aus dem wir von seiner eigenen großen Liebe erfahren – einer Liebe, die ihn seine Bestimmung finden ließ, für die er aber einen hohen Preis bezahlen musste. Vor dem Hintergrund eines fernen Krieges erzählt Sándor Márais dunkel funkelnder Roman von einer unerfüllten Liebe, deren Schmerz unerhörte Folgen hat.
Über Sándor Márai
Aus „Die Schwester“
1.
Dies ist mein Versuch aufzuzeichnen, was ich in jener eigenartigen Weihnachtsnacht erlebt habe. Wir schrieben damals das dritte Weihnachten im Zweiten Weltkrieg.* Die Zeit vergeht, und die Tage und Nächte, die auf diesen Weihnachtsabend folgten, brachten noch viel Leid und Elend über uns. Dennoch blieb mir die Erinnerung an diese Begegnung im Herzen und im Bewusstsein lebendig. Die Nachrichten, die von der Zerstörung ganzer Städte kündeten, der Zweifel und die Beklemmung, die zu dieser Zeit vielen Menschen das Herz mit Sorge um die Zukunft füllten, all das viele [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Der Roman ›Die Schwester‹ aus dem Jahr 1946 gehört gewiss nicht zu den Büchern, die man schnell vergisst. “
Augsburger Allgemeine„…wie alle Bücher des großartigen Erzählers und literarischen Psychologen ist auch dieser Roman von Sándor Márai selbstverständlich ein Reisebuch, nämlich eines in die Seele des Menschen. Ein grandioses noch dazu.“
Tagesspiegel



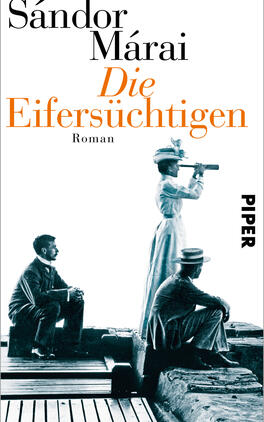




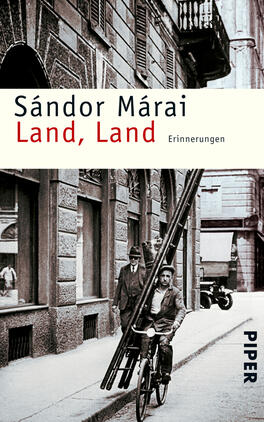

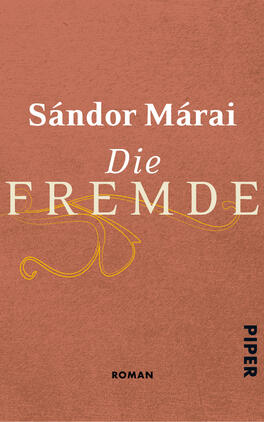
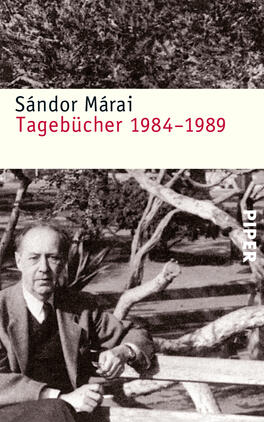
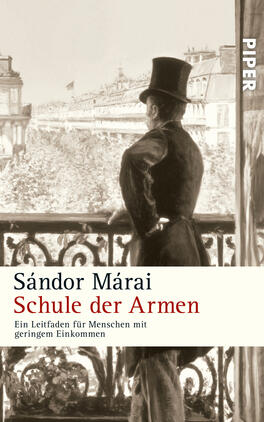

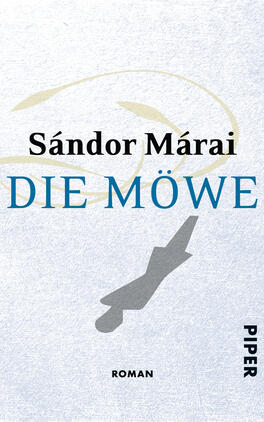



Die erste Bewertung schreiben