
Die Chefin - eBook-Ausgabe
Roman
„lustig-spannender Garn“ - Hamburger Morgenpost
Die Chefin — Inhalt
Marie Sanders Leben ist in Schieflage geraten. Bei der erfolgreichen Rocksängerin, von allen nur „Die Chefin“ genannt, läuft's nicht mehr. Es sitzt sich nur noch. Und zwar im Rollstuhl. Schlaganfall, zwei Tage nach ihrem vierzigsten Geburtstag. Also ideale Voraussetzungen, um die Verfolgung einer verbrecherischen Bande aufzunehmen. Um sich auf eine Odyssee durch halb Europa zu begeben. Um sich in einen selbstverliebten Bodybuilder zu verlieben. Um zwei Kindern ihre Eltern wieder zu geben. Um das Leben neu zu atmen.
Leseprobe zu „Die Chefin“
[1] Das Glück ist ein lausiger Gastgeber. Es lädt dich zu sich nach Hause ein, spendiert dir großzügig einen Schampus, eventuell auch ein paar Lachshäppchen, etwas Fingerfood und lässt dich gönnerhaft Austern schlürfen. Und genau in dem Moment, wo du dich gerade an die gute Kost gewöhnst, räumt das Glück den Tisch ab, schmeißt dich wieder raus und sagt: Die Party ist zu Ende!
Das nennt man Schicksal und man macht dafür gerne die Vorsehung, schlechtes Karma oder irgendwelche höheren Mächte verantwortlich. Aber in der Regel sind die Gründe nicht im [...]
[1] Das Glück ist ein lausiger Gastgeber. Es lädt dich zu sich nach Hause ein, spendiert dir großzügig einen Schampus, eventuell auch ein paar Lachshäppchen, etwas Fingerfood und lässt dich gönnerhaft Austern schlürfen. Und genau in dem Moment, wo du dich gerade an die gute Kost gewöhnst, räumt das Glück den Tisch ab, schmeißt dich wieder raus und sagt: Die Party ist zu Ende!
Das nennt man Schicksal und man macht dafür gerne die Vorsehung, schlechtes Karma oder irgendwelche höheren Mächte verantwortlich. Aber in der Regel sind die Gründe nicht im Übernatürlichen zu suchen. Manchmal hat das Schicksal auch einfach nur zu große Schuhe.
Til haben solche sogar das Leben gekostet. Dabei stand ihm eine außerordentliche Karriere im Showbusiness bevor. Alle waren sich einig, dass er das Zeug zu einem absoluten Star hatte. Weltweit hätten sich Kamerateams darum gerissen, über ihn berichten zu dürfen, seine Facebookseite hätte Hunderttausende von Freunden gehabt.
Til war ein Keinohrhase. Und zwar ein echter! Benannt nach Til Schweiger, dem Hauptdarsteller und Produzenten der Komödie „Keinohrhasen“. Er war ein total süßes, braun-weißes Kaninchen mit großen, dunklen Knopfaugen, das durch einen genetischen Defekt ohne Ohren zur Welt gekommen war. Anfang 2012 in einem Zoo in der Nähe von Chemnitz. Der kleine ohrlose Til war so goldig und putzig, dass sofort klar war, dass er die Attraktion des Tierparks werden würde und selbst Berühmtheiten wie Eisbär Knut, Krake Paul oder das schielende Opossum Heidi noch weit in den Schatten gestellt hätte. Doch kurz nach seiner Geburt geschah bei Filmarbeiten über ihn das fürchterliche Unglück. Es war die allerletzte Einstellung des TV-Drehs in Tils Stall. Der Kameramann ging in die Hocke, dann erhob er sich, trat einen Schritt zurück und merkte plötzlich, dass er auf etwas stand. Etwas sehr Weichem. Er drehte sich um, hob seinen Fuß und sah, dass das Weiche der löffellose Hauptdarsteller war, der sich im Stroh versteckt hatte. Und den er nun unter seinen zu großen Schuhen zerquetscht hatte.
Til wurde nur gut zwei Wochen alt und wird als der James Dean der Tierwelt in die Filmgeschichte eingehen. Zu früh gestorben, für immer eine Legende. Aber so ist das im Leben. Til hatte das Schicksal einfach nicht kommen hören. Wie auch, ohne Ohren?
Aber uns allen geht es nicht anders als Til, wir haben keine Ohren für solche Sachen. Wenn das Schicksal zu einem seiner berüchtigten Schläge ausholt, stehen wir ohne Deckung da und lassen uns von dem Miststück ausknocken.
So war es auch bei Marie Sander gewesen, sie hatte ihr Schicksal weder vorher gehört noch gesehen noch geahnt noch gespürt. Schließlich war sie keine Maus, die schon Tage vor einem schweren Erdbeben aus ihrem Loch flüchtet, kein Hund, der vor einem drohenden Vulkanausbruch zu jaulen anfängt, und auch kein Vogel, der mit solch feinen Sinnesorganen ausgestattet ist, dass er einen Tsunami kommen spürt.
Und deshalb lag Marie Sander jetzt zu Hause in ihrem Bett und schaute fern. Seit Tagen, seit Wochen oder genauer gesagt seit vier Monaten, elf Tagen und zwölf Stunden. So lange war es her, dass sie aus dem Krankenhaus und der Reha wieder nach Hause zurückgekehrt war. Insgesamt elf Monate nachdem ihr Leben ins Rollen gekommen war. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn Marie Sander saß im Rollstuhl. Seit dem Tag, an dem das Schicksal ihr einen Schlag versetzt hatte. Unvermittelt, hinterhältig, anfallartig. Deshalb heißt es ja auch Schlaganfall.
Früher bestand ihr Leben aus Rock’n’Roll, heute kaum noch aus Rock, dafür umso mehr aus Rollen. Früher war sie Sängerin und Bassistin, doch seit ihr linker Arm seinen Dienst verweigerte, war ans Bassspielen nicht mehr zu denken. Dabei war Marie Sander mal richtig gut im Geschäft gewesen. Sie hatte drei Nummer-1-Hits geschrieben, zwei goldene Schallplatten und einen Echo verliehen bekommen. Sie hatte schon ihr ganzes Leben lang Musik gemacht, doch eines Tages, vor ungefähr zehn Jahren, war der Erfolg plötzlich über sie hereingebrochen. Das Glück hatte sie zu sich nach Hause eingeladen und sie reich bewirtet. Hatte sie mit Lachsschnittchen nur so überschüttet. Sie hatte dankend angenommen und sich nie etwas drauf eingebildet, denn sie sagte sich immer: Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der erforderliche Hohlraum vorhanden ist. Sie hatte auch nie versucht, sich ihren Erfolg zu erklären. Sie sagte sich: Ich bin wahrscheinlich so ähnlich wie Heidi, das schielende Opossum. Das hatte sich auch nie gefragt, warum es so berühmt geworden war, und obwohl es nichts konnte, außer dumm herumsitzen und schielen, hatte es genau so viel Facebookanhänger wie Angela Merkel. Gut, manche sagen: Kein Wunder, denn dumm herumsitzen und blöd gucken, mehr macht Angela Merkel ja auch nicht.
Bei Marie Sander kam der Erfolg vielleicht daher, dass sie es nie auf den Erfolg angelegt hatte. Sie hatte ihn einfach mitgenommen und sich gesagt: Erfolg, das ist wie eine Wagneroper in Bayreuth. Man versteht es nicht, man weiß nur: So lange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende.
Aber jetzt sang Marie Sander nicht mehr, sie stand nicht mehr auf der Bühne, die Oper war zu Ende.
Der Fernseher lief und tauchte ihr Wohnzimmer in ein Licht, als wenn eine Hundertschaft der Polizei nachts zum Großeinsatz mit Blaulicht durch ein Aquarium fährt. Marie schaute auf das gegenüberliegende Gebäude. Sie fragte sich, welche Opern dort hinter den Fenstern der ehemaligen Nähmaschinenfabrik, in der sich heute hippe Lofts befanden, jetzt gerade aufgeführt wurden. Waren es komische Opern? Waren es dramatische Opern, in denen am Ende immer einer stirbt? Vielleicht passierte genau in diesem Moment hinter einem der Fenster gerade etwas ganz Furchtbares. Raubmord, Totschlag oder noch schlimmer: eine nächtliche Wiederholung von „Wetten, dass …?“ mit Markus Lanz als Moderator.
Marie Sander musste kurz auflachen. Bei all den Dramen, die sich eventuell in diesem Moment in dem Gebäude gegenüber abspielten, war da ihr eigenes Drama wirklich das schlimmste von allen? Dieser Gedanke half ihr oft, wenn sie mit ihrem Schicksal haderte. Dann dachte sie: Egal, wie scheiße dein Leben auch sein mag, es gibt immer irgendwo auf der Welt ein dickes Kind, dem gerade ein Eis runterfällt, bevor es dran lecken kann.
Marie selbst war alles andere als ein dickes Kind. Bei einer Größe von eins vierundsiebzig wog sie fünfzig Kilo, sie konnte essen wie ein Schaufelradbagger im Braunkohleabbau und nahm einfach nicht zu. Selbst jetzt mit zweiundvierzig im Rollstuhl sitzend nicht. Auch sonst hatte sie der Schlaganfall optisch nicht sehr verändert. Sie hatte leicht hagere, aber feine Gesichtszüge und Augen, auf die jeder sibirische Tiger neidisch gewesen wäre. Ihre Haare waren rot wie glühende Stahlschlacke, die frisch aus dem Hochofen fließt. Wenn sie nicht gerade mal wieder weißblond waren. Trotz wechselnder Farben waren sie aber immer zügellos in alle vier Himmelsrichtungen aufgetürmt und hochtoupiert. Sorgsam über Jahre mit so viel Haarspray, Gel und Chemie behandelt, dass jede Sondermülldeponie dagegen der reinste Kurpark war. Ihr Geschmack ließ sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: Je wilder, umso besser! Das hatte durchaus Nachteile, denn ihre Haare führten ein Eigenleben und in ihnen verschwanden von Zeit zu Zeit Dinge wie in einem Bermudadreieck. Mit dem ihr eigenen Hang zu Übertreibungen beteuerte sie, nach dem Waschen darin schon Kämme, Schokoriegel, Kaffeetassen und einmal sogar den Wellensittich gefunden zu haben, der ihrer Nachbarin Frau Schmitz entflogen war.
[2] Marie schaltete den Fernseher aus. Dunkelheit legte sich wie schwarze Rinde über den ganzen Raum. Sie stemmte sich in ihren Rollstuhl, rollte ans Fenster und zündete sich eine Zigarette an. All ihre Ärzte hatten ihr nach dem Schlaganfall dringend dazu geraten, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber für sie war das – so unvernünftig es auch sein mochte – ein letztes Stück Selbstbestimmung, das sie sich nicht nehmen lassen wollte. Sie sagte sich: Na, und? Rauchen ist vielleicht krebserregend, aber mir ist doch egal, was Krebse lüstern macht!
Sie nahm einen tiefen Zug und sah hinüber zur Wohnung des avantgardistischen Malers Carsten Rottmann, die in das bleigraue Licht eines in die Wand eingelassenen Koibeckens getaucht war. Drei ausgewachsene Zierkarpfen mussten sich dort ihre Unterkunft mit einem Dutzend aufgeschlitzter Barbiepuppen teilen. Warum? Weil Rottmann dies offenbar für Kunst hielt.
Marie ließ ihren Blick weiter durch den Raum schweifen und plötzlich fuhr ihr blankes Entsetzen in die Glieder. Eine Leiche hing an einem Galgen mitten in Rottmanns Loft! Das Blut tropfte aus den Mundwinkeln des leblosen Körpers, formte auf dem weiß getünchten Boden eine tiefrote Lache, während ein Vogel Fleischstücke aus dem baumelnden Kadaver herauspickte. Marie drehte sich der Magen um. Sie griff zum Telefon, um die Polizei zu rufen, schaute dann aber noch einmal hin und musste grinsen. Das war kein menschlicher Leichnam, der da am Strick hing, sondern eine Vogelscheuche in einem apricotfarbenen Businesskostüm und mit einem schwarzen Raben auf der Schulter. Die zur Raute geformten Hände der abstrusen Kunstinstallation sollten wohl an Angela Merkel erinnern und wahrscheinlich ein Fanal gegen deren Politik darstellen. Nach Maries Auffassung zeichneten sich Rottmanns Werke nicht durch Talent, sondern durch Geschmacklosigkeit aus. Er hatte am Hauptbahnhof vor den Toiletten dreihundertfünfundsechzig Plastikgartenstühle mit der Aufschrift „Harter Stuhl“ aufgestellt und einen lebenden Hamster vierundzwanzig Stunden auf einen rotierenden Ventilator gebunden. Marie begriff einfach nicht, wie man mit so einem pubertären Unsinn Geld verdienen konnte. Und dass Rottmann damit offensichtlich viel Geld verdiente, war nicht zu übersehen. Seine Wohnung war zwar spärlich, aber sehr hochpreisig eingerichtet. Klare Linien, kein Schnickschnack, kahle mintgrüne Wände, eine davon mit alten Fix-und-Foxi-Heften tapeziert, vor der ein goldenes Regal stand. Dazu ein LC3-Sofa von Le Corbusier, eine Palisanderliege von Mies van der Rohe, ein Kirschholztisch von Frank Lloyd Wright, ein glänzender Chromsekretär und ein ungefähr drei Quadratmeter großer, pinkfarbener Bang&Olufsen-Fernseher. In diesem inhaltsleeren Ambiente bewegte sich Rottmann wie eine lebende Karikatur des modernen Kunstbetriebs. Nur heute nicht, heute war seine Wohnung leer bis auf die Koikarpfen im Aquarium, die arrogant-gelangweilt auf die Barbiepuppen starrten.
Eine Etage höher im Penthouse auf dem Dach der ehemaligen Fabrik ging das Licht an. Wie jeden Abend um diese Uhrzeit. Ein athletischer, kraftstrotzender Mittvierziger betrat nur in Jogginghose und Turnschuhen gekleidet sein Wohnzimmer, das allerdings eher einem Fitnessstudio glich. Bis auf ein altes Ikeasofa war es vollgestopft mit Hantelbänken, Rudermaschinen, Beinpressen, Bi-, Tri- und Quadrizepscurlern. Besäße der Mensch auch einen Octozeps und einen Monozeps, der Mann hätte sich bestimmt sofort die entsprechenden Foltergeräte angeschafft. Sein äußeres Erscheinungsbild ließ sich mit drei Wörtern zusammenfassen: „Muskelschmalz“ und „unbewegte Miene“. Sein Vorname war Tarkan. Sein Nachname lautete Batman. Als Marie dies vor einigen Tagen durch einen neugierigen Blick auf sein Klingelschild herausbekommen hatte, dachte sie: Wow! Batman ist also im bürgerlichen Leben ein Bodybuilder aus Köln und muss allabendlich seine Muskeln stählen, um nachts Gotham City von allen Verbrechern zu befreien!
Sein Name rührte allerdings nicht von dem amerikanischen Comichelden, sondern von der gleichnamigen Stadt im Südosten der Türkei.
Der osmanische Batman von gegenüber stemmte gerade eine Hundertdreißig-Kilo-Langhantel in die Höhe, der Schweiß lief ihm dabei in Strömen über den nackten Oberkörper. Wie jeden Abend schaute Marie dem Spektakel gebannt zu. So gebannt, dass sie automatisch zu dem Fotoapparat griff, der neben ihr auf dem Tisch lag. Sie zoomte sich ihr Gegenüber näher heran, um es genauer betrachten zu können. Ihr gefielen die leicht asiatischen Gesichtszüge des Bodybuilders und seine großen, rußfarbenen Augen. Ihr Blick heftete sich an seinen Oberkörper. Jeder einzelne Muskel war definiert, und zwar eindeutig definiert als Quell des Entzückens. Ihr Blick folgte einem einzelnen Schweißtropfen auf seiner Reise durch die hügelige Dünenlandschaft seines kaum bewaldeten Sixpacks bis in tiefere Regionen, deren Fauna sie sich nicht vorzustellen wagte. Was waren das für seltsame Phantasien, die dieser aufgepumpte Adonis in ihr auslöste? Wahrscheinlich litt sie unter Entzug, vor allem nachdem sie ihrem Freund vor drei Monaten den Laufpass gegeben hatte. Einen Tag vor ihrem zweiundvierzigsten Geburtstag. Denn Manni-Hasi hatte sich zwar immer sehr gerne in ihrem Erfolg gesonnt und es geliebt, sie auf irgendwelche Preisverleihungen zu begleiten. Mit ihrer Krankheit konnte er allerdings wenig anfangen. Die würde ihn irgendwie überfordern und außerdem habe er irgendwie keine Schmetterlinge mehr im Bauch.
„Weißt du was, Sportsfreund?“, hatte sie erwidert. „Wenn du Schmetterlinge im Bauch willst, dann steck dir Raupen in den Arsch!“
Er hatte ihr dann noch vorgeschlagen, dass sie ja Freunde bleiben könnten, doch Marie hatte nur gedacht: „›Wir können ja Freunde bleiben‹ ist das Gleiche wie ›Dein Hund ist tot, aber du darfst ihn behalten.‹“
Und dann hatte sie ihn mit einem „Leck mich doch, du Sack!“ achtkantig vor die Tür gesetzt. Ihren zweiundvierzigsten Geburtstag hatte sie danach in ganz kleinem Rahmen gefeiert, nur mit ihren Freunden Jonny Walker, Mai Tai und Veuve Cliquot. Noch vor Mitternacht war sie dann ins Bett gegangen, nicht ohne vorne noch lattenstramm eine Runde mit dem Porzellanbus gefahren zu sein.
Marie rollte in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Sie war gerade an ihren Fensterplatz zurückgekehrt und hatte sich ihren Fotoapparat geschnappt, da bemerkte sie, dass auch Tarkan den Raum verlassen hatte. Eine Minute später kam er mit einem Schild in der Hand aus dem Nebenraum zurück, ging ans Fenster und hielt den Karton dagegen. Darauf stand mit einem dicken Edding in großen Buchstaben geschrieben: „Bekomme ich einen Abzug?“
„Verdammter Bullshit!“, erschrak Marie. „Er hat bemerkt, dass ich ihn beobachte, weil ich Idiot das Licht in der Küche angelassen hab!“
Vor lauter Scham fing ihr Kopf an, hochrot zu leuchten, denn nun stand sie vor ihm da wie ein notgeiler Voyeur oder Spanner. Tarkan hingegen nahm den Pappkarton vom Fenster, beschriftete dessen Rückseite, um diese dann an die Scheibe zu drücken: „Wie heißt du?“
Marie überlegte lange. Dann rollte sie zu ihrem Schreibtisch, schrieb ihren Namen auf einen DIN-A3-Umschlag und zeigte diesen ihrem Nachbarn: „M A R I E“. Kurze Zeit später erhielt sie eine erneute Botschaft von gegenüber: „Freitag Frühstück?“
Sie nickte, winkte kurz, dann rollte sie in ihr Schlafzimmer, nicht ohne vorher das Licht in der Küche gelöscht zu haben.
[3] Marie wusste nicht, warum, aber sie fühlte sich am nächsten Morgen so leicht wie schon lange nicht mehr. Eine Stimmung, die so ganz anders war als die der vergangenen Monate, in denen sie auch noch die letzten Reste ihres verbliebenen Lebensglücks mit dem lähmenden Gips ihrer dunklen Gedanken verspachtelt hatte. Ihre Freunde machten ihr permanent Vorhaltungen, dass sie mehr und härter an sich arbeiten müsse, dass sie ihre therapeutischen Übungen ernster nehmen solle und dass sie nicht genug für die Wiederherstellung ihres lädierten Körpers tue.
Sie sagte dann immer: „Klar, mache ich, für den nächsten Marathon habe ich mich schon angemeldet!“
Aber sie war nun mal kein Leistungssportler, der es gewohnt ist, mit eiserner Disziplin zu kämpfen und zu trainieren. Wie kann man das von einem Menschen, der nie extrem viel Sport getrieben hat, plötzlich erwarten? Sie war doch nicht faul, sie war nur physisch etwas konservativ.
Amtsärzte dagegen versuchten permanent, den Grad ihrer Behinderung kleinzureden. Neulich fragte sie eine neurologische Ärztin allen Ernstes, ob sie denn ihren Haushalt alleine erledigen würde. „Ja, wie denn? Mit einem Arm? Und meine Füße haben diesbezüglich noch kein Talent! Aber wenn Sie meinen, dann geh ich demnächst morgens nach dem Aufstehen erst mal in die Küche, guck mir das schmutzige Geschirr vom Vortag an und schwinge dann munter meine Spülaxt. Alles, was dabei kaputtgeht, ist dann praktisch sauber, weil nicht mehr existent! Und was heil bleibt, hat eben Pech, muss puppenlustig so lange vor sich hin schimmeln, bis der linke Arm wieder funktioniert. Oder warten, bis es von der Spülaxt bei der nächsten Runde getroffen wird!“
Es war nicht so, dass sie gänzlich in Depressionen versunken war, sie war es einfach nur satt, auch gedanklich dauernd zu kämpfen und dauernd positiv denken zu müssen.
Unzählige Psychoratgeber, Glücksexperten und Gute-Laune-Propheten wollen den Leuten heutzutage weismachen, man müsse nur richtig denken und schon gebe es keine Probleme mehr auf der Welt. So ein Quatsch! Genauso wie: „Lächle und die Welt lächelt zurück!“ Marie wollte aber nicht immer lächeln. Man lächelt doch nur, wenn es einen Grund dafür gibt. Sollte sie eines Tages zum Beispiel Wladimir Putin über den Weg laufen, dann würde sie ihn nicht anlächeln wollen, sondern ihm lieber eins in die Fresse hauen.
„Mein Gott!“, sagte sie sich. „Ich bin ein Homo sapiens und keine Grinsekatze!“
Als Marie hatte feststellen müssen, dass ihr Kopf es müde war, immer nur positiv zu denken, musste sie auch feststellen, dass stattdessen ein Unwetter in Form dunkler Gedankenwolken und bedrohlicher Geistesblitze in ihm aufgezogen war. Sie hatte eindeutig ein böses Tief erwischt. Der Zug ihrer Gedanken war entgleist und es sah so aus, als hätte es keine Überlebenden gegeben.
Doch dieser Zustand war seit heute Morgen plötzlich wie weggeblasen. Sie schaute zur Küche hinüber und fragte sich, ob das wohl mit ihrem Besuch zusammenhing. Es konnte eigentlich nicht sein, denn der Kerl, der dort lautstark seine Anwesenheit kundtat, war doch eigentlich gar nicht ihr Typ.
„Und? Hast du den Zucker gefunden?“, rief sie quer durch ihre Wohnung und erhielt als Antwort nur lärmende Geräusche von klirrendem Geschirr und polternden Töpfen.
„Nicht, dass du das irgendwie falsch verstanden hast. Du solltest uns nur einen Kaffee kochen und nicht gleich die ganze Küche abreißen. Verstehst du?“
Immer noch keine Antwort aus dem Raum am anderen Ende ihres Wohnzimmers.
»Ich weiß auch nicht, wie ihr Männer es immer schafft, euch ein einziges Spiegelei zu braten und dabei gleichzeitig die komplette Küche zu verwüsten. Der Mann meiner Freundin Suse hat neulich selbstständig Wasser gekocht. Hinterher musste Tine Wittler mit einem dreißigköpfigen Handwerkerteam zur Grundsanierung anrücken. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass die Welt nicht durch einen spontanen, nicht erklärbaren Urknall entstanden ist. Ich bin mir sicher, das Universum war ursprünglich ein frisch geputztes Badezimmer, das im Chaos endete, weil Gott versucht hat, sich zu rasieren!«
Endlich hörten die Geräusche von nebenan auf und stolz wie Johann Lafer nach der Zubereitung eines Siebzehn-Gänge-Menüs stand der Meisterkoch mit zwei Tassen Kaffee im Türrahmen.
„Hast du mir überhaupt zugehört, Tarzan?“, griente Marie ihn an.
„Ich heiße nicht Tarzan, ich heiße Tarkan! Das weißt du genau!“, kam es missmutig zurück.
„Ja! Du siehst aber eher nach Tarzan aus! Ich mein, mit deinen ganzen Karnevalsmuskeln, die du dir mühsam antrainiert hast. Ich muss das ja jeden Abend mit ansehen, wie du drüben in deiner Fitnesshölle Eisen pumpst.“
Tarkan reagierte nicht, all ihre um Lockerheit bemühten Sprüche schienen an ihm abzuprallen. Er machte weder den Eindruck, dass er sich von ihnen provoziert fühlte, noch dass er sie in irgendeiner Art lustig fand. Er schaute ihr beim Reichen der Tasse nur eindringlich in die Augen, verharrte so einen Moment und sagte dann beiläufig: „Ich weiß, dass du darauf stehst.“
Sie verschluckte sich fast am Kaffee. Was erzählte er da? Das war völliger Unsinn! „Nee! Also, wenn du meine ehrliche Meinung hören willst: Du siehst aus wie ’n frisch rasiertes Mammut, und dein Oberkörper erinnert mich an ein mit Walnüssen vollgestopftes Kondom!“
„Und warum schaust du mir dann jeden Abend beim Training zu?“
»Das sind Naturstudien. Für mich ist das wie eine Tierreportage auf Discovery Channel: Neueste Berichte aus dem Leben der Primaten und Alphatierchen.«
„Du interessierst dich für Menschenaffen?“
„Klar, würde ich sonst mit dir reden?“
Ein ganz leichtes Lächeln zuckte in seinen Mundwinkeln, doch er schluckte es wie einen hängen gebliebenen Brotkrümel augenblicklich wieder herunter.
„Und du hältst mich also für ein Alphamännchen! Danke für das Kompliment!“
„Du musst ein Alphamännchen sein. Wie sonst kann man seinen Arsch nur so selbstsicher durch die Welt tragen? Das ist das typische Imponiergehabe von Primaten!“
„Na und? Was ist daran so schlimm, wir stammen doch alle vom Affen ab.“
Mittlerweile fing sie an, Spaß daran zu finden, sich mit ihm zu streiten: »Dass wir alle vom Affen abstammen, ist doch gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie viele Generationen dazwischenliegen. Wenn du in den Zoo gehst, musst du dich garantiert am Ausgang immer ausweisen, damit sie dich wieder rauslassen, oder?«
Er nahm einen Schluck Kaffee, ließ diesen gurgelnd die Kehle hinunterlaufen und zeigte keinerlei Reaktion. Marie gelang es einfach nicht, ihn aus der Reserve zu locken. „Wahrscheinlich erzählst du mir gleich, dass du als Alphamännchen auch diesen enormen Drang besitzt, möglichst viele Weibchen zu begatten. Aber nicht aus Eigennutz, sondern zum Wohle der Menschheit – weil du weißt, dass deine Gene echte Qualitätsgene sind und weitergegeben werden sollten.“
„Qualitätsgene! Danke! Schon wieder ein Kompliment.“
„Ganz und gar nicht! Denn Alphamännchen sind in Wahrheit echte Luftkoteletts. Wusstest du zum Beispiel, dass im Tierreich die Schimpansen-Rudelführer den Rekord für die schnellsten Quickies halten? Drei Sekunden! Da wird Cheetah nicht oft auf ihre Kosten kommen.“
Er leerte seine Tasse, stellte sie auf den Tisch und ging einen halben Schritt auf sie zu.
„Weißt du was? Ich glaube, wenn du damals bei King Kong die weiße Frau gewesen wärst – der Affe hätte dich nach zehn Minuten wieder an den Marterpfahl zurückgehängt!“
Jetzt war sie es, bei der ein leichtes Lächeln auf den Mundwinkeln zuckte.
„Dabei träumst du doch insgeheim auch von King Kong. Würdest du mich sonst so oft beobachten?“
„Du meinst, ich träume von der archaischen Wildheit und dem Animalischen, das in euch Männern nun mal drinsteckt, weil es eure Natur ist? Du hast sie ja nicht mehr alle, Tarzan!“
„Ich heiße Tarkan!“, knurrte er zurück. „Ich bin auch nicht der König des Dschungels. Höchstens der König der Dummköpfe“, fügte Tarkan leise hinzu.
Auf Maries fragenden Blick fuhr er fort: „Früher war ich mal Polizist, hab aber wegen illegalem Handel mit anabolen Steroiden meinen Job verloren und schlage mich heute als Türsteher durch.“
Er schaute sie herausfordernd an und setzte sich lässig auf die Kante des giftgrünen Tisches. Ein Bein blieb auf dem Boden, das andere stellte er auf die Lehne ihres Rollstuhls. Marie hatte sofort den Impuls, ein Stück von seinem Bein wegzurücken, da sich seine Geste viel zu intim anfühlte. Doch dann ließ sie es geschehen. Er beugte sich zu ihr hinüber, und nun endlich öffneten sich seine Gesichtszüge wie ein Vorhang, durch den man das Sonnenlicht ins Zimmer lässt.
„Sag mal, redest du eigentlich immer so viel?“
„Nur wenn der andere so wenig zum Gespräch beiträgt. Wenn Schweigen wirklich Gold ist, dann musst du verdammt reich sein.“
Er schaute sie nun wieder ernst an: „Es gibt ja auch nicht so viel zu reden. Außer wenn du wirklich was von mir willst, dann sag das ruhig. Ich hab da keine Probleme mit.“
Beide sahen sich schweigend an.
„Was läuft denn hier gerade ab?“, fragte Marie schließlich nervös. Ihr lädiertes, lahmes Bein fing an, unkontrolliert zu zittern.
„Das weißt du genauso gut wie ich!“
„Wie? Meinst du, hier läuft gerade ›Love me tender‹?“
„Eher ›Ticket to ride‹ oder meinetwegen auch ›Sexual healing‹“, grinste er unverschämt zurück.
„Ja, klar: ›Sexual healing‹!“, stöhnte Marie laut auf. „Aber ich als Tierspezialistin hätte es ja wissen müssen. Shrimps haben das Herz im Kopf, Männer das Gehirn in der Hose. Wir Frauen sind da anders. Ich hab mal gelesen, dass nur drei Prozent der Männer, aber achtzig Prozent der Frauen für hunderttausend Euro ein Jahr auf Sex verzichten würden.“
„Bist du etwa arm? Brauchst du hunderttausend Euro?“
Sie schüttelte den Kopf und senkte den Blick. Ihre Beinmuskeln bewegten sich wie von Geisterhand, und ein Schauer durchzuckte ihren gesamten Körper.
„Oder hast du Probleme damit?“, drängte er weiter, während sich Maries Gedankenkarussell ruckartig in Bewegung setzte. Was machte sie hier? War sie im Begriff, sich von dem wandelnden Fleischpalast, der ihr gegenübersaß, verführen zu lassen? Wollte sie das? Obwohl sie ihn erst heute kennengelernt hatte? Obwohl er gar nicht ihr Typ war?
Ja, sie wollte.
Nein, sie wollte nicht.
Ja … Nein … Ja … Das Karussell nahm immer mehr Fahrt auf. Drehte sich mit zunehmender Geschwindigkeit mal nach oben, mal nach unten. Änderte urplötzlich die Richtung, um auf einmal gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Ihr wurde schwindelig, und sie war kurz davor, aus dem Waggon geschleudert zu werden. Sie hatte die Kontrolle über ihr mentales Fahrgeschäft verloren und drohte, von ihren eigenen Gedanken hilflos mitgeschleift zu werden.
Er nahm ihr die Entscheidung ab, indem er sie bei der rechten Hand fasste und sanft über den Ärmel ihres Sweatshirts fuhr. Sie spürte dies wie einen Windhauch und hörte augenblicklich auf zu denken. Es war einfach nur schön, sich endlich mal woanders als in seinen Gedanken aufzuhalten. Er ergriff ihre linke Hand, und sie rief dieser zu: „Mach mit!“ Aber nichts passierte, alle Empfangsgeräte dort waren abgestellt.
„lustig-spannender Garn“
„Ein Muss für Köster-Fans.“
„Spannend, abenteuerlich und lustig.“
„Das Werk, das viele autobiografische Züge trägt, erzählt mit viel Humor und Einfühlungsvermögen die erstaunliche Geschichte einer Rocksängerin.“
„Toll geschrieben!“
„Gaby Kösters Roman-Heldin ist so stark wie sie selbst.“




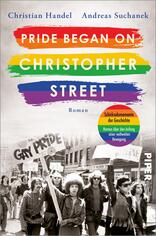




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.