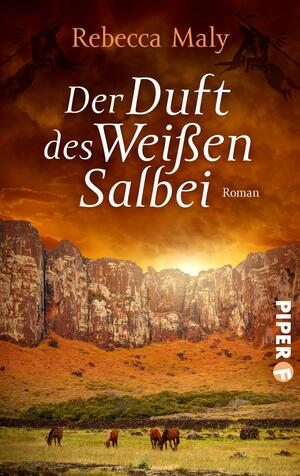
Der Duft des Weißen Salbei
Roman
„absolut mitreißend geschrieben“ - P. M. History
Der Duft des Weißen Salbei — Inhalt
Eine dramatische Liebesgeschichte in Kalifornien. Für alle Liebhaber von Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“
Louisiana, 1859. Anabell Arceneaux führt das behütete Dasein einer jungen Südstaatenlady, bis das Familiengut eines Tages zerstört wird und sie mit ihrem Vater nach Kalifornien auswandern muss. Zurück bleibt ihr Verlobter Lewis, der ihr nachzukommen verspricht. Doch ihr neues Leben im Land der Träumer und Goldgräber fordert seinen Tribut und hält einen schweren Schicksalsschlag für sie bereit …
„Der Duft des weißen Salbei“ erschien bereits 2013 unter dem gleichen Titel unter dem Autorennamen Erin Hamilton im Piper Verlag
Leseprobe zu „Der Duft des Weißen Salbei“
Für Gizmo,
auf deinem Rücken träumte ich mich
in viele ferne Welten. „Only the good die young“,
das gilt wohl auch für Pferde …
Danke. Mitakuye Oyasin.
Ich werde dich nie vergessen.
Buch 1
Woansila - Mitgefühl
When you are in doubt, be still, and wait;
when doubt no longer exists for you, then go forward with courage.
So long as mists envelop you, be still;
be still until the sunlight pours through and dispels the mists
– as it surely will.
Then act with courage.
Wenn du zweifelst, verharre und warte,
wenn der Zweifel nicht länger für dich existiert, dann [...]
Für Gizmo,
auf deinem Rücken träumte ich mich
in viele ferne Welten. „Only the good die young“,
das gilt wohl auch für Pferde …
Danke. Mitakuye Oyasin.
Ich werde dich nie vergessen.
Buch 1
Woansila - Mitgefühl
When you are in doubt, be still, and wait;
when doubt no longer exists for you, then go forward with courage.
So long as mists envelop you, be still;
be still until the sunlight pours through and dispels the mists
– as it surely will.
Then act with courage.
Wenn du zweifelst, verharre und warte,
wenn der Zweifel nicht länger für dich existiert, dann geh mutig
voran.
Doch solange Nebel dich umgibt, verharre;
verharre, bis das Sonnenlicht durchbricht und den Nebel auflöst
– was es sicher tun wird.
Dann handle mit Mut.
Ponca Häuptling White Eagle (18?? – 1914)
Sommer 1834 Louisiana
Die Hufe des Braunen klapperten laut auf der neuen Holzbrücke, die den kleinen Bach Petite Rouge überspannte. Ein Klang, der sich bis in Anabells Magen fortzusetzen schien, sie anfeuerte, ihre Vorfreude noch steigerte.
Endlich kehrte sie nach Hause zurück. Und diesmal nicht nur für einige Wochen, sondern für immer.
Die Lehrzeit im Kloster St. Aurelia lag ein für alle Mal hinter ihr. Die Nonnen und ihre Freundinnen Ann-Kathryn und Louisa würde sie vermissen, nicht aber die strenge Zucht, die Nachtwachen und Messen am frühen Morgen und am Abend, die beinahe jeden Tag bestimmt hatten.
Ganz oben in ihrem Gepäck lag ein Buch über das Leben von Heiligen, das sie selber akribisch kopiert und zu ihrer Überraschung zum Abschied von Schwester Margret geschenkt bekommen hatte. Die Geschichten von Menschen, die aus Gottesliebe die schlimmsten Qualen auf sich nahmen, hatten sie schon immer besonders fasziniert, lieber noch hätte sie jedoch eines der kostbaren Bücher über die Heilkunde ihr Eigen genannt.
Das Landaulett schaukelte über die hart getrockneten Schlammkrusten des Feldweges. Es staubte, doch der vordere geschlossene Teil der Kutsche hielt den Schmutz, der von Hufen und Rädern aufgewirbelt wurde, zuverlässig ab. Ohne den Fahrtwind hätte Anabell es an diesem heißen Tag auch kaum ausgehalten. Sie tupfte die Stirn mit einem Taschentuch und ersehnte den Moment, wenn der Weg ein kurzes Stück durch die Sümpfe führte. Dort hielten sich im Schatten der Zypressen zwar auch zahllose Mücken auf, doch die Kühle würde ihr einen Moment Erleichterung verschaffen.
In dem üppigen Kleid schwitzte sie wie in einem Räucherhaus. Zudem schien mit der Krinoline etwas nicht zu stimmen. Ein Teil musste sich gelöst haben und stach ihr bei jeder Erschütterung ins Bein. Hoffentlich war nur ein Rosshaarband oder eine Klammer verrutscht. Ein Span, der aus dem Fischbeinreif gebrochen war, glich einer kleinen Katastrophe und würde umfangreiche Reparaturen nach sich ziehen.
Bitte, lass Vater Lena nicht verkauft haben, dachte Anabell. Die Sklavin war eine Meisterin im Schneidern von Kleidern, ganz gleich ob für den Alltag oder aufwendige Ballkleider. Während seine Tochter die Klosterschule besuchte, hatte Victor Arceneaux natürlich weniger Verwendung für die Haussklavin.
Anabell wechselte den Sonnenschirm in die Rechte, als der Weg einen scharfen Knick machte, und beschattete ihr Gesicht.
Von nun an ging es durch schier endlose Zuckerrohrfelder. Die Pflanzen waren bereits übermannshoch, und wie Anabell mit geschultem Blick erkannte, würde die Ernte gut ausfallen.
Von Weitem sah sie eine Gruppe Sklaven an einer der Pressen. Ein Aufseher auf einem dürren Schecken überwachte die Arbeit und umkreiste die schwitzenden Männer wie ein Raubtier die Herde. Anabell kniff die Augen zusammen. Der Aufseher war ein Fremder. Rasmus würde sicher bei den Frauen auf den Baumwollfeldern sein und sie mit gierigen Blicken überwachen. Sie kannte den Mischling seit ihrer frühesten Kindheit und wusste auch, was man sich über ihn erzählte. Er sei ihr Halbbruder, gezeugt von ihrem Vater und einer Sklavin, die er weiterverkaufte, als ihre Mutter es nicht mehr ertrug, sie zu sehen.
Rasmus war ein brutaler Kerl, der von ihrem Vater noch immer protegiert wurde, wenngleich er die Blutsverwandtschaft niemals zugeben würde.
Das Landaulett erreichte eine Kuppe.
„Ben, halte kurz an!“, befahl Anabell dem Kutscher und lehnte sich hinaus. Nach diesem Anblick hatte sie sich schon seit Monaten gesehnt. Die Plantage der Familie Arceneaux war riesig. Vor ihr senkte sich das Land zu einem weiten Tal ab, an dessen Ende der Tupelo in der Sonne glitzerte. Er wurde von einem breiten, dunkelgrünen Band gesäumt: Sumpfland, Marschen und undurchdringliche Zypressenwälder voller Alligatoren und Moskitos. Daran schlossen Weiden an, auf denen einige Rinder grasten, und dann Zuckerrohr, ein Meer von Zuckerrohr. Im Süden zeigten eine schmale Rauchsäule und drei ausladende Bäume an, wo sich die Sklavenquartiere befanden, direkt daneben klein parzellierte Felder, auf denen sie Gemüse für den eigenen Bedarf anbauten und Schweine mästeten.
Nur noch eine kurze Fahrt mit der Kutsche entfernt begann eine weite Eichenallee. Sie führte auf das herrschaftliche Anwesen zu, in dem sie ihre gesamte Kindheit verbracht hatte.
„Können wir weiter, Miss?“, fragte der alte schwarze Kutscher.
Anabell seufzte und lehnte sich wieder zurück. „Dann los, lassen wir sie nicht länger warten.“ Der Fahrer schnalzte und schon setzte sich das Landaulett wieder in Gang.
Als sie in den Schatten der ersten Eiche tauchten, stieß ein kleiner Junge, der in den Zweigen gesessen und offenbar nach ihr Ausschau gehalten hatte, einen gellenden Pfiff aus. Anabell musste lächeln. Also würde Vater wieder alle antreten lassen, als sei sie eine Kommandantin auf Inspektion. Dann sollte sie seine Erwartungen besser erfüllen. Eilig schob sie ihren Fächer zusammen und strich ein wenig Staub von ihrem ausladenden Kleid. Über ihr bildeten die Alleebäume ein dichtes Dach aus Zweigen, einen grünen, flechtenbehangenen Tunnel, in dem eine seltsame Stille herrschte.
Das Anwesen strahlte wie ein blendend weißes Licht. Ein dreistöckiger Prachtbau mit dicken Säulen und Rosen in hölzernen Kübeln auf der Veranda. Auf der Treppe herrschte wildes Durcheinander, als die Hausdienerschaft in einer Reihe Aufstellung nahm. Im Hof warteten die Gärtner und Pferdeknechte.
Anabell winkte ihrem Vater zu, der langsam die Treppe hinunterstieg und an deren Fuß stehen blieb. Seine Miene war streng, wie immer, doch die Augen lächelten.
Er ist grau geworden, dachte Anabell unwillkürlich, während sie darauf wartete, dass ihr die Kutschentür geöffnet wurde.
„Willkommen daheim, meine Tochter“, sagte Victor Arceneaux mit tiefer Stimme, nahm ihre Hände und küsste sie auf beide Wangen. „Wie war die Reise?“
„Gut, danke. Ich bin froh, endlich wieder hier zu sein.“ Sie hängte sich an seinem Arm ein und ging mit ihm die Treppe hinauf. Geistesabwesend nahm sie wahr, dass ihre Amme nicht unter den Hausdienern war. Sofort trübte Angst die Freude über ihre Heimkehr. Die Vertraute aus Kindertagen war nicht mehr die Jüngste. War sie etwa tot?
„Wo ist Moja, Vater?“
„Die alte Voodoo-Hexe? Die hetzt schon seit dem frühen Morgen die Küchenmädchen umher, um dir all deine Leibspeisen zugleich zu kochen.“
Anabell fiel ein Stein vom Herzen. Sobald sie im Haus war, eilte sie, dicht gefolgt vom Hausherrn, in Richtung Küche, von wo es wunderbar nach scharfen Gewürzen, gebratenen Würsten und Flusskrebsen duftete.
Die alte Sklavin Moja stand vor einem Topf und rührte eifrig darin herum. Sie war noch ein wenig pummeliger geworden. Auf dem Kopf trug sie ein buntes Tuch, das vorn zu einem aufwendigen Knoten geschlungen war. Anabell hatte sie nie anders gesehen.
In diesem Moment sah Moja auf, und der Kochlöffel fiel ihr aus der Hand. Behäbig eilte sie zu Anabell, die vor Freude so überwältigt war, dass sie die Alte einfach in die Arme schloss und ganz fest an sich drückte.
„Anabell Arceneaux! Bist du völlig von Sinnen!“, wetterte ihr Vater im nächsten Augenblick, riss sie grob an der Schulter zurück und schlug Moja mit der flachen Hand ins Gesicht.
„Vater!“
„Wenn ich noch ein Mal sehe, wie du mit Negern vertraulich wirst, bekommt nicht Moja die Schläge, sondern du!“
Das musst ausgerechnet du sagen, dachte Anabell wütend. Du hast Mutter doch mit einer Sklavin hintergangen und hast den Bankert vor ihren Augen aufgezogen! Energisch machte sie sich aus seinem groben Griff frei und starrte ihn wütend an. Jedes Wort würde es schlimmer machen, und so schwieg sie und schluckte alles hinunter, worauf der Zorn ihr wie ein bleierner Klumpen im Magen lag.
Jetzt würde sie sicherlich keinen Bissen mehr essen können. Moja wandte sich den Töpfen zu, als sei nichts vorgefallen, doch Anabell kannte ihre Amme nur zu gut. Die leicht angezogenen Schultern und das Zittern ihrer Linken verrieten, dass sie weinte.
„Geh auf dein Zimmer und mach dich frisch!“
„Nur zu gerne“, fauchte Anabell leise zurück und verließ die Küche. Willst du nicht mitkommen, um zu kontrollieren, dass ich das Hausmädchen auch nicht zu freundlich begrüße?, dachte sie bissig.
Während sie die Stufen hochstieg, überlegte sie, nicht zum Essen zu erscheinen, doch das konnte sie Moja nicht antun.
Anabell lag lange wach. Draußen heulte der Wind um die Erker, als gelte es, gefallenen Seelen an den Höllentoren Konkurrenz zu machen. Es war der erste Sturm des Sommers.
Anabell betete, es möge kein Hurrikan werden, doch wissen konnte das nur Gott. Sie sprach ein schnelles Bittgebet, dann kehrten ihre Gedanken zum Abendessen zurück, das eigentlich eine Feier ihrer Heimkehr hätte werden sollen. Doch der Zwischenfall mit Moja hatte ihr wieder allzu deutlich gemacht, was es bedeutete, auf einer Plantage zu leben.
Als weißes Mädchen in einem Konvent ebenfalls weißer Nonnen hatte sie nicht einmal mehr über das nachgedacht, was ihr als Kind so unbegreiflich erschienen war. Warum sie nicht mit Batiste, dem Sohn des Gärtners, spielen durfte und warum die abenteuerlichen Geschichten von Schlangen und Löwen, die ihre Amme Moja erzählte, angeblich ihren Verstand vergifteten.
Als sie älter wurde, verstand sie es, ihre Treffen mit den Sklaven vor dem strengen Vater geheim zu halten und Mojas Geschichten wie das zu behandeln, was sie waren: ihr allergrößtes Geheimnis und der einzige Schatz, den ihre Vorfahren aus ihrer Heimat hatten mitnehmen können.
Anabell wälzte sich herum. Wind, der durch die undichten Fenster fuhr, bauschte die Vorhänge. Es war trotz alledem brütend heiß. Sie hätte die Läden zu gern geöffnet, doch dafür war der Sturm zu stark.
Das Unwetter hielt an und wurde immer heftiger.
Anabell hatte die laut gebrüllten Befehle bis in ihre Träume gehört und sie dort mit ihnen verknüpft. Ein Donnern ließ sie endgültig aufwachen.
„Miss Arceneaux, Miss. Sind Sie wach?“, tönte Mojas vertraute Stimme durch die Holztür.
„Ja, komm rein.“
Die Tür wurde geöffnet, und Moja schob sich ins Zimmer. Sie war völlig aufgebracht. „Ein Unglück, ein Unglück, Miss Arceneaux. Es brennt!“
Jetzt hörte auch Anabell die Glocken der nahen Kirche, die disharmonisch und schrill vom drohenden Unheil kündeten. „Wo ist das Feuer?“
Moja riss die Vorhänge auf. Der Nachthimmel glühte orange wie ein aufgerissener Höllenschlund. Anabell stürzte zum Fenster. Der Brand kam von Süden. Ein oranges Flammenband loderte hell über den Hügelkuppen. Das Zuckerrohr brannte.
„Oh Gott. Es kommt genau auf uns zu!“
Das Feuer musste von einem Blitz entfacht worden sein. Noch immer donnerte es, als würde der Himmel bersten, Blitze erhellten panisch herumlaufende Menschen, doch es kam kein Regen. Nicht ein einziger Tropfen.
„Sie müssen sich in Sicherheit bringen, schnell!“ Moja schob sie in die Mitte des Zimmers, zog die Vorhänge zu und nötigte Anabell, sich anzuziehen. Über das Nachthemd ein schlichtes Reisekleid. Korsage und Reifrock würden sie nur behindern.
„Pack alles zusammen, Moja. Du weißt, woran mein Herz hängt“, drängte Anabell und zog sich selber die bequemsten Schnürschuhe an. Die Haare noch zum nächtlichen Zopf geflochten, schob sie sich Kamm und gehäkeltes Haarnetz in die Taschen, drückte Moja kurz und wollte hinuntereilen, als sie von der Sklavin am Arm gefasst und festgehalten wurde.
Moja sah sie durchdringend an. Sie hatte plötzlich Tränen in den Augen. „Miss Anabell.“
„Was ist?“
„Sie dürfen es Master Arceneaux nicht sagen.“
„Ich schweige, versprochen. Was willst du?“
„Meine Tochter Vivien …“
„Du hast eine Tochter?“
„Ja. Sie war nicht tot, ich habe Milch genug gehabt für euch beide. Aber der Master weiß nichts von ihr. Sie ist im Sumpf am Tupelo, und sie ist ganz allein. Bitte, bitte.“ Moja drückte Anabells Hände und sah sie flehentlich an, doch die konnte ihr das Versprechen nicht geben.
„Ich weiß nicht, ob mich mein Vater fortlässt. Ich wünschte, ich könnte helfen.“ Ein hastiger Blick aus dem Fenster bestätigte, wie schnell sich der Brand näherte.
Anabell riss sich los, eilte hinab in den Flur und hinaus in den Hof.
Es herrschte ein wildes Durcheinander. Menschen eilten scheinbar ziellos umher, in den Ställen schrien Tiere vor Panik.
Der Sturm wirbelte verkohlte Fetzen von Zuckerrohr und Asche von verbrannten Bäumen durch die Luft und trieb den Menschen die Tränen in die Augen.
Anabell presste die Hand auf den Mund, um nicht noch mehr beißenden Qualm einzuatmen, und lief dorthin, wo das Chaos überschaubarer wurde. Ihr Vater saß auf seinem Rappen und brüllte unentwegt Befehle. Dem Tier stand Schaum vorm Maul. Es rollte mit den Augen, wollte fliehen und wurde gewaltsam zurückgehalten. In diesem Moment bemerkte Victor Arceneaux seine Tochter. Er blickte sie an, als sähe er einen Geist. Anabell ahnte, warum. Vor lauter Aufregung hatte er vergessen, dass sie nicht mehr in der Klosterschule war.
„Du musst dich in Sicherheit bringen, Anabell, du musst hinter den Fluss!“
Helfer von der Nachbarplantage erreichten die Hazienda im vollen Galopp. Binnen Sekunden waren die Aufgaben verteilt. „Gott steh uns bei, Kind.“ Master Arceneaux gab seiner Tochter einen Abschiedskuss. „Bete um Regen!“
Im Nu saß Anabell auf einer milchweißen Cremello-Stute. Ein junger Mann fasste das Tier am Zügel, und dann ging es los.
Anabell war für einen Moment zu entsetzt, um mehr zu tun, als sich am Sattelhorn festzuhalten und tatsächlich zu beten. Im schnellen Ritt ging es hinab zu den Viehweiden, wo sich die Rinder und Pferde ängstlich zusammendrängten. Ihr Vater besaß nur wenig Vieh, doch wenigstens das ließ sich retten. Die Ernte war hingegen hoffnungslos den Flammen ausgeliefert.
Der Sturm toste unvermindert, die Asche in der Luft erschwerte die Sicht und ließ die Augen brennen.
Drei Reiter machten sich daran, den Zaun niederzureißen, um auf diese Weise das Vieh zu befreien. Das Tor lag in der entgegengesetzten Richtung, näher am Feuer.
„Beeilt euch!“, rief der junge Mann, der bei Anabell ausharrte und noch immer ihr Pferd hielt, als sei sie nie zuvor geritten. Es war ihm deutlich anzumerken, wie gern er seinen Kameraden beigestanden hätte.
„Reiten Sie, helfen Sie beim Vieh, ich warte hier.“
Er wandte sich im Sattel um. „Und du kommst wirklich klar, Anabell?“
Ein Blitz zuckte und erhellte sein Gesicht. Blaue Augen, ein kantiges Gesicht, dunkelblondes Haar, das ihm in die Stirn wehte. Jetzt endlich erkannte sie den Freund aus Kindertagen. „Lewis Dearing? Bist du das?“
„Ja, hast du mich denn nicht erkannt?“, rief er und trieb sein Pferd den Hang hinab. Der braune Wallach verschwand schnell in der Finsternis.
Für einen Moment beschwor Anabell Kindheitserinnerungen herauf. Die sonntäglichen Besuche auf der Plantage der Dearings, die direkt auf der anderen Seite des Flusses lag. Sie hatte mit Lewis’ Schwester Laurell gespielt und ihn erst gar nicht wahrgenommen, dann blöd gefunden, und schließlich war sie jedes Mal errötet, wenn er in ihre Nähe kam. Das war mit dreizehn gewesen. Ihre letzte Erinnerung war die an einen schlaksigen Jungen mit wirrem Haar, der viel zu schnell gewachsen war und sich beim Einreiten eines Jungpferdes furchtbar überschätzt hatte. Er war mehrfach hinuntergefallen. Der Spott der Erwachsenen klang ihr jetzt noch in den Ohren. Sie hatte an ihn geglaubt und ihn heimlich angefeuert. Schließlich hatte er den Willen des Tieres besiegt und es stolz durch die Umzäunung gelenkt. Dass er sich bei einem der Stürze den Arm gebrochen hatte, war erst später herausgekommen. Er hatte tapfer bis zum Schluss durchgehalten.
Anabell fühlte sich seltsam erleichtert, in seiner Nähe zu sein. Sie wäre vielleicht nicht so mutig wie er, doch einfach nur ausharren und abwarten würde sie auch nicht. Jede helfende Hand wurde gebraucht.
Sie trieb ihre Stute den Hang hinab, näher zu den anderen Reitern und den Rindern, die in diesem Augenblick durch die entstandene Öffnung des Zauns strömten. Die Tiere brüllten verzweifelt und waren kurz davor, außer Kontrolle zu geraten.
Anabell hatte beinahe schon vergessen, wie man Vieh trieb, doch ihre Stute war gut ausgebildet. Sie stellte sich völlig selbstständig den ängstlichen Tieren in den Weg, hinderte ein Kalb am Ausbrechen und jagte es zurück zur Mutterkuh.
Es ging nach Norden, weg vom Feuer, hin zum Fluss. Als Lewis sah, dass Anabell gut allein zurechtkam, nahm er seine Position an der Spitze der Herde ein.
Es ging im flotten Trab voran, erst über eine andere Weide, dann mitten durch ein Baumwollfeld. Die Tiere trampelten nieder, was ohnehin dem Feuer zum Opfer fiele, sollte Gott die Erde nicht bald mit rettendem Regen segnen.
Anabell konnte den Hustenreiz nicht länger unterdrücken. Der Qualm in der Luft wurde immer dichter. Und es roch leicht nach Karamell, vielleicht war eine der Zuckerrohrpressen in Brand geraten. Endlich wurde der Boden morastiger. Die breiten Köpfe der Rinder pflügten durch Schilf. Wie ein ausgefranstes Tuch beugten sich die Zypressen des nahen Sumpfs vor der Macht des Sturms.
„Wo lang?“, schrie Lewis plötzlich. „Gibt es eine Furt?“
Panik kam in Anabell hoch. Sie hatte sich bislang keine Gedanken über den Weg gemacht. Doch die Sümpfe waren tückisch. Leicht konnten sie bei dem Versuch, die Tiere vor den Flammen zu bewahren, die Hälfte im zähen Morast verlieren. Man sah den Sumpfzypressen nicht an, wie tief das Wasser war, in dem sie wuchsen. Die krummen Wurzeln, mit denen sie sich in dem weichen Boden abstützten, glichen Fußangeln, in denen die Rinder schnell mit ihren Hufen hängen bleiben und sich die Beine brechen konnten.
Anabell stellte sich in die Steigbügel und versuchte irgendetwas zu entdecken, an dem sie sich orientieren konnte. Zum Glück würde die Sonne bald aufgehen, die ein diffuses Zwielicht vorausschickte.
Stand dort drüben auf dem Hügel nicht der alte Persimonebaum, von dessen Früchten sie immer so gern gegessen hatte? Sie kniff die tränenden Augen zusammen. Ja, das musste er sein, oder?
Zweifel nagten an ihr. Was, wenn sie alle in den Tod schickte? Schon galoppierte Lewis heran. „Weißt du nun, welchen Weg wir nehmen müssen? Die Männer können die Tiere nicht mehr lange zurückhalten.“
Anabell sah sich um. Die Rinder rollten panisch mit den Augen. Die Reiter hielten sie mit Peitschenhieben davon ab, sich selber einen Weg ins Wasser zu suchen. Die Tiere in den hinteren Reihen drängten nach, rissen die Köpfe hoch und stiegen den vorderen auf die Rücken.
„Ich bin mir nicht sicher, Lewis!“
„Für Zweifel ist jetzt keine Zeit“, sagte er, nahm ihre Hand und drückte sie ganz kurz. „Wohin, Ana?“
„Nach links. Da ist eine Sturmschneise. Dort treiben wir sie rein, dann einfach geradeaus. Die Spur wird immer breiter.“
Lewis sparte sich jedes weitere Wort. Er sprengte davon und rief den Männern die neue Richtung zu.
Das Feuer näherte sich mit lautem Tosen.
Anabell schien wie aus einem Traum erwacht, hieb ihrer Stute die Fersen in die Flanken und schnitt den Rindern und Pferden so den Weg in das sumpfige Labyrinth ab. Nun, da sie sich parallel zu den Flammen bewegten, wurde es viel schwieriger, die Rinder nicht am Ausbrechen zu hindern. Die jungen Bullen am Rand der Herde waren besonders gefährlich. Nachdem ihre Stute gestoßen wurde und beinahe gestürzt wäre, scheute auch Anabell nicht mehr davor, jedem Tier, das sich zu nahe an sie heranwagte, einen heftigen Fußtritt vor den Kopf zu verpassen.
Das Feuer kam immer näher. Schon flogen die ersten Funken über sie hinweg, taumelten wie betrunkene Leuchtkäfer zwischen den Stämmen umher. Anabell schlug einen Glutfunken aus, der sich in den Stofffalten ihres Kleides festgesetzt hatte. Die Flammen rückten noch näher, und in Anabell wuchs die Angst, sich doch geirrt zu haben. Sie wusste nicht, ob ihr der Qualm oder doch die Panik so zusetzte, dass sie kaum mehr Luft zum Atmen bekam. Doch aus irgendeinem Grund blieb sie ruhig. Sie lenkte ihr Pferd, arbeitete wie die Männer, und dann erschallte von vorn endlich der ersehnte Ruf.
„Hier ist es, hier ist die Schneise!“
Mit frischer Kraft trieben sie die Tiere zwischen die vor vielen Jahren umgestürzten Bäume, die eine Art natürlichen Korridor bildeten. Ihre von Moos und jungen Schösslingen überwucherten Stämme lagen zu beiden Seiten des Wegs, der in den Sumpf führte. Die Pferde wagten sich zuerst in das brackige Wasser. Im Gegensatz zu den Rindern kannten einige die Strecke. Soweit Anabell wusste, wurde die Furt bei Niedrigwasser zumindest hin und wieder von Reitern benutzt, die auf dem kürzesten Weg nach Norden wollten.
Sobald die ersten Rinder im Wasser waren, lief alles fast wie von allein. Die Tiere folgten einfach den Pferden. Erst jetzt, da die Sicherheit in greifbarer Nähe war, fiel die Anspannung von Anabell ab. Sie fühlte sich völlig erschlagen und sackte ein wenig im Sattel zusammen. Über ihr fuhr der Wind tosend in die dürren Wipfel der Zypressen und drückte sie gefährlich tief. Flechten, die in langen Zöpfen an den Ästen hingen, lösten sich und wurden davongeweht. Umherfliegende Glut fiel zischend in das schwarze Wasser oder verglomm in den Bäumen.
Wir sind gerettet, dachte Anabell erleichtert, beugte sich aus dem Sattel und schöpfte ein wenig von dem dunklen Nass. Es schmeckte erdig. Aber selbst die feinen Sandpartikel, die von den Tieren aufgewirbelt worden waren, konnten sie nicht davon abhalten, noch etwas Wasser aus dem Fluss zu trinken und so das schreckliche Brennen in ihrem Hals zu lindern.
Ihre Stute setzte sich wieder in Bewegung, schob sich ins tiefer werdende Wasser, bis Anabell erschrocken die Zügel anzog. War sie jetzt nicht ganz in der Nähe des Wäldchens, in dem sich Mojas Tochter befinden sollte?
Hin und her gerissen sah sie den Männern nach. Sie feuerten die Rinder mit Rufen und Schlägen an. Lewis drehte sich nach ihr um. Winkte ihr zu. Sie sollte sich beeilen.
„Ich komme!“, schrie sie gegen das Tosen des Windes an.
Ihre Stute wollte den anderen folgen und schlug unruhig mit dem Kopf.
Moja hatte immer für Anabell gesorgt. War wie eine Mutter für sie gewesen. Hatte tröstende Worte gehabt und immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Die Wärme, die sie bei ihrem Vater vergeblich gesucht hatte, hatte sie anfangs von einer Fremden bekommen. Moja hatte nie darum gebeten, sich um Anabell kümmern zu dürfen. Sie war dazu gezwungen worden ihr eigenes Kind zu vernachlässigen, um die Tochter ihres Masters zu nähren. Was hatte Moja gesagt? Sie hatte behauptet, ihre Tochter sei tot? Lebte sie etwa seitdem in dem Wäldchen? Die einzige freie schwarze Frau weit und breit.
Mojas Tochter.











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.